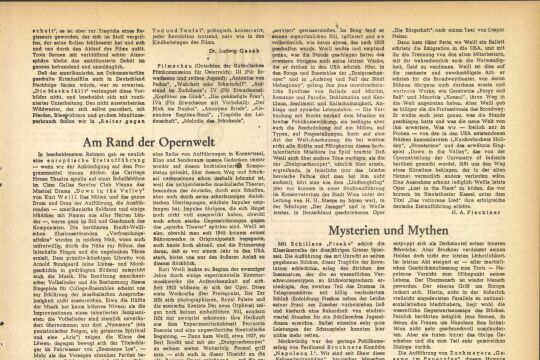Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Nymphomanie der Maria Stuart
Den letzten Kredit, den das Grazer Schauspiel in der opemseligen Ära Nemeth noch besaß, hat es nun auch noch verloren. Mit der (vielbelachten) Neuinszenierung von Schillers „Maria Stuart“ war der Tiefpunkt einer seit Jahren an personellen Schwierigkeiten laborierenden, vom Intendanten wenig beachteten Sparte des Grazer Theaterbetriebes erreicht. Da war dem jungen Schweizer Guido Huonder eine Stelle in Schillers Briefen aufgefal- leri, die besagt, daß der Dichter die Maria Stuart „immer für ein physisches Wesen“ gehalten habe; und schon bekam er Schillers Bemerkung in die falsche Kehle, „jubelte laut“ darüber — wie er selbst bekennt —, daß des Dichters Wort seine „spontane Betrachtungsweise des Stückes“ bestätigte, und ging hin, seine Grazer Inszenierung an seiner fixen Idee eines sexualpathologischen Falles aufzuhängen. — Nun ist es ja gut und richtig, daß immer wieder junge Künstler sich mit einer neuen Sichtweise den Werken der Klassiker nähern. Ärgerlich aber ist nur zu oft ihre Aufdringlichkeit, ihre Präpotenz und ihr Mangel an Bildung. Letzteren dekouvrierte der junge Mann in geradezu erschreckender Weise an
Hand seines Aufsatzes im Programmheft — den Mangel an Geschmack jedoch, an Stilgefühl und an Werkverständnis bewies fast jede Szene des dreieinhalb Stunden dauernden (allerdings meist belustigenden) Abends. Das an sich nicht unberechtigte Bestreben, den „klassischen“ Figuren ihre Aura zu nehmen, erschöpfte sich in einer Privatisierung des Stoffes bis zur Infantilität — etwa so, wie wenn Geschichte in Form von Comics vermittelt wird. Elisabeth ist eine seltsam verklemmte Marionette als Königin, privat jedoch eine lächerliche, greinende Puppe, die mit Geilheit hinter ihrem kleinen Sexglück her ist; Maria wirft sich in die Arme aller Männer, selbst ihres Wärters, hopst von einem Ende der Bühne zum anderen, wälzt sich auf dem Boden oder heult verzweifelt im Park von Fotheringhay, der dem Garten eines Irrenhauses gleicht, ihr „Eilende Wolken, Segler der Lüfte“ in den Raum. Kein Wunder, daß Mortimer ebenfalls zur unfreiwilligen Karikatur wird, zu einem fanatisierten Trottel, der in „Jesus-People“ macht. Schade um die Schauspieler, schade auch um die reizvolle Bühnengestaltung Skalickis, die aus maurischen, gotischen und nach-
barooken Reminiszenzen eine Art Brunnenhalle in einem Kurort formt.
Nach diesem Debakel konnte es nur noch besser werden: die deutsch-demokratischen „Neuen Leiden des jungen W.“ von Ulrich Plenzdorf gefielen, ob jung, ob alt, so ziemlich allen. Ein dankbares Stück, mit volksdemokratisch sauberer Moral, die auch in politicis nur anritzt, aber nicht wirklich kratzt. Die Zeitlosigkeit Goethes wird demonstriert an Hand eines jungen Menschen der Pop-Generation und seiner kleinen und großen Schwierigkeiten mit der Welt der Hochleistungsgesellschaft — flott, keß, mit viel Gefühl hinter der Fassade. Dann ulnd wann erinnert man sich ein wenig ans gehobene Laienspiel — aber das fällt nicht ins Gewicht, überhaupt bei der ganz ausgezeichneten Qualität der Grazer Inszenierung durch Helmut Polixa. Wenn sich die Bühnenmaschinerie so sehr wichtig macht und auf Hochtouren den ganzen Abend über läuft, Goethe aus dem Lautsprecher ertönt und der junge Held mal vom Schnürboden, mal aus einer Loge her auftaucht, wird man ein bißchen skeptisch, weil mit derlei Mätzchen nur zu oft Mangel an Tiefgang ver schleiert werden soll. Diesmal ist die Skepsis unbegründet: ohne Krampf und ohne gezwungene Gags reiht sich hier Rückblende an Rückblende zu einem zwar nicht tiefschürfenden, aber in seiner herzlichen Unbekümmertheit freundlichen Theatererlebnis.
Mit einer Monsterproduktion wartet das Opernhaus auf: Bernsteins „West Side Story“ scheint die Möglichkeiten des Betriebes beinahe zu übersteigen. Aber unter Prawys Fittichen, mit Meister Walter Goldschmidt am Pult und einigen „Spezialisten“, wie dem Regisseur Wolfgang Weber, dem Choreographen Larry Füller, der temperamentvollen Nives Stambuk (Anita) und Carmine Terra (Bernardo), konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Zum fulminanten Erfolg, der in nichts der Wiener Volksopem- produktion nachzustehen scheint (von dort her kamen auch die Dekorationen W. Skailickis), verhalten aber auch die hauseigenen Kräfte, allen voran Wolfgang Siesz, dem der Sprung ins Musical mit Anstand gelang, und die sympathische Sopranistin Raeschelle Potter, der die Rolle der Maria wie angegossen paßt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!