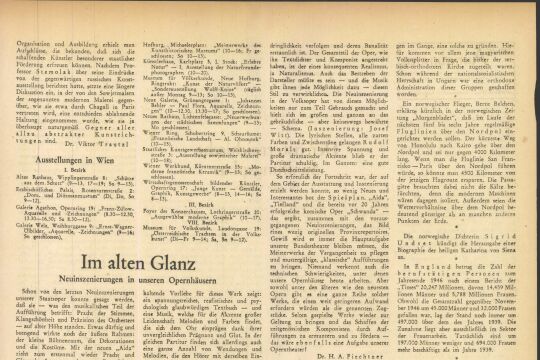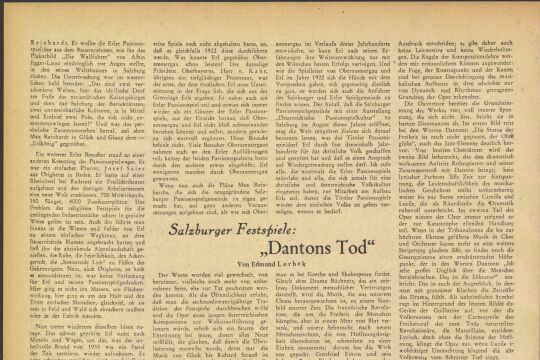Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Teufel von Loudun
Den Beginn des nun schon sehr profilierten, international bekannten und beschickten Festivals „Steirischer Herbst“ markierte eine beachtliche Anstrengung der Grazer Oper: Krzysztof Pendereckis zwei Jahre altes, im Auftrag der Hamburgischen Staatsoper geschriebenes und auf Aldous Huxley basierendes Werk über einen historischen Hexenprozeß zur Zeit Richelieus, „Die Teufel von Loudun“. Was den Komponisten, der das Libretto selbst verfaßte, an dem Stoff zunächst interessiert haben dürfte, ist das Thema der Intoleranz und des Fanatismus schlechthin. Zu dreißig meist ganz kurzen Szenen komprimiert, ersteht die dokumentarisch belegte Geschichte eines moralisch zwar nicht integren Priesters, der aber unschuldig das Opfer der sexuellen Hysterie einiger Nonnen und gleichzeitig auch einer politischen Intrige wird. Das ist ganz gewiß ein fündiger Stoff, dem dramatische Effekte nicht erst künstlich aufgesetzt werden müssen — ein Sujet jedenfalls, dem es an Aktualität nicht fehlt. Dennoch drängt sich einem ein wenig der Eindrude auf, daß es hier nicht nur um Magie, die sich als Glaube tarnt, und um den Terror durch finsteren Dogmatismus geht, sondern daß Religion und Kult gleichgesetzt werden mit Magie. So erscheint auch die Analogie zwischen dem gemarterten Priester Grandier und Christus, wie sie der Maler Ernst Fuchs auf dem Transparentvorhang andeutet, nicht berechtigt, sondern vielmehr voreilig gewählt zu sein.
Bewundernswert und packend ist nicht nur die szenische Anlage der Oper. Das gleiche gilt für die Musik, die eine ganz entscheidende dramaturgische Funktion ausübt. Der Vielschichtigkeit der handelnden Personen entspricht der Reichtum der musikalischen Mittel: freier und rhythmisch gebundener Dialog, Rezi- tative, Ensembleansätze und der Chor, dem alle erdenklichen Ausdrucksmöglichkeiten abverlangt werden. Pendereckis stilistisches Vokabular — Cluster-Montagen, peitschende Glissandi und eine zuweilen „solistische“ Instrumentation — wird virtuos zu dramatischer Aussage eingesetzt.
Die Grazer Aufführung, übrigens die erste in Österreich, wurde lange und enthusiastisch bejubelt. Tatsächlich stellt sie nicht nur eine enorme Leistung aller Beteiligten — vom Dirigenten Berislav Klobucar bis zum letzten Choristen — dar, sie ist auch trotz gewisser Mängel in jedem Abschnitt packend, ja mitreißend in ihrer wilden Düsterkeit. Der Maler Emst Fuchs — für dieses Thema besonders zuständig — schuf zwar durchaus suggestive, eigenwillige Visionen, die Bauten selbst sind jedoch nicht sehr einfallsreich und nützen den Bühnenraum zuwenig; das Ganze wirkt mehr zeichnerisch als plastisch. Intendant Reinhold Schubert als Regisseur gelangen am besten die gut konturierten kleinen Szenen mit wenig Personen; die große, zwingende Anlage des Geschehens vermißte man etwas. Ensemble und Orchester schienen mit dem Stil dieser Musik noch nicht sehr vertraut: die kühne Leidenschaft, die Härte und Grausamkeit gingen oft in allzu braver Biederkeit unter: man hatte da und dort Schwierigkeit, den eigenen Schatten zu überspringen. Dieses gelang von den Solisten eigentlich nur der großartigen Margarita Kyriaki in der Rolle der „besessenen“ Oberin Jeanne und Hans Laettgen, der den unschuldig leidenden Pater Grandier gab. Die einschränkenden Bemerkungen können indes auf keinen Fall das große Verdienst schmälern, das sich die Grazer Oper mit der mutigen Tat dieser Aufführung erworben hat.
• Im Großen Festsaal der österreichischen Akademie der Wissenschaften wurde ihrem Ehrenmitglied, dem Gründer und Leiter der SOS-Kin- derdörfer DDr. h. c. Herman Gmei- ner, die Albert-Schweitzer-Gold- medaille verliehen. An dieser Veranstaltung eines internationalen Kuratoriums haben unter anderem auch die Tochter Albert Schweitzers, Rhena Schweitzer, und der Vertreter Italiens in diesem Kuratorium, der Bruder des Papstes, Ludovico Montini, teilgenommen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!