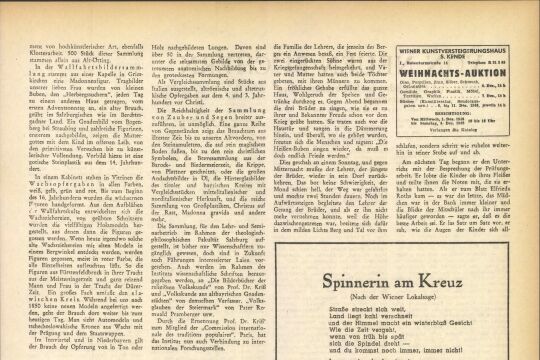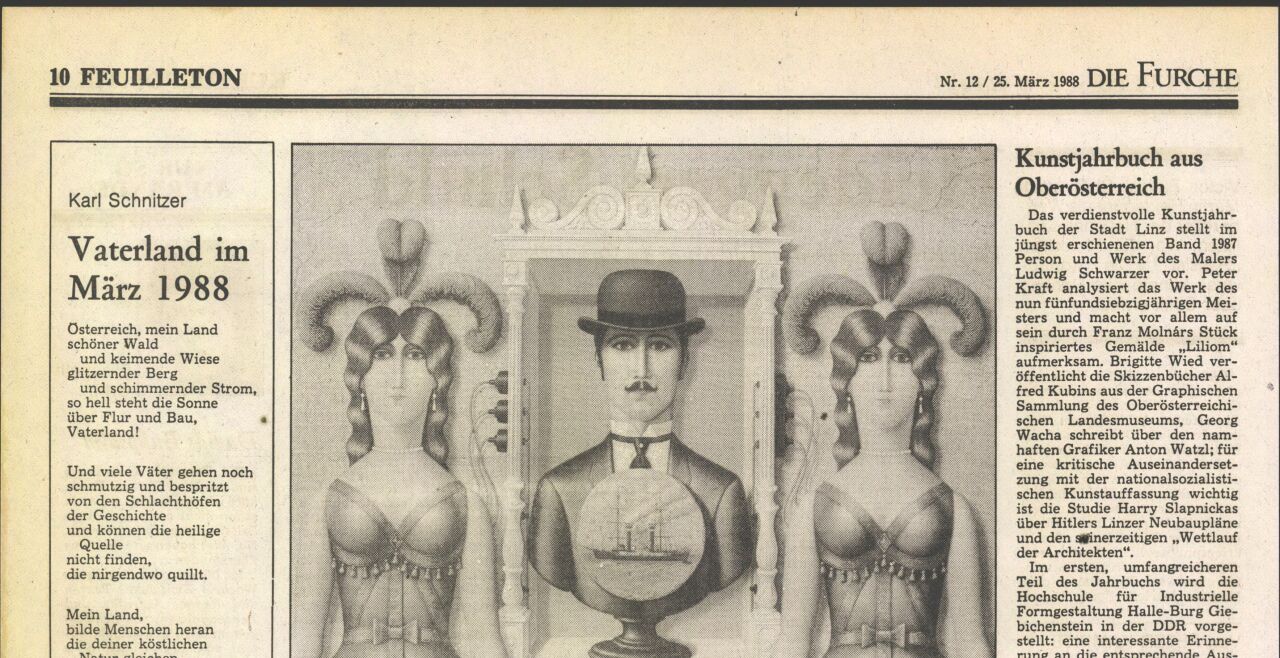
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erinnerung und Sprache
Ich male nicht, was ich sehe, sondern was ich sah“, schrieb Edvard Münch in Paris im Jahr 1890. Als der norwegische Maler diesen Satz aufzeichnete, war er siebenundzwanzig Jahre alt. Eine evolutionäre Einstellung damals, in Wahrheit nichts als die Anerkennung der Verweigerung der Wirklichkeit durch einen Künstler, der mit fanatischem Drang unter Beweis stellte, daß für ihn die Wirklichkeit nur dann Wert besitze, wenn er sie innerlich verarbeitet habe.
Der Künstler gestaltet seinen eigenen Kosmos. Es ist ihm erlaubt. Dieser Kosmos läßt deutlieh erkennen, daß er dem eigentlichen am nächsten ist. (Deshalb auch die inneren Erschütterungen, steht man vor Münchs großformatigen Bildern.)
Auch der Schriftsteller darf sagen, er beschreibe nicht, was er sehe, sondern was er sah. Das heißt, das Gesehene (Erlebte) braucht die Distanz, oder der Schriftsteller verweigert sich dem Augenblick des Erlebnisses, indem er es wohl aufnimmt, in seinem Gehirn speichert, aber nicht gleich anrührt. Ich gebe auch meine eigenen Erfahrungen wieder. Der Schriftsteller legt seinen Kosmos mittels der verarbeiteten Wirklichkeit aus, die er darstellt. Diese Wirklichkeit ist umso schwieriger darzustellen, je eindringlicher und überwältigender ein Erlebnis war, deshalb verlangen derlei Erlebnisse eine längere Verarbeitung. Es handelt sich darum, Distanz zu gewinnen. Erst die Distanz vermittelt die reinere Anschauung der Dinge.
Kommen wir zum eigentlichen Anlaß dieser Aufzeichnungen. Als Hitler in Osterreich einmarschierte, war ich fünfzehn Jahre alt, als der Krieg ausbrach sechzehn Jahre, und mit achtzehn wurde ich zum Reichsarbeitsdienst und kurz darauf als Soldat ngezogen. Den Einmarsch selbst erlebte ich nicht direkt, ich war Internatsschüler, das geistliche Internat befand sich isoliert außerhalb der Stadt.
Die anfänglichen Auswirkungen stellten sich uns mit den Organisatoren der neuen Ära vor, jungen Männern, Braunhemden, die uns auf dem Spielplatz antreten ließen, unsere Namen in Listen aufnahmen und erklärten, wir gehörten nun der Hitlerjugend an. Sie kamen täglich, ließen uns Aufstellung nehmen, sprachen uns die neuen Liedtexte vor, ließen sie uns nachsprechen, sangen zum Text die Melodie, die wir nachzusingen hatten, einer gab mit den Armen den Takt, forderte uns auf, lauter zu singen, immer lauter, und je lauter wir nach einigem Zögern wurden, umso zufriedener war er.
Später nahm man uns in Grüppchen mit in die Stadt, führte uns in gewisse Kreise ein, ich geriet in den Kreis junger Leute um einen älteren Mittelschullehrer, man saß auf dem Boden, der Lehrer mit einigen anderen am Tisch, sang zu einer Gitarre, sprach, als zelebriere man, es drehte sich um die Zeit, die vor dem Anschluß lag, eine schwere Zeit, sagten sie, ansonsten verstanden wir nicht viel von dem, was sie meinten, sie waren unter sich, beachteten uns kaum. Für uns war es eine Gegenwelt, einer -
seits trauerten wir einer Erziehung der Unterdrückung nach, vielleicht weil wir schlimmere Repressionen ahnten, andererseits waren wir froh, den Zwängen des Internats entronnen zu sein und erhofften neue Freiheiten.
Die unmißverständliche Trauer und Niedergeschlagenheit des Regens, der an jenem Märzmorgen in den Studiersaal getreten war, in seinem besten Talar, das große Silberkreuz an einer Kette auf der Brust, und den Einmarsch der Hitlertruppen verkündet hatte, hatten wir mit der Unbefangenheit der Jugend erwidert; stehend und noch stehenbleibend, als der Regens den Studiersaal bereits verlassen hatte, lag über unseren gesenkten Köpfen bereits das Ende der letzten Ära und war die neue noch nicht angebrochen; die große Verantwortung der Erwachsenen, ihr Entweder-Oder hielt uns in Schwebe, doch wir waren daran nicht beteiligt. Wohl fühlten wir mit, im ersten Schock spürte der eine oder andere Trauer und Niedergeschlagenheit nach, aber das Vergangene und Kommende entzog sich unserer Verantwortung. Immer noch waren wir auf der Suche nach Rich-tungsweisern und Vorbildern und blieben ihnen ausgeliefert.
Dieser hier wiedergegebene Text entstand vor etwa fünf Jahren, also fünfundvierzig Jahre danach, in keinem anderen Zusammenhang als mit dem Versuch, mich mit dem, was gewesen war, auseinanderzusetzen. Der Text befriedigte mich nicht. Es fehlte der eruptive Sprachfluß, der den damaligen sich überstürzenden Ereignissen entspräche, oder diese verweigerten sich mir, oder ich hatte sie noch immer nicht verarbeitet, zur Darstellung nicht reingewaschen von den Nebenprodukten wie von Zweifeln, Skrupeln, Bedenken, falschen
Vorstellungen, vom Vorgegebenen„ das man durch die vielen Jahre nicht oder zu wenig überprüft hatte. Nicht das Vergangene oder Gewesene als solches und die Auslegungen sollten zur Darstellung gelangen, sondern es mußte sich selbst darstellen, aus mir hervorbrechen wie ein Vulkan.
Darf ich noch einmal auf Edvard Münch zurückkommen. Seine Büder aus dem Vergangenen haben eine lebendige Gegenwart. Dies deshalb, weil er seine inneren Bilder mit allem Menschlichen solange angereichert hatte, bis sie nach außen brachen. Die erschütterndsten wohl in seinem „Lebensfries“.
Vielleicht werde ich noch längere Zeit warten müssen, vielleicht bin ich nahe daran, ich habe nun die Ereignisse ein halbes Jahrhundert überlebt, die Erinnerung wird, durch die Arbeit der Jahre auf ein Wesentliches vermindert, eine Essenz zutage fördern, zu der ich mich bekennen muß.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!