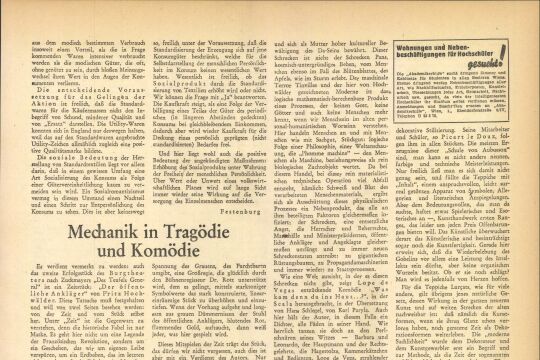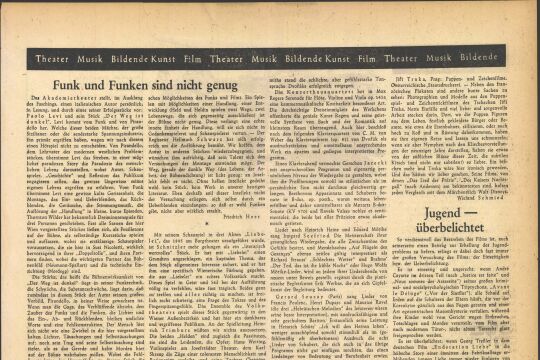Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gesellschaftsprobleme
Man denkt an Tschechow, eine untergehende Gesellschaftsschichte wird vorgeführt. Nur befinden wir uns in dem vor fünfzig Jahren entstandenen Schauspiel „Herrenhaus“ des damals 23jährigen Amerikaners Thomas Wolfe, das derzeit im Theater in der Josefstadt gespielt wird, nicht in Rußland, sondern in den Südstaaten Amerikas zur Zeit des Sezessionskrieges.
Man denkt an Tschechow, eine untergehende Gesellschaftsschichte wird vorgeführt. Nur befinden wir uns in dem vor fünfzig Jahren entstandenen Schauspiel „Herrenhaus“ des damals 23jährigen Amerikaners Thomas Wolfe, das derzeit im Theater in der Josefstadt gespielt wird, nicht in Rußland, sondern in den Südstaaten Amerikas zur Zeit des Sezessionskrieges.
Thomas Wolfe hat selbst erklärt, wie er dieses Stück aufgefaßt wissen will: Es beruhe auf dem Glauben, daß es „Menschen und Herrenmenschen und eben nicht nur Menschen gibt“, auf dem Glauben „an die Notwendigkeit menschlicher Sklaverei in irgendeiner Form“. So nun wird General Ramsay sein Heim, das Herrenhaus, zum Inbegriff einer festgefügten Gesellschaftsordnung, einer Herrenwelt, in der es „wenige Herren und viele Knechte“ gibt. Gegen dieses väterliche Gentlemanideal rebelliert höhnisch sein Sohn Eugene, er verabscheut den Krieg, zieht aber doch mit dem Vater ins Feld und spricht, nach Rückkehr aus dem verlorenen Feldzug, nach Verkauf des Herrenhauses an einen rüden Kriegsgewinner, vom „Weg zurück“. Beim Abbruch des Hauses erschlägt ihn eine Säule.
Jedenfalls zeichnet Thomas Wolfe damit einen jungen Menschen, in dem das Kontra gegen eine aristokratische Gesellschaftsordnung aufschäumt, der er doch • letztlich zugeordnet bleibt, was symbolisch noch sein Tod bekundet. Dieses Antithetische ist freilich nicht voll überzeugend durchgeführt, aber
Eugene wird in seiner inneren Zwittersituation in poetische Bereiche gehoben, das zutiefst Unbefriedigende in ihm, das lospoltert, macht ihm auch die Fragwürdigkeit, das Schattenhafte des Daseins spürbar. Hierin liegt der Wert des Stücks, das Beharren im Antiquierten Herrenmenschen-Ideal ist uns völlig fremd.
In der Bearbeitung durch den Regisseur Karl Paryla bleibt das Vorspiel weg, das den Bau des Hauses im achtzehnten Jahrhundert vorführt. Vom Lautsprecher ist ein „Erzähler“ zu hören, der verbindende Worte spricht. Das Bühnenbild von Bernd Müller und Jörg Neumann vereint simultan den Innenraum mit den Säulen des Vorbaus. Und da nun entfaltet Paryla eine hektische Lichtregie in stetem Wechsel von Hell und Dunkel, einmal hier, einmal dort. Versteht sich, daß es durch ihn in diesem nunmehr parylatischen Herrenmenschenbereich keine Noblesse gibt, sondern vor allem Eugenes Re-bellentum noch recht aufgeputscht wird, wogegen alles andere zurücksinkt. Hierfür ist Klaus Maria Brandauer der geeignete Darsteller. Erik Frey gibt dem General Be-
herrschthedt, Guido Wieland kennzeichnet den Kriegsgewdnner durch inferiores Auftrumpfen.
*
Banalität ist bei Beckett, bei Ionesco nur scheinbar banal. In dem Zweipersonengespräch „Oberösterreich“ von Franz Xaver Kroetz, das derzeit im Kleinen Theater im Konzerthaus vorgeführt wird, hört man einen Abend lang faktisch Banales, ausschließlich Belangloses ohne jeden Tiefgang.
Maßgebliche bundesdeutsche Kritiker, die diesem 27jährigen Autor überragende Bedeutung beimessen, wollen glauben machen, daß Kroetz stets Randerscheinungen der Gesellschaft vorführe, Menschen, die sich nicht artikulieren können. Aber ein Lastwagenfahrer und seine Frau, eine Verkäuferin, sind keine Randerscheinungen, sondern Durchschnittsmenschen. Die können sich sehr wohl ausdrücken. Kroetz selbst behauptet, er prangere allgemeingesellschaftliche Mängel an. Aber was für Mängel sind das, wenn sich diese Leute Privatauto, Farbfernsehen und Kühlschrank in Raten kaufen konnten?
Die Frau weigert sich, das zu erwartende Kind abtreiben zu lassen, sie müssen sich daher einschränken. Das sieht Kroetz als skandalösen Mangel der Gesellschaft an! Sie werden eben keinen Wagen haben, den haben viele nicht. Die allgemeine Konsumationsgier hat offenbar dem Kommunisten Kroetz den Kopf verdreht, daß der die Notwendigkeit sich einzuschränken als Verbrechen der Gesellschaft ansieht.
Das Alltägliche von Durchschnittsmenschen in aller öden Alltäglichkeit wiedergegeben zu sehen,
dazu soll man ins Theater gehen? Arges Absinken der Stückqualität, völliger Dimensionsverlust. Gespielt wird unter der Regie von Edwin Zbonefc vorzüglich. Peter Vogel und besonders Gertraud Jesserer überzeugen bis in kleine Nuancen. Eine gut eingerichtete Wohnküche schuf Wolfgang Müller-Karbach als Bühnenbild. (Anmerkung: Der Titel bezieht sich auf eine Zeitungsnotiz über einen Mordfall in Oberösterreich. Die beiden sprechen darüber.) *
Wieder begannen die Vorstellungen des Volkstheaters in den Wiener Außenbezirken. Die erste Premiere fand, wie seit Jahren, im Haupthaus statt, diesfalls mit dem Schauspiel „Der öffentliche Ankläger“ von Fritz Hochwälder. Man weiß, Fouquier-Tinville liefert während der Französischen Revolution Tausende ans Schafott und beruft sich darauf, nur Befehle auszuführen, ein Sklave seines Amts zu sein. Der Eindruck dieses 26 Jahre alten Stücks: Es wirkt durch die bis ins letzte durchschaubare, nahezu mechanische Präzision der Zwangsläufigkeit, mit der sich da alles vollzieht, mit der schließlich dieser „Pflichf'-Mensch des Grauens unwissentlich für sich selbst die Todesstrafe fordert, sich selbst der Guillotine überantwortet. In der recht beachtlichen Aufführung unter der Regie von Jürgen Wilke bietet Ernst Meister in der Titelrolle seine bisher beste Leistung: Das ist die kalte Energie des gefügigen Schreibtischmörders. *
Kann Richard Wagners „Lohen-grin“ nicht nur Bewunderung, sondern auch Spott herausfordern? Der ehemalige Sänger Nestroy hat neun Jahre nach der Uraufführung dieser Oper und ein Jahr nach der Wiener Wiedergabe eine Parodie „Lohengrin oder Die Prinzessin von Dragant“ geschrieben, in der er die Vorgänge verulkte und die Gesangstexte durch vulgär Wienerisches ersetzte. Da wird gerochen und abgestochen, die holden Burgfräulein neiden Elsa ihren Ritter, wollen nicht slingen, sondern vor Wut zerspringen, Herr „von“ Lohengrin aber singt ankommend „Du mein liebes Schaf“, weil ihn ein solches hierhertrug. Die Gralserzählung geht in Dreivierteltakt über, und am Schluß wird gesungen „O du lieber Lohengrin, alles ist hin“. Die Notenblätter von einst gingen verloren, so hat der in Wien lebende Engländer David Ryan King dazu eine witzige Musik geschrieben, die Eva Binder temperamentvoll am Pianino exekutiert. Gespielt wird unter der Regie von F. F. M. Sauer vor allem von Josef Pechhacker als Lohengrin und Angelika Raubeck als Elsa mit lustvoller Verve, mit karikierender Höhung in heldische Gefühlsbereiche. Die Bühnenbilder von Ingrid Cerny sind optisches Korrelat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!