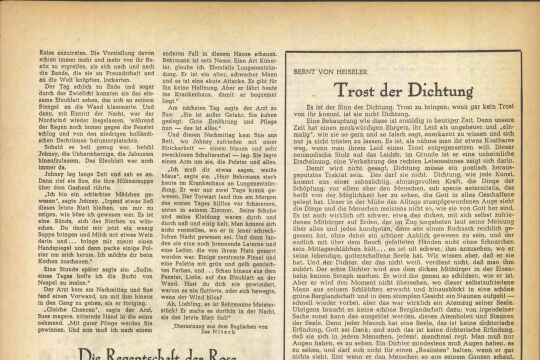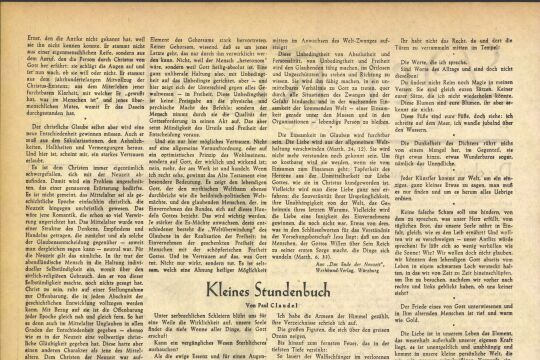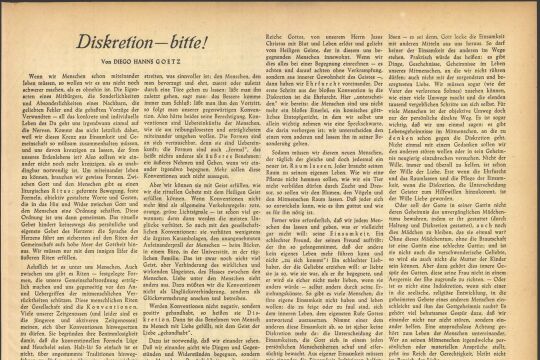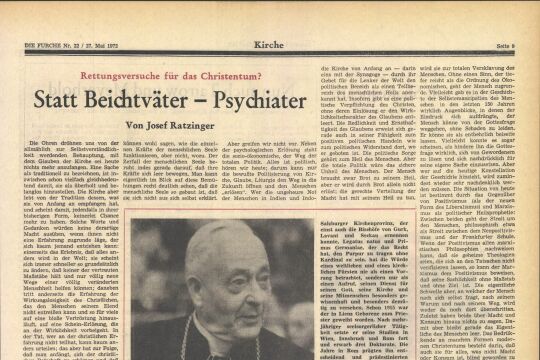„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat.“ Was für ein Anfang des Denkens. Diese Jubelsentenz, zu sagen in einer Zeit, da immer etwas fehlt. Es wird global vermisst und auch im Dorf. Hier wird es äußerlich sichtbar anhand von leeren Straßen und dass aus leeren Fenstern niemand sieht. Global spürbar ist die Sonderbarkeit einer Leere, verstellt durch eine gelenkte und durchgestylte Ödnis, das Vorhandensein des rein Dargestellten in den medial überflutenden Welten.
Als wäre da etwas. Auch Interessen an Klima- und Migrationsfragen sind von einem Beigeschmack begleitet: Es schmeckt nach Pose bei so Vielen. Das Ich fehlt sich selbst und damit die Vereinbarkeit mit allem Leben, dem eigenen wie dem fremden, das uns immer wieder Engel senden will. In diesem Fehlen wohnt der Beginn eines unendlichen Vermissens, das den Weltkreis durchzieht.
„Wenn wir uns selber fehlen, fehlt uns alles“, schrieb Goethe im Werther. Es ist der richtige Jetztsatz, ein schöner Erkenntnissatz, ein wahrhaftes
Kyrie, die Aufruhr der verlorenen Zeit und ihrer umherirrenden Seele zu beschreiben.
„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält.“
Dieser Satz von Martin Luther aus seinem Katechismus hat eine wunderbare, herausrettende Kraft, die das Zusammentreten von Licht ermöglicht und eine unvordenkliche Freude, weil ein Ich wieder an sich glauben kann, vertraut es sich nur dieser Sinnlichtung an, fängt es nur an, sich neu zu denken aus dem Glück und sich so in Gottes Gefüge einzuordnen.
Nun so beabsichtigt, hätte die Sehnsucht ihr Ziel gefunden und die Suche wäre nicht umsonst gewesen. Sondern jener Weg, den die Gottesliebe sich wählt, zu ergänzen, was fehlt. Um einen Menschen zu finden.
Die Autorin ist evangelische Pfarrerin – freischaffend.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!