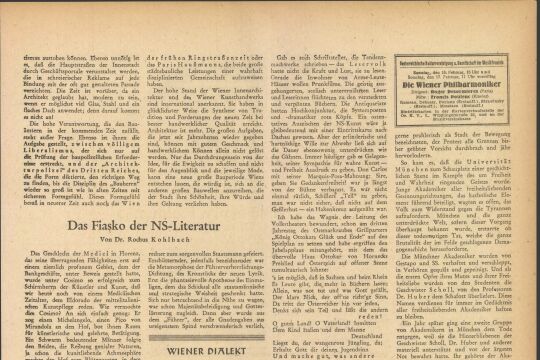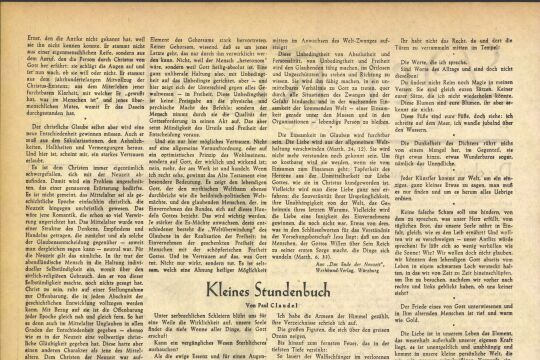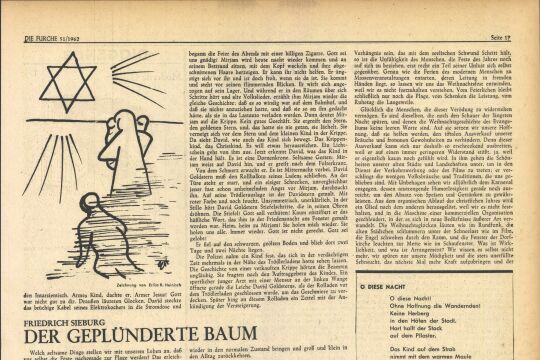Diese mehr als bekräftigte Erinnerung: Das Leben ist ein großes Geschenk. Ein Lichtblick, zumindest ein Hoffnungsschimmer im Dunkel der Welt.
Man mag dem Christentum im Laufe seiner zweitausend Jahre zu Recht vieles vorhalten und darauf hinweisen, dass es wohl kein Verbrechen gibt, dessen sich seither Christen nicht schuldig gemacht hätten. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist Weihnachten ein Lichtblick, „ein neuer tausendster Versuch“ (Hermann Hesse), ein Licht anzuzünden, statt über die Dunkelheit zu klagen, eine Einladung, sich eine Welt vorzustellen, in der es das Christentum nicht gegeben hätte. Weihnacht erinnert daran, dass Leben ein großes Geschenk ist, ein Lichtblick, zumindest ein Hoffnungsschimmer im Dunkel der Welt.
Die Freude am Licht bildet die tiefe menschheitsgeschichtliche Wurzel dieses Festes, dessen emotionale Kraft aber in einer überbeleuchteten Welt nicht mehr so unmittelbar wirkt wie früher. Meine persönliche Beziehung dazu hat wohl auch damit zu tun, dass meine frühesten Kindheitserinnerungen noch ohne elektrisches Licht ihr Auslangen finden. Die mit Kerzen und Petroleumlampen erhellte Bauernstube meines Elternhauses war ein verständlicherer Vorbote des Lichterbaumes als die lichtdurchfluteten „Häuser in der Stadt“, deren erleuchtete Fenster mich abends immer noch magisch anziehen, so als wären sie übers Jahr verstreute Weihnachtsbäume.
Ein Programm gegen die Dunkelheit
Das Weihnachtsfest ist ein Programm gegen die Dunkelheit am Wintersonnenwendepunkt, ab dem die Tage heller und die Nächte kürzer werden. In solchen archetypischen Erfahrungen wurzeln die klarsten Symbole und Feste der Menschheit. Sie wurden zu Grundmetaphern für menschliche Hoffnungen, und noch fast jede religiöse und politische Bewegung hat auf sie zurückgegriffen, wenn sie für ihre frohe Botschaft kräftige sprachliche Bilder suchte. So auch das Christentum, das sein Freudenfest von der Geburt des Friedenskönigs aus Nazareth auf den Termin des römischen Festes „Sol invictus“ legte. Statt der „unbesiegten Sonne“ wird nun das von der Finsternis nicht überwundene göttliche Licht des Christus, die „Sonne der Gerechtigkeit“ (Maleachi 4,2), besungen. Bis in die Adventlieder hinein klingen die damit verbundenen Hoffnungen in den Lichtbildern nach: „O komm, du wahres Licht der Welt, das alle Finsternis erhellt“, heißt es etwa in der zweiten Strophe von „O komm, o komm, Emmanuel“.
So verbreitet sich auch der Weihnachtsbaum im 19. Jahrhundert von Deutschland aus über die ganze Welt und beherrscht seither als sichtbarer Ruf nach dem Licht, als „Christbaum“, die Wohnzimmer, Kirchen und öffentlichen Plätze der christlichen Länder. Aber nicht nur die Weihnacht, auch das andere zentrale Fest der Christen, die Osternacht lebt vom Lichtsymbol, mit dem sich das mysterium hominis besser ausdrücken lässt als mit Feder und Zunge.
Die emotionale Kraft eines kleinen Lichtleins als entwaffnend klare Ansage gegen das Dunkel in der Welt ist in ihrer tiefen Symbolik leichter zu verstehen als theologische Überzeugungen und ihre sprachliche Begründung. In seiner tiefen Symbolik ist Licht an Einfachheit und Klarheit nicht zu übertreffen. Was uns überzeugt, sind in erster Linie nicht glasklare Argumente, sondern leuchtende Augen. Sie sind es, die berühren und in diesen Tagen als „Freudenboten“ zum Lebensmittel in unseren kleinen und großen Gemeinschaften werden. Denn die Freude am Licht ist wohl zutiefst auch eine Ursehnsucht danach, mit eigenen Augen sehen zu können und von anderen gesehen zu werden.
Sehnsucht, von anderen gesehen zu werden
In den täglichen Begegnungen „diagnostizieren“ wir sozusagen instinktiv, wie es um die emotionale Situation des anderen Menschen bestellt ist. Diese Wahrnehmung kann dazu führen, dass wir den Zustand des Anderen in uns selbst empfinden und traurig werden und uns in der Folge zurückziehen oder aber empathisch öffnen und es als Auftakt geglückter Begegnung verstehen. In jedem Fall fühlen wir uns angeschaut, erblickt, betroffen. Die neurobiologische Grundlage für dieses Phänomen hat in den letzten Jahren die Forschung gezeigt. Tritt ein Mensch in den eigenen Wahrnehmungshorizont, dann aktiviert er, ohne es zu beabsichtigen und unabhängig davon, ob wir es wollen oder nicht, eine neurobiologische Resonanz. Durch diese Beobachtungen ist auch leichter zu „verstehen“, was passiert, wenn uns jemand sieht, wenn wir uns beobachtet fühlen: Wir „nehmen uns zusammen“, wie wir sagen, urplötzlich, reflexartig, wir stehen unter Beobachtung und zeigen uns „von unserer besten“ Seite. Wenn uns aber jemand sieht und wir wissen, dass er uns sieht, dann hat das eine ganz erstaunliche Wirkung: Wir werden bessere Menschen. Unsere wichtigsten Anstrengungen vollziehen wir aus dem Grund, uns sehen lassen zu können, den anderen unter die Augen treten und zeigen zu können, wer wir sind. Dabei könnte das Licht der Weihnacht auch auf den Teil fallen, der als „Kind in uns“, das wir einmal waren, immer noch darauf wartet, wieder entdeckt zu werden.
„Wie ein Kind“ zu sein, das kennen wir in der Umgangssprache eher als Vorwurf denn als Kompliment, wenn wir damit sagen wollen, dass jemand eigentlich reifer sein müsste und erwachsener. Aber mit dem Erwachsensein ist das so eine Sache: Wir sind es selten und oft nur an der Oberfläche, wir spielen es, so wie das Kind auch Großsein spielt. Sobald wir aber aus der Tiefe leben, sobald uns etwas berührt, sind wir Kind: In Augenblicken tiefsten Leidens und höchster Freude wird das Gesicht, wie es früher war, die Stimme bekommt ihren unverwechselbaren Klang, das Herz klopft wie in der Kindheit, die Augen leuchten oder trüben sich.
Aber das alles suchen wir zu verstecken, und doch ist es ganz deutlich da; wir bemerken es nur nicht ohne Weiteres, weil wir die kleinen Zeichen, die so laut sind, an uns selbst nicht wahrhaben wollen und sie deshalb auch bei anderen übersehen.
Wir weinen nicht mehr, weil wir glauben, erwachsen sein zu müssen. Wir getrauen uns nicht einmal mehr aufrichtig zu lachen. Aber das hindert doch nicht, wenn wir etwas nicht können, wenn wir an Grenzen stoßen, dass wir da wie Kinder aussehen, denselben Ausdruck der Angst haben, den wir als Kinder hatten. Und unsere ganz persönlichen kleinen Gewohnheiten des Gehens, Liegens, Sprechens begleiten uns überall hin und sagen jedem, der es sehen will: Schau, das ist vom Kind noch übrig, das ich einmal war.
Das Interesse der Psychotherapie
Dieses Kind ist die Mitte des Neuen Testamentes, nicht nur, weil Gott selbst sich als Kind zeigt, auch, weil Jesus gerade dort davon spricht, wo Erwachsene darüber zu streiten beginnen, wer unter ihnen der Größte ist.
Für dieses Kind interessiert sich in besonderer Weise auch die Psychotherapie: Viele seelische Leidenszustände lassen sich im Grunde daraus erklären, dass das lebendige Kind, das ich einmal war, im erwachsenen Leben keinen Platz mehr hat. Die Unfähigkeit, Gefühle noch wahrnehmen zu können, ist zu einer genau beschreibbaren seelischen Krankheit geworden. Der Versuch, Gefühle zu zeigen, wird dabei von der „Kunst“, Gefühle zu verbergen, verdrängt. Und der nach Gefühlen hungrige Mensch verkriecht sich und getraut sich nicht, den Mund aufzutun und zu sagen, wo ihn der Schuh drückt. Und eh er sich’s versieht, ist er dann auch unfähig dazu und ein „Analphabet des Gefühls“ geworden.
Der wesentliche Unterschied zwischen Menschen besteht vielleicht darin: Ob sie kindisch werden, weil sie glauben, um jeden Preis erwachsen sein zu müssen, oder ob sie kindlich bleiben können, offen und neugierig, ob sie noch herzzerreißend weinen und sich unbändig freuen können.
Weihnachten ist ein schönes Fest, weil es nicht nur ein Fest des Lichtes, sondern zuallererst ein Fest der leuchtenden Augen ist, ein Fest für das Kind in jedem von uns. Wir sollten es nicht nur unseren Kindern bereiten.
* Der Autor ist Psychotherapeut und Seelsorger in Wien
Klang der Seele
Von Arnold Mettnitzer. Verlag Styria, Wien 2009, 200 Seiten,
geb., e 16,95
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!