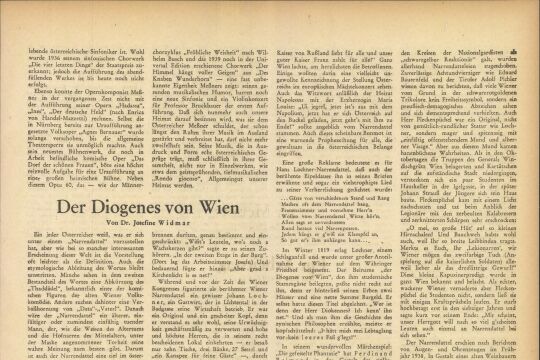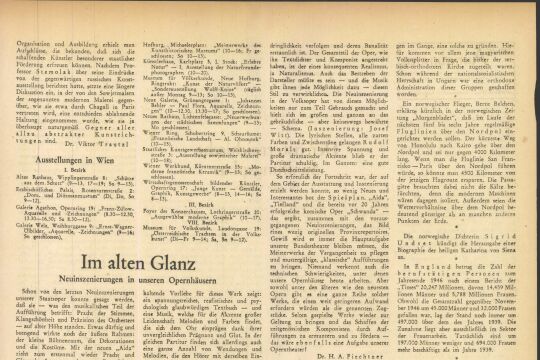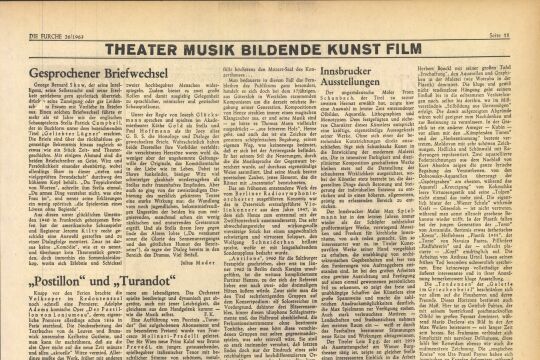Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Jungrer Lord wurde älter
Unter den Komponisten seiner Generation ist Hans Werner Henze nicht nur der talentierteste, sondern auch der vielseitigste und produktivste. Der 1926 geborene westfälische Lehrersohn betrat schon als 20jähriger die internationale Kunstszene, auf der er sich ohne Unterbrechung behauptet hat, und zwar immer dort, wo es am weltläufigsten und interessantesten zuging.
Unter den Komponisten seiner Generation ist Hans Werner Henze nicht nur der talentierteste, sondern auch der vielseitigste und produktivste. Der 1926 geborene westfälische Lehrersohn betrat schon als 20jähriger die internationale Kunstszene, auf der er sich ohne Unterbrechung behauptet hat, und zwar immer dort, wo es am weltläufigsten und interessantesten zuging.
Bereits mit seinem ersten Bühnenwerk „Das Wundertheater“ von 1949. machte er Aufsehen, mit der Manon-Lescaut-Oper „Boulevard Solitüde“ von 1952 wurde er berühmt. Es folgen in ununterbrochenem Schaffensfluß mehr als zwei Dutzend abendfüllende Bühnenwerke, ferner Orchester- und Kammermusikwerke, Chorkpmposi-tionen und Gesangszenen. Stilistisch hat sich Henze nie festgelegt. Das trug ihm den Rufeines Eklektizisten ein. In Wirklichkeit hat er zur Kompositionstechnik ein „dialektisches“ Verhältnis, er paßt Stil, Schreibweise und Besetzung jeweils dem Sujet, der vorgesehenen Form an.
„Der junge Lord“, als Auftragswerk der Deutschen Oper Berün geschrieben und 1964 dort uraufgeführt, ist in der Reihe von Henzes Opern die sechste und die erste „heitere“. Aber mit dieser Heiterkeit stimmt es nicht ganz. Zwar hatten sich der Komponist und Ingeborg Bachmann, die den Stoff fand, eine „komische Oper“ vorgenommen, aber es wurde dann doch etwas anderes daraus. Die Parabel des frühverstorbenen deutschen Romantikers Wilhelm Hauff berichtet von einem alten, sehr reichen englischen Privatgelehrten, der sich in einer deutschen Kleinstadt niederläßt, dort mit großem Enthusiasmus, mit Aufmarsch der Honoratioren, Kinderchor und Blasmusik empfangen wird, der aber seinerseits keinerlei Kontakte mit der neuen Umgebung aufnimmt. Das erzeugt Mißtrauen und Haß, besonders nachdem Sir Edgar eine Zirkustruppe, der man den Aufenthalt verweigern will, in sein palastartiges Haus einlädt.
Um die geseUschaftlichen Vorurteile der Bürger ad absurdum zu führen, läßt Sir Edgar einen von den Zirkusleuten gekauften Affen dressieren, indem diesem nicht nur „feine Manieren“, sondern auch einige Sprachflos-keln beigebracht werden. Auch weiß sich Lord Barrat, der Neffe Sir Edgars, so zu benehmen, daß er nicht nur ak-
zeptiert, sondern von der jeunesse dor6 auch nachgeahmt wird. Bis am Ende der falsche Lord sich entpuppt - und als brauner Affe unter den entsetzten Blicken der Bürger von Hülsdorf-Gotha den Festsaal des Residenzkasinos verläßt, wo er zum Schluß eine Tanzorgie entfesselt hat.
Gustav Rudolf Seilner hat das zwei-aktige Stück mit seinen sechs Szenen inszeniert, Federico Pallavicini hat es mit aparten, überdurchschnittlich ori-gineUen Bühnenbildern ausgestattet und Horst Stein die eminent schwierige Partitur realisiert. Von der ersten Szene an ist für Abwechslung und groteske Unterhaltung gesorgt. Heinz Zednik als Titelheld war durchaus glaubwürdig in dieser nicht alltäglichen RoUe. Von den Honoratioren seien nur genannt: Kurt Rydl als Bürgermeister, Hans Helm - Oberjustizrat Hasentreffer, Gottfried Hornik - ökonomierat Scharf, Murray Dickie - Professor von Mucker. Ferner die Damen Margarete Bence, Gertrude Jahn,
Wilma Lipp, Lucy Peacock. Im Gefolge von Sir Edgar, den (eine stumme Rolle) Andre Mattoni darstellt, finden sich: Barry McCaniel in der wichtigen Rolle des Sekretärs sowie Debria Brown als Begonia, die farbige Köchin aus Ja-maica, eine bühnenfüllende Erscheinung.
Nicht immer machen Wiedersehen und Wiederhören Freude. 1965 in Berlin war eine heitere Oper - und noch dazu von Henze - eine so erfreuliche Erscheinung, daß ihr, sozusagen ante festum, alle Sympathie entgegenströmte. Man empfand damals dieses Werk Henzes als sein bestes, nicht zuletzt deswegen, weil er sich als Musiker, dessen Kompositionen unter einem gewissen Amorphismus litten, hier schärferen Konturen, klarerer Gliederung in Nummern, sogar faßbarer Melodien und tänzerischer Rhythmen bediente. Daß hiebei oft Stra-winsky Pate gestanden hat - wer wollte einem jungen Musiker, der in der ersten Nachkriegszeit herangewachsen ist, solches übelnehmen? Zumal Henzes Musik, damals vor 13 Jahren, „neu“ war. Aber das ist sie heute nicht mehr so ganz. Auch kam uns „Der junge Lord“ einst kurzweiliger, vor allem kürzer, vor, und daß man damals etwa doppelt soviel Text verstand wie jetzt in der Wiener Staatsoper. Übrigens war der Regisseur in Berlin und in Wien derselbe.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!