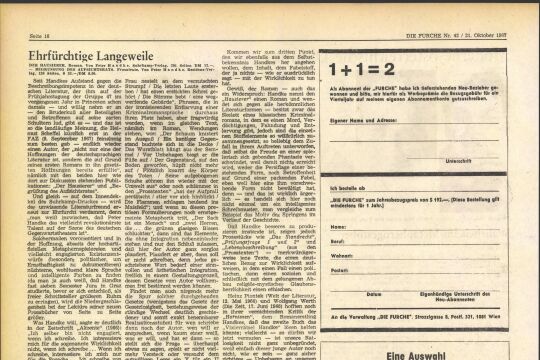Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ohne Spiegel
Es gibt keine künstlerische Arbeit, die nicht an den Künstler denken ließe. Selbst wenn es ihm gelänge, sich unkenntlich zu machen, seine Fingerabdrücke sind bekannt. Aber auch jemand, der als Künstler nur ein Nachahmer ist, kann durch die Art und Weise seiner Nachahmung identifiziert werden. Umgekehrt, wer es darauf anlegt, sich selbst so deutlich wie möglich darzustellen, muß nicht auf Anhieb erkannt werden. Mancher von denen, die sein Bild betrachten, wind sagen: Das ist er nicht. Er macht sich von sich selbst ein falsches Bild. — Das Problem hat also mindestens zwei Aspekte: die willkürliche und die unwillkürliche Darstellung der Individualität.
Maler und Zeichner brauchen nur in den Spiegel zu schauen, wenn sie sich porträtieren wollen. Das Selbstbildnis gehört bei ihnen gewissermaßen zum Handwerk. Schriftsteller müssen sich den Spiegel imaginieren. Entwirft ein Autor sein Bild, nimmt man es weniger unbefangen hin. Leicht drängt sich das Wort Eitelkeit auf die Zunge; schlimmstenfalls heißt es: der Exhibitionist! Über die Eitelkeit ließe sich lange meditieren. Bis zu einem gewissen Grad ist sie unabhängig von demjenigen, dem wir sie vorhalten, vielmehr Ausdruck unseres persönlichen Mißwollens. Ich meine: Wir finden jemanden eitel, weil wir für die Art nichts übrig haben, in der er über sich schreibt. Ein anderer, der uns sympathisch ist, kann seine Verdienste’ nach Strich und Faden herausstreichen, es macht uns nichts aus. Der Charme der Eitelkeit. Offenbar nicht zu erlernen. Für diesen ein Talent, sein Charisma überstrahlt alles; jener mag anstellen, was er will, in der Nonchalance der Eitelkeit bleibt er ein Stümper. Natürlich gibt es ein pfauenhaftes Aufplustern, das allen widerlich ist, unabhängig von unserem Miß- oder Wohlwollen; darüber kein weiteres Wort. Anderseits können uns manchmal Bescheidenheit und Understatement nicht weniger penetrant eitel erscheinen. Stolz freilich, der nicht auf Selbstüberschätzung ruht, hat nichts Unwürdiges.
Einmal abgesehen von den Verfassern der Autobiographien und Memoiren, kein Autor wird sich hinsetzen und über sich schreiben, ohne daß ihn jemand dazu aufgefordert hätte. Selbstzeugnisse geringeren Umfangs sind Auftragsaťbeiten. Verleger, Redakteure, Interviewer wollen wissen, wie sich der Autor selbst sieht, damit die Leserschaft, die offenbar an seiner Person interessiert ist, aus erster Hand informiert werden kann. Im Gegensatz zum Künstler nutzt der Schriftsteller die Gelegenheit zum Selbstzeugnis nicht, um sich als Gegenstand für etwas möglichst Kunstvolles heranzuziehen, sich auf neue, unerhörte Weise auszudrücken. Dem Autor kommt es weniger auf Formulierungen als auf Mitteilungen an. Er möchte Rechenschaft ablegen, nicht von den Spuren in seinem Gesicht, sondern von denen seiner Arbeit.
Viel hängt vom Augenblick der Niederschrift ab. Ist es einer, in dem man einigermaßen mit sich selbst im reinen und zur Mitteilung aufgelegt ist, oder steht man sich gerade zu diesem Zeitpunkt selbst im Wege, hadernd mit seiner Arbeit, so daß die Feder über Einsilbigkeiten nicht hinaus will? Äußert sich der Autor in einer Phase der Anerkennung oder in einer, in der er sich mißverstanden fühlt, verteidigen zu müssen glaubt? Das alles färbt ab. Und die Farben können sich natürlich von Zeit zu Zeit verändern. Einmal ist sein Selbstbewußtsein nicht echt, in diesem Moment der einzige Schutz für ihn, der in der Luft hängt; ein andermal ist es nicht vorgeschützt, sondern Zeichen der Souveränität, eines Schöpfens aus dem Vollen. Was schließlich beim Selbstbildnis des Künstlers weniger in Erscheinung tritt, das ist der „Hintergrund“. Beim Autor sind Vorder- und Hintergrund eins: er sieht sich verstrickt in seine Zeitgeschichte, ihre Idfeen, Moden, Forderungen, er kann sich nur im Reagieren auf die Welt, in der er lebt, verstehen.
Und noch auf einen letzten Unterschied will ich hinaus. Maler können ihre vollkommenen Mittel, ihre noch zu wenig ausgebildeten Kräfte bemängeln, wenn sie weit zurückliegende Fixierungen ihrer Blicke in dem Spiegel betrachten. An diesem Knochengerüst aber, an Augen, Haut und Haaren ist nicht zu deuteln. Schriftsteller dagegen, in alten Selbsterzeugnissen lesend, müssen sich fragen, ob sie damals wirklich das Bezeichnende ihrer Existenz erfaßt, sich nicht an Lappalien gehalten haben. Denn immer müssen sie aus einem Wust von Einzelheiten jene auswählen, die die Person und ihre Arbeit so andeuten, daß sich ein Umriß von einiger Glaubwürdigkeit ergibt. Ja darauf läuft es hinaus: dem Künstler glaubt man, was man sieht; beim Schriftsteller aber „sieht“ man nur, was man glaubt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!