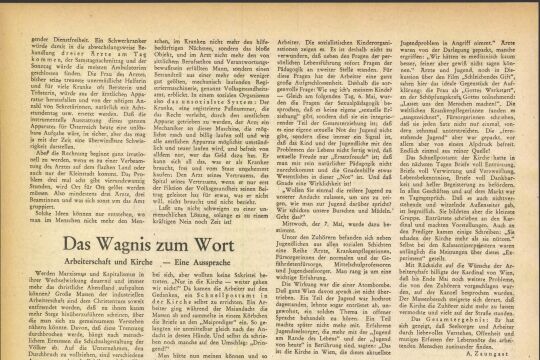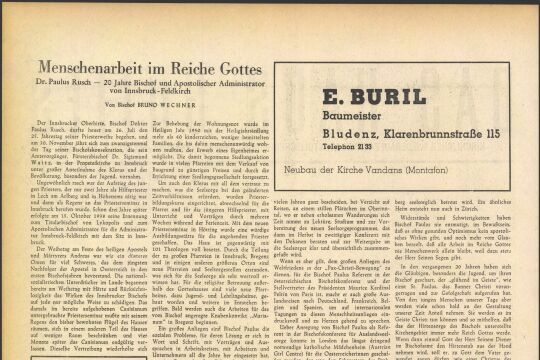Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
PRIESTERAUSBILDUNG EINST UND JETZT
Es war einmal - vor einigen Jahrzehnten - da trugen die „Alumnen” des Seminars, in dem ich selber ausgebildet wurde, rote Talare. Sie verbrachten sieben Jahre in Rom, um sich an einer päpstlichen Universität ausbilden zu lassen, und sie durften in diesen sieben Jahren nie nach Hause fahren. Dafür wanderten sie den Sommer hindurch in Latium herum, waren mancherorts gern gesehen als Diskussionspartner und Segensbringer, als Fußballer oder als gelehrte Herren.
So etwas schmiedet zusammen. Und es grenzt aus. Denn schon ein rotgekleideter Herr fällt auf. Aber ausgehen durfte man nur zu siebt, später auch zu dritt. Und wenn einer den Führerschein machte und gerade mit dem Auto eine Fahrstunde absolvierte, dann saßen eben sechs andere derweil in der Fahrschule.
Vertrauen oder Kontrolle?
Heute hängen die Talare eher im Kasten, und das Kardinalsrot dürfen die jetzigen Priesteramtskandidaten auch in Rom nicht mehr tragen. Viel Ausgrenzung fällt damit weg, viel Auffälligkeit und Eindeutigkeit. Und zumindest in unseren Breiten hat jeder Seminarist seinen Hausschlüssel und kann allein oder in Begleitung - in selbstgewählter Begleitung - in Freiheit kommen und gehen.
Das war nicht immer so. Denn vor wenigen Jahrzehnten noch gab es „gesteckte Ausgänge”: Der Leiter eines Seminars bestimmte mittels kleiner Täfelchen und hölzerner „Stecker”, wer mit wem eine Runde zu drehen hatte. Das war vorbeugend gegen Freunderlwirtschaft - Partikularfreundschaften nannte man zu persönliche enge Beziehungen, und sie waren nicht gewünscht.
Noch erinnern in „meinem” Seminar kleine Tischchen an die „Schwellenregel”, die ein anderes Mittel gegen solche Intimitäten darstellte: Das Tischchen paßt genau in die Türe des Zimmers. Und wenn damals ein Seminarist den anderen besuchte, wurde dieses Tischchen in die Türe gestellt, der Gast saß draußen im Gang, der Besuchte drin im Zimmer. Und im Gang patroullierte der Studienpräfekt oder sonst eine Aufsichtsperson. Die Tischchen dienen inzwischen als Schreibmaschinentische, und so mancher Leiter eines Seminars ist froh, wenn Schwellen überschritten werden, Gruppen sich bilden und Gemeinschaften einen guten Rahmen für innerliche und tiefe menschliche Begegnungen darstellen.
Kontrolle war ein wesentliches Element der Erziehung, und sie erstreckte sich auf viele Bereiche des Lebens. Die Prüfungsergebnisse der Universität gingen durch die Hände des Studienpräfekten, ehe sie - gege-benenfalls mit entsprechendem Kommentar - in die Hände des Priesteramtskandidaten gelangten. Vertrauen ist heute ein wesentliches Element in der Priesterausbildung, und dieses Vertrauen mutet manchem jungen Menschen viel zu.
Was damals wie heute das Denken der Hausleitung eines Seminars bestimmt(e), waren Wohlwollen und Respekt gegenüber den jungen Menschen, die sich dem Anruf Gottes stellen, und das Bedürfnis, dieser Berufung möglichst zur Entfaltung zu verhelfen. Was der heutige Papst als die vier Säulen der Priesterausbildung bezeichnet, war im Grunde immer ihr Fundament: die Förderung gesunder, froher und gereifter Menschlichkeit, das Erarbeiten einer tragenden Christusbeziehung und einer realitätsbezogenen Frömmigkeit, das Mühen um Glaubenseinsicht durch wissenschaftliche Ausbildung und schließlich die Aneignung des seelsorglichen Handwerkszeuges, der pastoralen Eignung.
Was das konkret bedeutet und wie das konkret geschieht, dafür hat und hatte jede Epoche eigene Antworten. Denn das hängt schließlich von der Rolle des Priesters und vom Priesterbild ab, das in Kirche und Gesellschaft herrscht. Lange gab es keine eigenen Schulen für Priester, nur das Mönchtum und die Katechetenschulen wären zu nennen. Einzelne Bischöfe - so Augustinus - lebten eine Art Klostergemeinschaft mit ihren Priestern. Eigentumslos und keusch, in Armut und Gehorsam, Abtötung in Nahrung, Kleidung und Lager sollten die Priester leben, vor allem aber sollten sie sich in Wissenschaft und Handarbeit ausbilden.
Später entwickelte sich diese Form von Lebensgemeinschaft zu den mittelalterlichen Domschulen. Eine neue Entwicklung stellten die Universitäten dar. Da wie dort wurde das Vater Unser gelehrt, das Glaubensbekenntnis, das Benedicite, die Bußpsalmen, das Schreiben. Die Einübung in ein geistliches Leben war nicht automatisch gewährleistet, ebensowenig eine praktische Ausbildung für die Seelsorge.
Der Bildungsstand des Klerus war oft niedrig, die Sitten schlecht, und es waren die Jesuiten, die durch Kollegien Abhilfe zu schaffen versuchten. Nur sie bildeten zunächst den Weltklerus aus, erst nach dem Konzil von Trient wurden die Seminare in der heute noch gültigen Form eingeführt, und erst allmählich bildete der Weltklerus selbst den eigenen Nachwuchs aus. Eine strenge Lebensordnung und ein genau umrissenes Priesterbild gaben einen Rahmen vor, an dem man sich leicht orientieren, nach dem man sich ausrichten konnte.
Vielfalt des Dienstes
Von dieser Eindeutigkeit des Priesterbildes oder der Rolle des Klerus ist bei uns heute nicht mehr die Rede. Es gibt eine Vielfalt des priesterlichen Dienstes und die Auflösung vieler traditioneller Vorgaben und Normen, Erwartungen und Berufsbilder. Der gesellschaftliche und kirchliche Wandel, der Übergang von einer Volkskirche zu einer noch nicht klaren, vor uns liegenden, jedenfalls anderen Form der Kirche und der Zahlenrückgang lassen Prognosen riskant werden.
Ein Allrounder, derüberall versiert, deshalb austauschbar und überall einsetzbar ist, kann im besten Seminar nicht „produziert” werden. So bleiben überzeugende Menschlichkeit, menschliche Frömmigkeit, gediegenes Studium und seelsorgliche Fähigkeiten. Liebe zu Christus und zu den Menschen sind die Voraussetzungen, und Wagemut und der Mut zum Außergewöhnlichen. Denn nie war Priesterausbildung die Ausbildung zu Durchschnittlichkeit und Berechenbarkeit.
Der Autor ist Regens des Innsbrucker Priesterseminars.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!