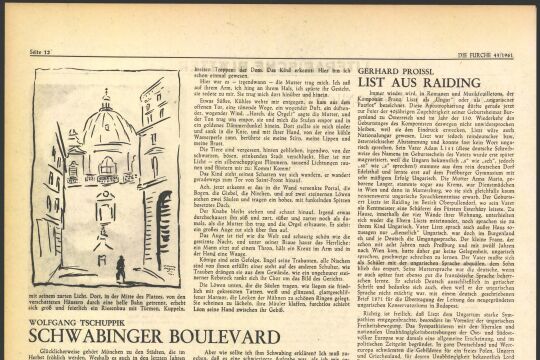Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Unfug mit Goethe
„Iphigenie“ stand auf dem Programm des „Theaters am Turm“ in Frankfurt am Main, geleitet von dem vielversprechenden Regisseur und Autor Rainer Werner Faßbinder, der zumindest durch einige interessante Fernsehspiele auf sich aufmerksam gemacht hat. Auf dem Theater war er nicht ganz so erfolgreich.
Nicht ahnend, daß es sich um eine Premiere handelte, ging ich an die Kasse. Dort sagte man mir, ich könne noch jede Karte haben. Auf die Frage nach der Länge der Vorstellung erhielt ich die Antwort, sie dauere etwa eine Stunde. Und: „Das Stück ist ja eigentlich nicht von Goethe, sondern von Faßbinder.“ — Es handelte sich also um eine Uraufführung, in die ich sozusagen durch Zufall gelangt war. Eigentlich hatte ich doch Goethe sehen wollen.
Das Stück — wenn man es so nennen kann: eine modern gekleidete Dame erscheint und liest gelangweilt von einem Blatt Papier einige Verse aus Goethes „Iphigenie“, so leise und so ohne Betonung, daß man kaum etwas versteht. Dazu klimpert irgend jemand — es ist die Souffleuse, wie sich später herausstellt — auf dem Klavier. Dann begibt sich besagte Dame, die ja die Iphigenie ist, in eine Hollywood-Schaukel. Ein Mann, der auf dem Programm als Arkas fungiert, aber kein ( Wort spricht, tobt sich an einem narmo-niumähnlichen Instrument aus.
Es erscheint ein modisch gekleideter junger Mann, von dem wir erfahren, daß er König Thoas ist, und verschließt die Hollywood-Schaukel, damit unterstreichend, daß Tauris — die Hollywood-Schaukel nämlich — nicht nur eine Insel ist, sondern auch ein Gefängnis, und daß er der Gefängnishüter ist und sich überhaupt austoben kann, wie er will. — Übrigens spricht er fast immer nur durch ein Mikrophon, das an einem langen Schlauch hängt. Das tut auch Iphigenie, man glaubt, sich in einem Nachtlokal — pardon, Night Club — zu befinden. Es wird sehr viel Englisch geredet und gesungen. Man frage nicht, warum. — Das darf man überhaupt bei diesem Stück nicht fragen.
Es werden dann zwei junge Männer auf die Bühne gerollt, von denen sich herausstellt, daß der eine Orest, der andere Pylades ist. Beide sind entzückt, sich auf einer so einsamen Insel zu befinden, und machen klar, daß diese Einsamkeit gewissermaßen eine Einladung zum Tanz ist. Jawohl, sie sind homosexuell. Sie führen zwar nicht aus, was sie im Sinn haben, doch beinahe. — Auch Thoas scheint ähnliche Neigungen zu 'verspüren, denn er tanzt mit beiden. Man frage nicht, warum. Man frage bei diesem Stück überhaupt nicht. Es sei denn, warum es geschrieben worden ist. Wurde es tatsächlich geschrieben? Laut Programmzettel zum 225. Geburtstag von Goethe.
Das ist eigentlich alles.
Irgendwann bekommt Orest noch einen Ausbruch, weil er Iphigenie mit Klytemnästra verwechselt, obwohl ihn das übrige Ensemble dahin beruhigt, es handle sich um „Ifi“ und nicht um „Klyti“. Nach einer Weile ist dann alles aus. Das heißt, Thoas und die anderen befreien Iphigenie aus ihrem Käfig, was gar nicht so einfach ist — aber das war wohl nicht geplant, hier handelt es sich wohl um ein technisches Mißgeschick. Dann gehen alle ab. Und dann klatschen einige Leute, und auf diese Weise merkt man, daß die Geschichte zu Ende ist.
Ein Gutes ist zu vermelden: der Unfug dauert nicht einmal eine Stunde, er dauert nur fünfundvierzig Minuten. — Beim Hinausgehen fragte mich ein anderer beklagenswerter Zuschauer, ob ich ein Streichholz bei mir hätte. Ich antwortete: „Nein, sonst hätte ich das Theater längst angezündet.“ — Aber warum der Frankfurter Feuerwehr Arbeit machen, die Faßbinder ganz automatisch verrichtet?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!