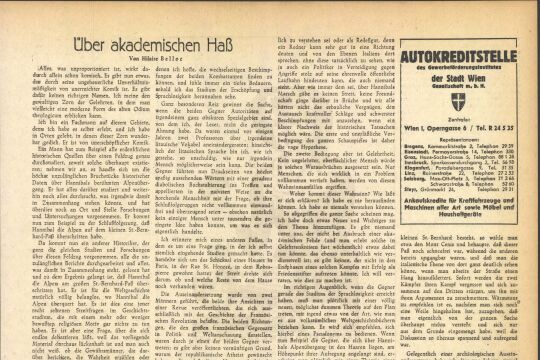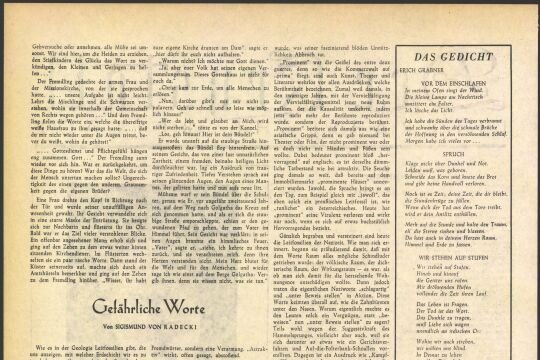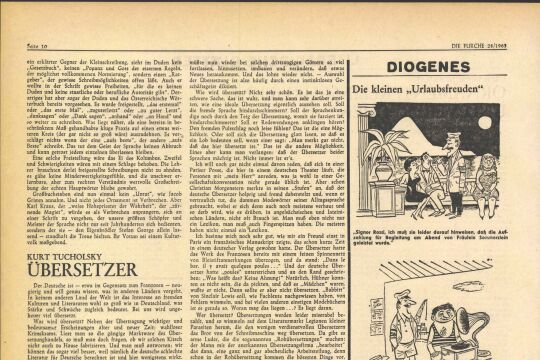Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Unglück mit Worten
Ungefragt, jedoch in der besten Absicht, teilen mir freundliche Leser gelegentlich mit. daß sie meine Bücher oder meine sonstigen Veröffentlichungen besonders deshalb schätzen, weil ich „ein so gutes Deutsch” schreibe. Sie wollen mir damit zweifellos ein Kompliment machen und verstehen nicht, warum ich es beinahe als Beleidigung empfinde. Denn ich stamme noch aus einer Zeit, in der es als unerläßliche Voraussetzung für das Ergreifen des Schriftstellerberufes galt, gutes Deutsch zu schreiben. Die Sprache ist mein Handwerkszeug, und mit seinem Handwerkszeug muß man umzugehen wissen.
Ich habe den Umgang mit der Sprache von ihrem großen Meister Karl Kraus gelernt, mit dem ich einige Jahre lang noch in persönlichem Kontakt stand, und ich möchte meinen Lehrer nicht enttäuschen. Ich möchte keineein-zige Zeile geschrieben haben, an der er vielleicht Anstoß nehmen könnte.
Mephistopheles hat etwas anderes gemeint, als er der Forderung des Schülers: „Doch ein Begriff muß bei dem Worte sein!” mit jenem trostreichen Zitat begegnete. Das Wort stellt sich zur rechten Zeit ein, um das Fehlen des Begriffs zu verschleiern, um Inhalt und Gedankentiefe zu prätendieren, wo nichts dergleichen vorliegt. „Mit Worten läßt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten”, verdeutlicht Mephistopheles sogleich. Er meint die Aufhebung der Interrelation zwischen Wort und Begriff, die Verselbständigung des Wortes zu bestimmten unlauteren Zwecken. Er zielt auf einen -wenngleich hämisch pervertierten -Denkprozeß ab.
„Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen”, sagt er wenig später in der Hexenküche. Auf jeden Fall mußte damals noch gedacht werden.
Nicht so heute. Das Unglück mit den Worten, die sich heute zur rechten Zeit einstellen, liegt nicht im Fehlen des dazugehörigen Begriffs, sondern in dessen Sinnentleerung, in'der von Phrasen und Klischees ruinierten Vorstellungskraft der Wortproduzenten und ihrer Kundschaft. Dieser nachgerade organische Defekt, in schönem Gleichmaß auf beide Gruppen verteilt, tritt selbst dort zutage, wo Sinn und Wort in Beziehung zueinander gebracht werden. Wenn es .von einer infolge Regens abgesagter Freilichtveranstaltung heißt - und weiß Gott, das heißt es -, sie sei „im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen”, merkt niemand mehr, weder der Schreiber noch der Leser, daß die Veranstaltung nicht ins Wasser gefallen, sondern das Wasser auf sie, und daß es mangels Steigerungsfähigkeit der Wahrheit keinen wahrsten Sinn eines Wortes gibt, sondern allenfalls einen wahren, den man allerdings besser als „ursprünglichen” bezeichnen würde, schon um jegliches Forschen nach einem unwahren Sinn hinzuhalten.
In einer niederösterreichischen Provinzstadt wurde vor kurzem der Spenglermeister Josef Gschweidl (Name von der Redaktion geändert) wegen Mißhandlung seiner Ehefrau verhaftet. Nachbarn hatten ihn angezeigt und ihn unter anderem beschuldigt, der bereits zu Boden geschlagenen Frau mehrere Fußtritte versetzt zu haben. Es erwies sich jedoch, daß diese Angaben stark übertrieben waren und daß seine Verfehlungen für einen Haftbefehl nicht ausreichten. „Josef Gschweidl”, so formulierte es die diesbezügliche Zeitungsmeldung, „befinde sich wieder auf freiem Fuß.” Von dem er jetzt wieder Gebrauch machen kann.
Das Partikelchen „wie” ist - zumal in der Lyrik - ein zuverlässiger Beweis von Dilettantismus. Der Liebende, der uns mitteilt, er sei vom Anblick der Geliebten „wie verzaubert”, setzt sich eben dadurch dem dringenden Verdacht aus, daß er keiner Verzauberung anheimgefallen ist, weil ihm der Mut dazu, fehlt. Er hat Angst. Vielleicht lähmt sie ihn sogar. In diesem Fall wäre er voraussichtlich „wie gelähmt”, weil es auch zur Lähmung bei ihm nicht reicht. Er hält sie für die medizinische Diagnose eines physischen Zustands statt für die gleichnishafte eines psychischen; und erschlägt das Gleichnis, indem er es durch das „wie” ausdrücklich als solches deklariert.
Am ärgerlichsten wird die Sache mit dem „wie”, wenn ein drei Jahre altes Kleinkind aufs Fensterbrett steigt, das Gleichgewicht verliert, in die Tiefe stürzt und „wie durch ein Wunder” unverletzt bleibt. Wieso „wie”? Entweder glaubt der Berichterstatter an ein Wunder, dann ist das Kind durch ein Wunder gerettet worden, Punkt. Oder er hält es für unzulässig, an Wunder zu glauben, dann darf er auch keine Anleihen bei ihnen machen.
Die Primitivität mancher Schnörkel steht in engem Zusammenhang mit einem primitiven Bildungsmangel, der sich an vermeintlichen Bildungsmerkmalen hochzuranken versucht. Der geniale Dramatiker ödön von Horvath hat dieses Möchtegern-Niveau mit unheimlicher Meisterschaft dialogisch getroffen und entlarvt. Einen Irrtum begangen zu haben ist seinen Figuren zu wenig - es muß ein „krasser” Irrtum sein; und wenn sie zu einer einmal gefaßten Meinung stehen, dann immer „voll und ganz”, anders tun sie's nicht.
Das Bestreben, Abgedroschenes durch eine anspruchsvolle Verpackung aufzuwerten, wirkt sich besonders verheerend bei Fiemdwörtern aus, die ja überhaupt - man weiß es - Glückssache sind. Da der Schauplatz eines Banküberfalls von der Polizei abgesperrt wird, genügt nicht. Er wird unter allen Umständen „hermetisch abgesperrt”, und manchmal muß dieses vornehme Fremdwort auch für einen Flughafen herhalten. Bekanntlich - oder genauer: nicht bekanntlich - heißt „hermetisch” soviel wie „luftdicht”.
Anderseits treibt auch die von einer mißverstandenen Deutschtümelei geschürte Abneigung gegen Fremdwörter oder fremdwortartige Endungen sonderbare Blüten und macht nicht einmal vor Eigennamen halt. Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen weiß davon ein bitteres Lied zu singen. In der Schweiz, deren Bevölkerung sich dank ihrer Mehrsprachigkeit ein gewisses Gefühl der linguistischen Formen und Manieren bewahrt hat, werden die Autos - im Hinblick auf den französischen Ursprung des Wortes - „parkiert”. Bei uns werden sie „geparkt”.
Nun, das mag alles noch hingehen. Aber wie kommt der Entdecker der Röntgenstrahlen dazu, daß man seinen Namen, nur um ja nicht „röntgenisie-ren” sagen zu müssen, als Verbum behandelt und daß, wer sich von seinen Strahlen behandeln läßt, „geröntgt” wird ein Wortmonstrum, das schon infolge zungenbrecherischer Unaussprechbarkeit abgeschafft werden müßte; ode man müßte jedem, der es verwendet, nahelegen, sich statt röntgen lieber galvanen zu lassen.
Denn über kurz oder lang wird der heutige Mensch von Sprichwörtern nicht mehr geduzt werden wollen, und zwar deshalb nicht, weil er keine Beziehung zu ihnen hat, weil er von ihrer Bildkraft und ihrer Herkunft nichts mehr weiß. Wie sollte er auch. Da er den Schuster nur noch aus Erzählungen seines Großvaters kennt und den Begriff des Leistens nur im Zusammenhang mit Leistungsdruck, weiß er mit dem an den Schuster gerichteten Ratschlag, bei seinen Leisten zu bleiben, nichts anzufangen, und was es bedeuten soll, daß neue Besen gut kehren, wird man ihm bestenfalls gelegentlich der Anschaffung eines neuen Staubsaugers erklären können, welcher gut saugt. Ihn sticht kein Hafer, ihm sondert sich keine Spreu vom Weizen, ihm gilt es mangels dörflichen Lebens völlig gleich, ob sich's um böhmische, spartische oder potemkinsche Dörfer handelt. Und wenn er sich einmal wie durch ein Wunder auf einem hermetisch abgesperrten Flughafen davon überzeugen kann, daß im wahrsten Sinne des Wortes ein roter Teppich gerollt wird, weht ihn von fernher, noch ein Hauch vermoderter Sprachsubstanz an.
Diesen Beitrag hat Friedrich Torber im vergangenen Jahr für die „Deutsche Welle”, Köln, verfaul. Er ist soeben im Sammelband „Mehr als Worte”, Econ-Verlag, Düsseldorf-Wien, erschienen
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!