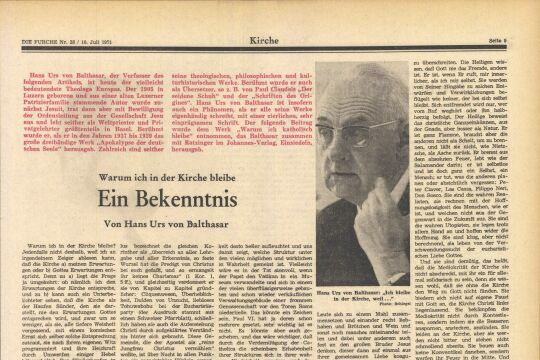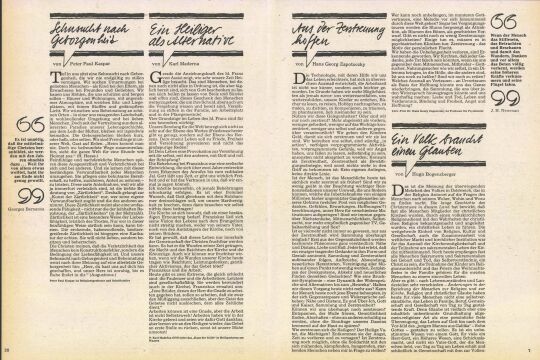Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zeichen Gottes in der Zeit
„Einfach anders leben“, lautet die Parole. Der Auf ruf zum Umdenken ertönt immer lauter. Zwei Prominente des deutschen Katholizismus haben sie aufgegriffen: Der Präsident der Universität München, Prof. Nikolaus Lobkowicz, vor der Katholischen Medienakademie in Wiener Neu- • Stadt, der Fundamentaltheologe Prof. Johann B. Metz aus Münster vor dem Deutschen Katholikentag in Freiburg - mit sehr verschiedenen Ergebnissen. Wir stellen die Auszüge aus ihren Referaten zur Diskussion.
„Einfach anders leben“, lautet die Parole. Der Auf ruf zum Umdenken ertönt immer lauter. Zwei Prominente des deutschen Katholizismus haben sie aufgegriffen: Der Präsident der Universität München, Prof. Nikolaus Lobkowicz, vor der Katholischen Medienakademie in Wiener Neu- • Stadt, der Fundamentaltheologe Prof. Johann B. Metz aus Münster vor dem Deutschen Katholikentag in Freiburg - mit sehr verschiedenen Ergebnissen. Wir stellen die Auszüge aus ihren Referaten zur Diskussion.
Aus einer Reihe schwer einsichtiger Gründe sind viele Christen in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts der Meinung, die Nachfolge Christi müsse ganz anders aussehen, als man bislang meinte. Noch das Zweite Vatikanum hält klar und unmißverständlich an der Vorstellung fest, die Nachfolge Christi bestehe für alle, „mögen sie zur Hierarchie gehören oder von ihr geleitet werden“, im Streben nach Heiligung. Wenn man dagegen die Mentalität so mancher heutiger Durchschnittskatholiken, auch praktizierender, betrachtet, kann man sich zuweilen nicht des Eindruckes erwehren, sie sähen die Nachfolge Christi vor allem darin, jeweils vom anderen zu fordern, er möge sich ändern, die Tugend der Demut durch die Unsitte des Protestes zu ersetzen und das Heil nicht in einer persönlichen Heiligung, sondern in der sozio-politischen Reorganisation zu suchen. Die Nachfolge Christi scheint nicht mehr darin zu bestehen, das einem jeweils aufer-
„Fragwürdig scheint mir die Verweltlichung der Ziele großer Teile des Gottesvolks“ legte Kreuz mit „Erbarmen, Güte, Demut, Müde, Geduld“ (Kol. 3,12) zu tragen, sondern unentwegt nach Reformen vor allem in denjenigen Teilen der Welt zu rufen, die man nie gesehen und sich nie die Mühe genommen hat, zu verstehen.
Hier wird ein Problem deutlich, mit dem wir Christen noch nicht recht ins Reine gekommen sind.
Der Begriff von Welt hat sich verschoben. Die christliche Tradition hat zur Deutung dessen, was Welt ist, vor allem jene Texte des Neuen Testamentes herangezogen, in denen die Welt als der Bereich des Lasters, der Sünde, der Gottesfeindschaft beschrieben wird. Freundschaft mit der Welt sei Feindschaft gegen Gott, die wahre Frömmigkeit bestehe darin, sich von dieser Welt unbefleckt zu bewahren (Jak. 4, 4; 1, 27).
Weltflucht oder doch die Flucht vor dem Verderbnis der Begierde, die die Welt beherrscht (2. Petr. 1, 4), schien deswegen die entscheidende Voraussetzung christlicher Existenz zu sein.
Nachdem schon die Erneuerung der thomistischen Tradition demgegenüber jene Texte hervorgehoben hatte, in denen mit ,Welt' vor allem die Schöpfung Gottes und damit das Positive des Natürlichen bezeichnet wird, hat das Konzil jene Abschnitte in den Vordergrund gerückt, welche die Welt als den Bereich beschreiben, den Gott bis zur Selbsterniedrigung in Christus liebt (Joh. 3, 16), und in dem wir Christen „wie Leuchtkörper im Weltall“ strahlen sollen (Phil 12, 15). , ;
Diese Akzentverschiebung ist durchaus legitim; schließlich war es eines der zentralen Anliegen des Konzüs, nicht bloß zu den Christen zu sprechen, sondern „an die ganze Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit an Wirklichkeiten, in denen sie lebt“ (Kirche u. Welt, 2), zu denken. Aber im Gefolge dieser Akzentverschiebung ist es zu einer Entwicklung gekommen, die bisher im Detail noch kaum analysiert worden ist und die wir jedenfalls häufig viel zu wenig sehen. Während das Konzil kein anderes Ziel hatte, als aus der Isolierung auszubrechen, in welche die Kirche seit dem 19. Jahrhundert geraten war, wurde das „aggiornamento“ von manchen als Aufforderung verstanden, möglichst viele moderne Trends und Ideologien in die Kirche einzulassen, sich der Welt gegenüber möglichst fortschrittlich und traditionsabbau-end zu geben, die Flucht nicht nur vor der Welt, sondern auch vor ihren gei-• stigen Verwirrungen und geheimen Lüsten aufzugeben.
Aus der Offenheit gegenüber der
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute“, um die es dem Konzil ging (Kirche u. Welt, 1), ist so in weiten Kreisen eine fragwürdige Bereitschaft geworden, auf die Welt zu horchen, ja ihr zu gefallen, die Nachfolge Christi im Namen einer Öffnung zur Welt hin vor allem durch sozio-politisches Ideengut zu verwässern, von der Weltflucht in eine Sympathie auch mit den fragwürdigsten Aspekten der Welt umzukippen.
Das Konzil, dem man an dieser Entwicklung häufig die Schuld gibt, hatte nichts dergleichen im Sinne; zwar sprach es von der Pflicht der Kirche, nach den Zeichen der Zeit zu forschen - aber es fügte hinzu: „und sie im Lichte des Evangeliums zu deuten“ (Kirche u. Welt, 4). Ein entscheidender Satz der Konstitution „Gaudium et spes“ wurde immer häufiger überlesen: daß das Volk Gottes zwar mit den übrigen Menschen unserer Zeit die Ereignisse, Bedürfnisse und Wünsche teilt, dabei jedoch bemüht ist, „zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes“ seien (ebda, 11).
Zeichen der Zeit im Lichte des Evangeliums zu erforschen, um die Zeichen Gottes zu entdecken: dazu wurden wir vom Konzil aufgefordert, und genau dazu scheinen wir nicht recht fähig zu sein. Es ist gewiß nicht Absicht Gottes, uns gegen Ende des zweitausendjährigen Bestehens seiner Kirche nahezulegen, wir sollten es uns in dieser Welt bequem machen, alle Normen, die uns etwas abverlangen, beiseite legen und im Namen der Freiheit keiner Autorität mehr gehorchen.
Hier ist das nicht-christliche Denken der Neuzeit gefährlich weit in unsere Reihen eingedrungen. Seine Grundüberlegung lautet: was immer uns in dem überlieferten Normensystem, erst recht in der christlichen
„Eine fragwürdige Bereitschaft, auf die Welt zu horchen, ja ihr zu gefallen“
Ethik, an unserer Selbstbefreiung hindert, kann nicht echt sein.
Heute liegt uns ungemein am Herzen, einerseits dem Evangelium noch weniger als unsere Vorfahren zu folgen, andererseits aber dennoch in seinem Lichte großartig dazustehen. Deswegen neigen wir überall dort, wo das Evangelium, die christliche Überlieferung oder auch nur eine einfache Ethik uns schuldig zu sprechen drohen, dazu, die fraglichen Normen aufzuweichen oder gar auf Grund eines „gesellschaftlichen Konsenses“ abzuschaffen. Im Zweifelsfall muß gar das Konzil für diesen Traditionsabbau herhalten: wer nicht bereit ist, zum Prozeß der Auflösung des Glaubens und der Sittlichkeit beizusteuern, verhält sich „vorkonziliar“ - ein Vorwurf, der fast noch schlimmer als „vorsintflutlich“ ist.
Eine der bewährtesten Methoden ist dabei die Umdeutung von Sünden in „Befreiungen“ und „demokratiegerechtes Verhalten“ oder aber in naturhafte Unvermeidlichkeiten. Die Werke des Fleisches (Gal. 5, 19-21), scheint es nicht mehr zu geben: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornesausbrüche, Rechthabereien, Spaltungen, Partei-ungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Schwelgerei; statt dessen sprechen wir lieber von Lustmaximierung, sexueller Befreiung, Enthemmung, Fortschrittlichkeit, wissenschaftlicher Denkweise, legitimem Protest, Interessenkonflikten, unvermeidlicher politischer Auseinandersetzung, natürlicher Aggressivität, emanzipatorischer Kritik, Einsatz für demokratische Gleichheit, sozialen
Ansprüchen, dem Recht auf den eigenen Bauch und konsumgerechtem Verhalten.
Sündhaft ist nur noch das Reaktionäre: Demut ist Kriecherei, Selbstbeherrschung ist kleinbürgerlich, Geduld nichts als dumme Fügsamkeit, Gehorsam nur Unterstützung ungerechter Herrschaftsverhältnisse.
Hinter diesem Sicheinrichten der Welt verbirgt sich, was Gelehrte als „Transzendenzverlust“ bezeichnen. Im Gegensatz zu früheren Generationen haben wir wachsende Schwierigkeiten, anzuerkennen und mitzu-vollziehen, daß Gott ist, mit uns ist, sich um uns sorgt, uns beisteht.
Gewiß ist es berechtigt, wenn heute deutlicher als früher der Mahlcharakter der Eucharistie hervorgehoben wird; aber sind wir nicht ein wenig in Gefahr zu übersehen, daß nicht wir uns versammeln, um uns gegenseitig ein Liebesmahl zu reichen, sondern der menschgewordene Gott uns versammelt, um sich selbst als Speise darzubieten? Ohne es wahrhaben zu wollen, bauen wir, Schritt für Schritt ein Bewußtsein davon ab, daß nicht unsere Gedanken und Taten in der Liturgie wichtig sind, sondern ein objektives Geschehen, an dem wir teilnehmen dürfen, das aber als Handeln Gottes radikal alles überschreitet, was wir je zu leisten vermöchten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!