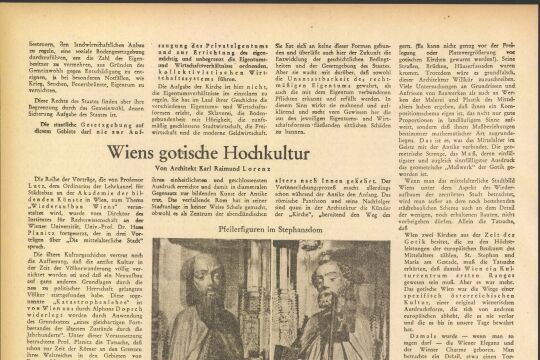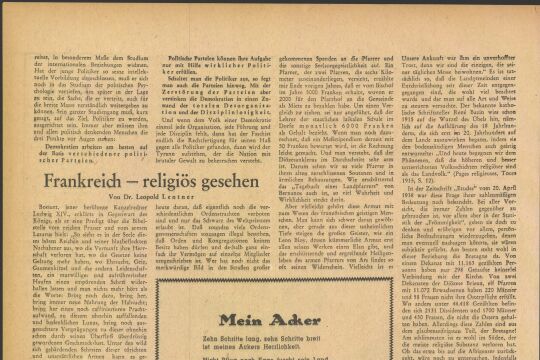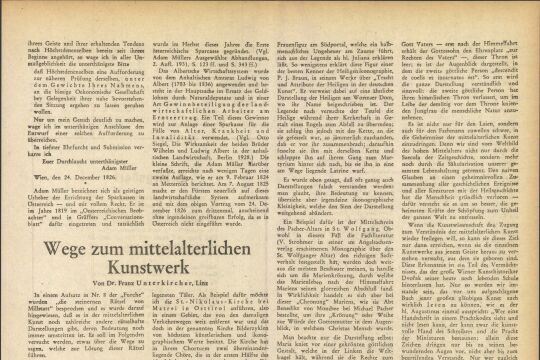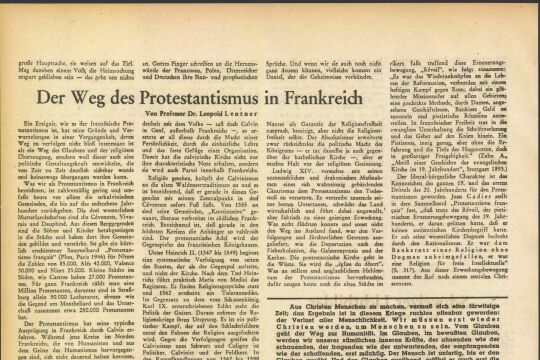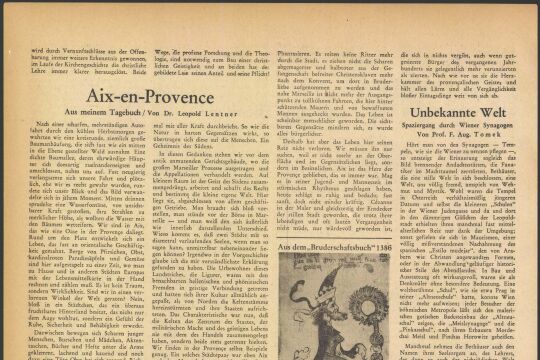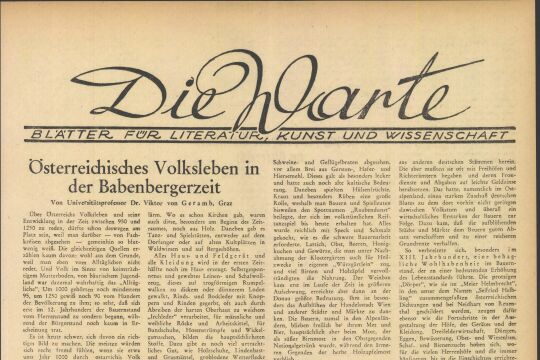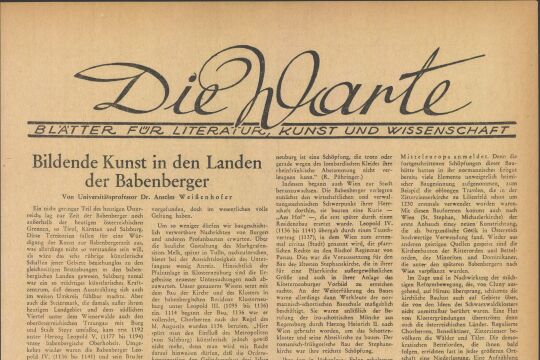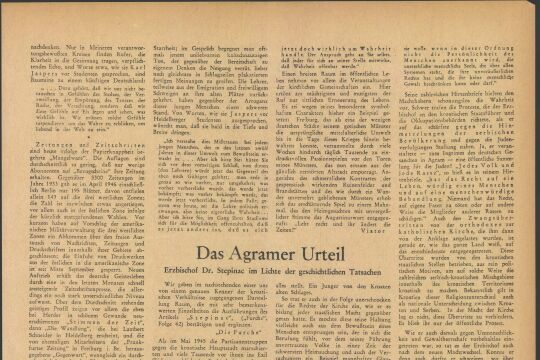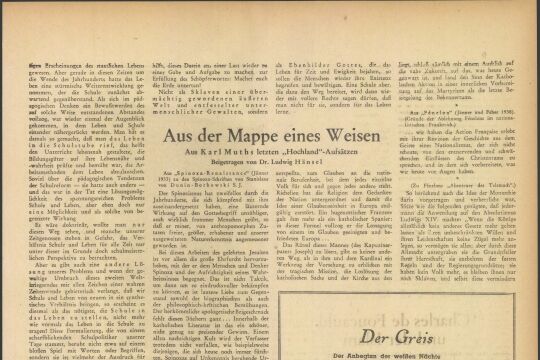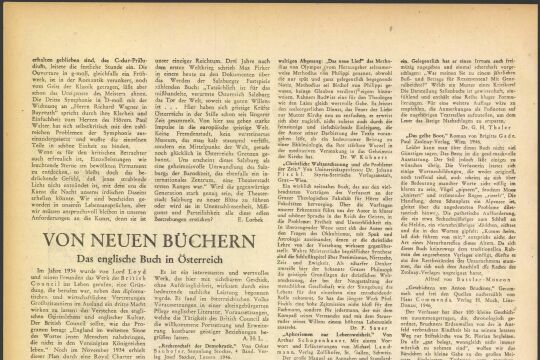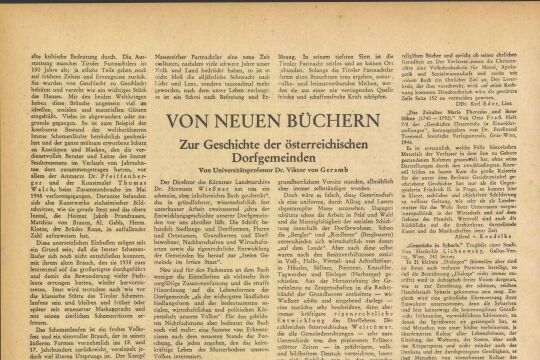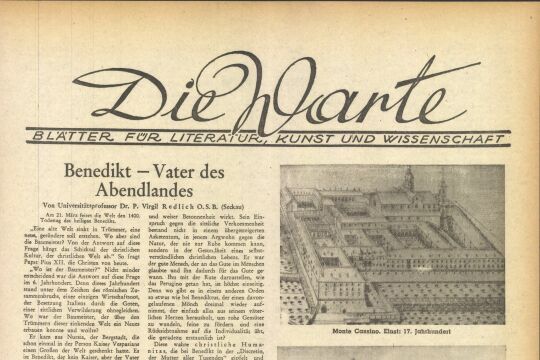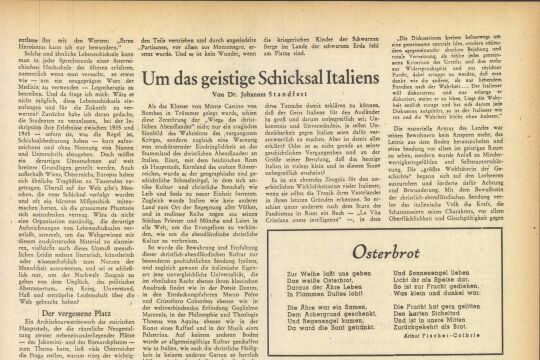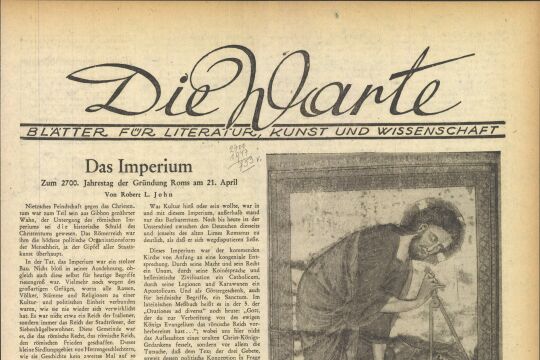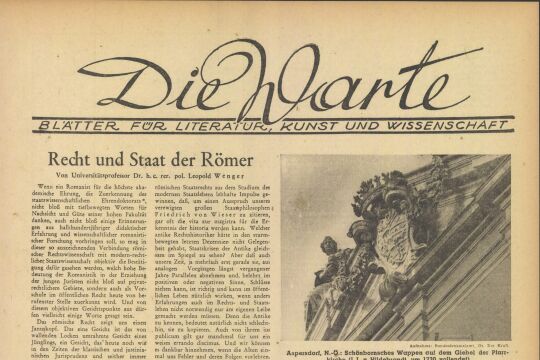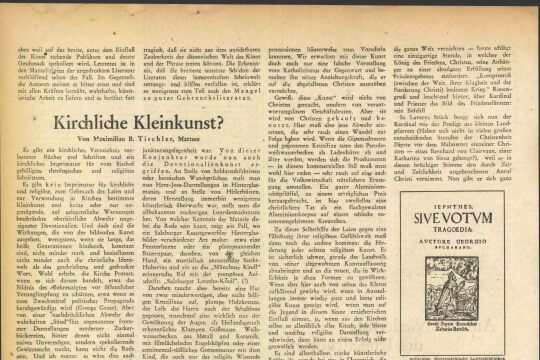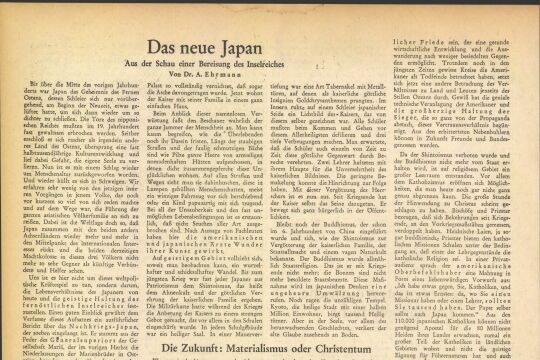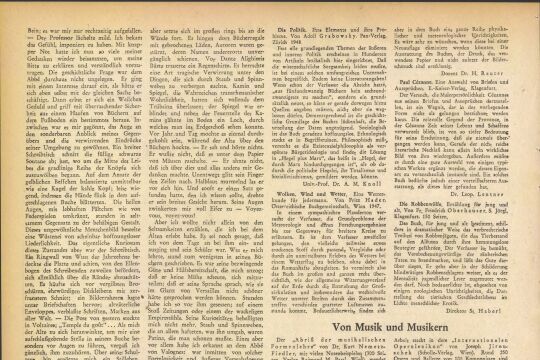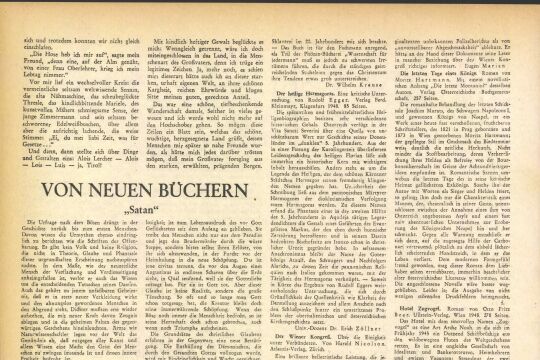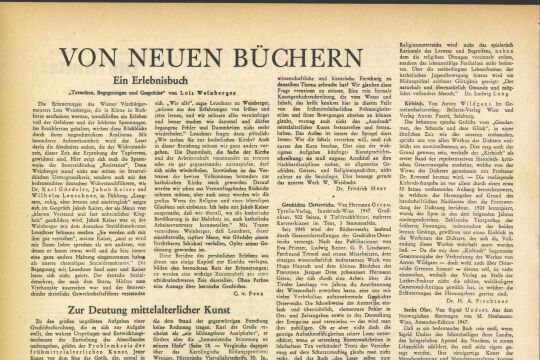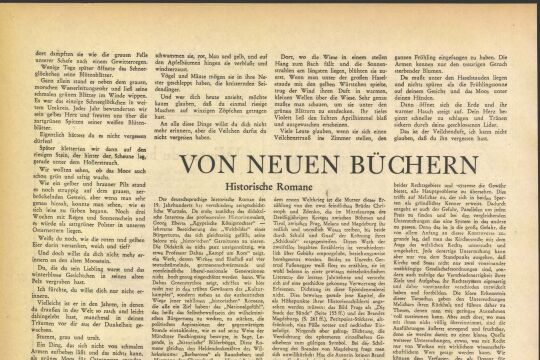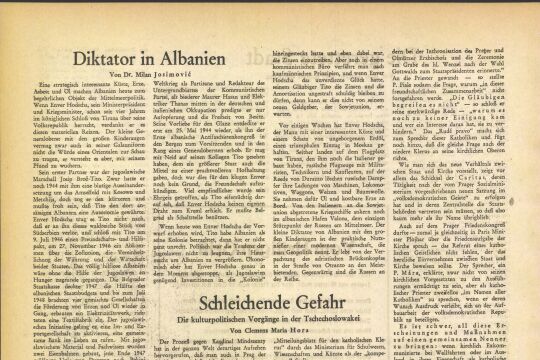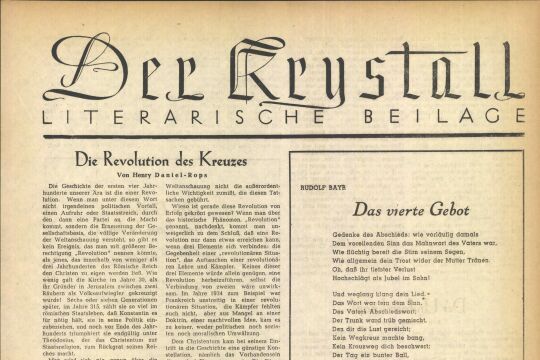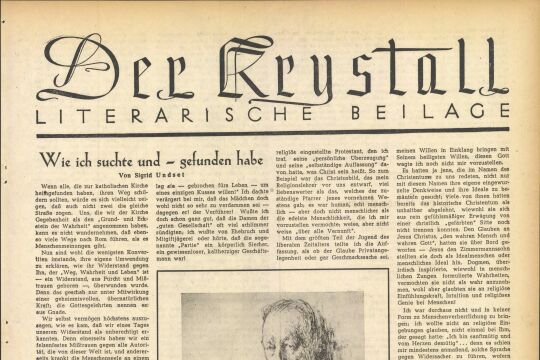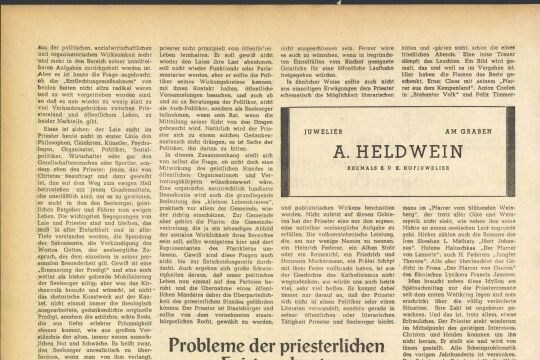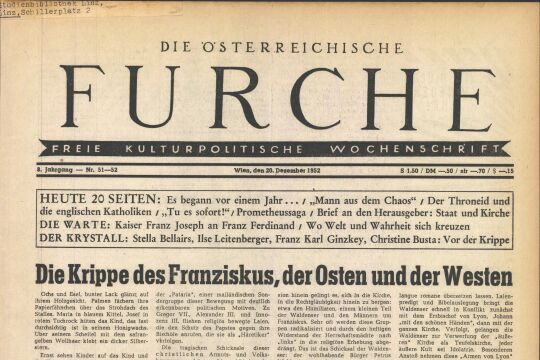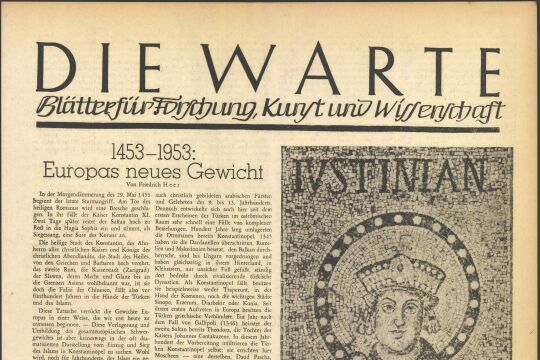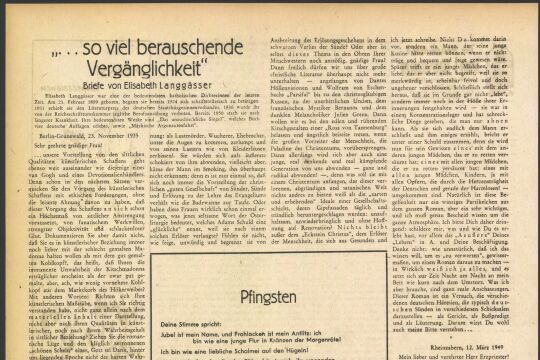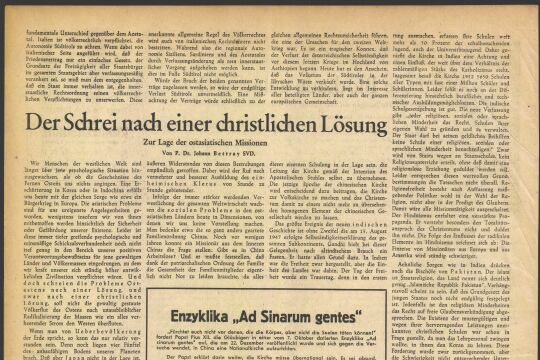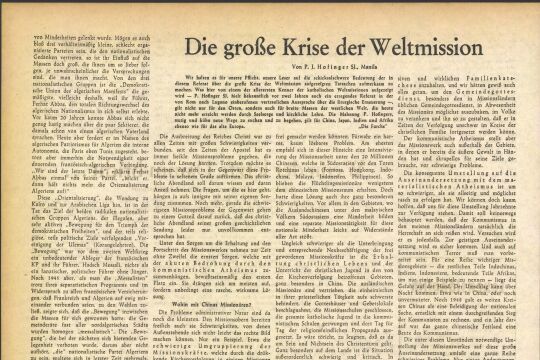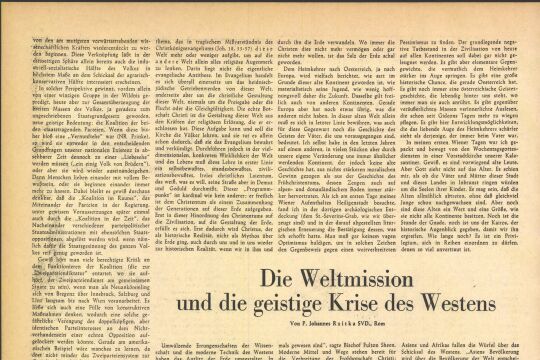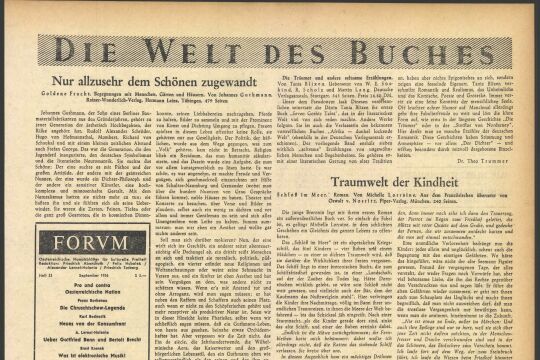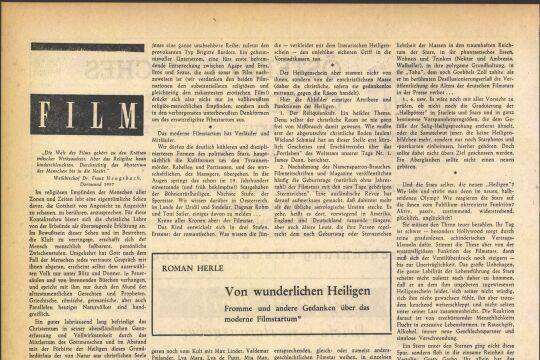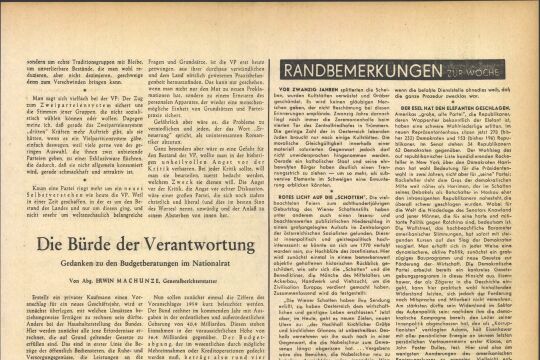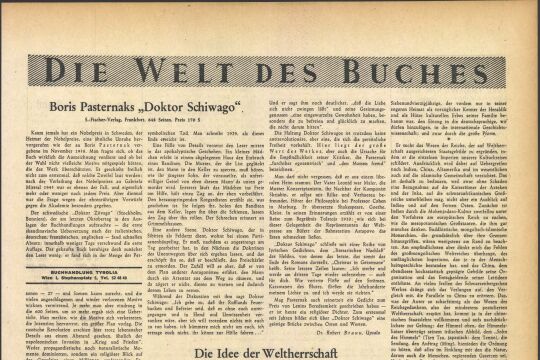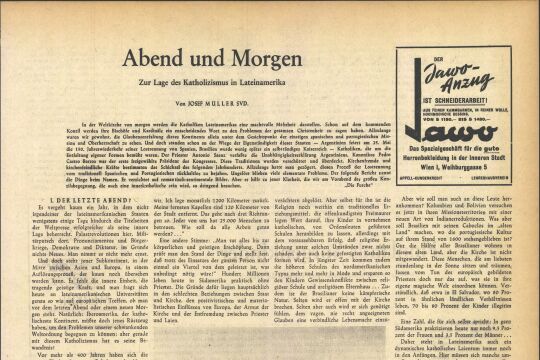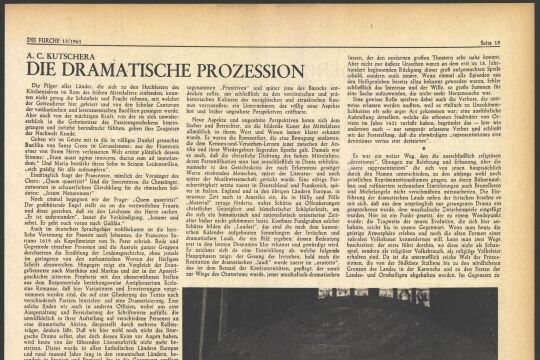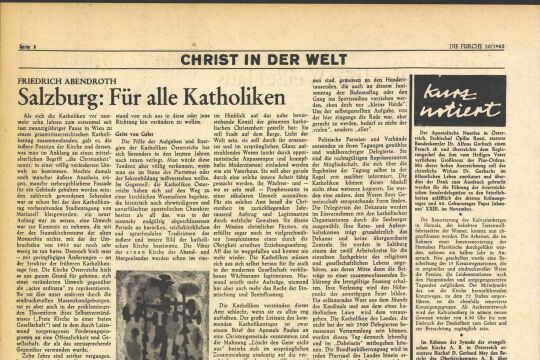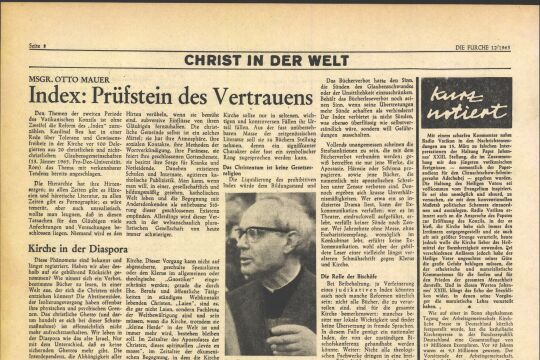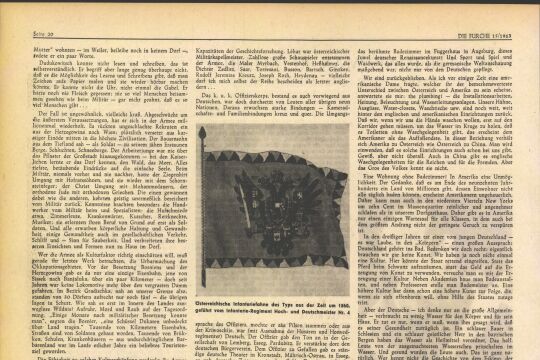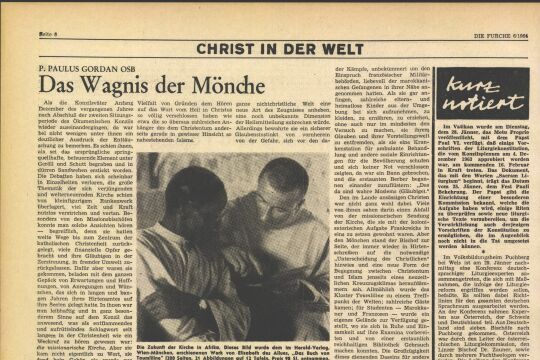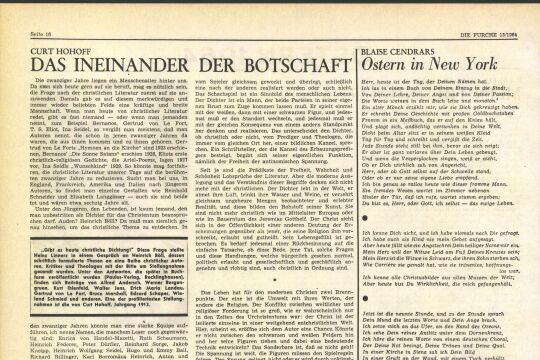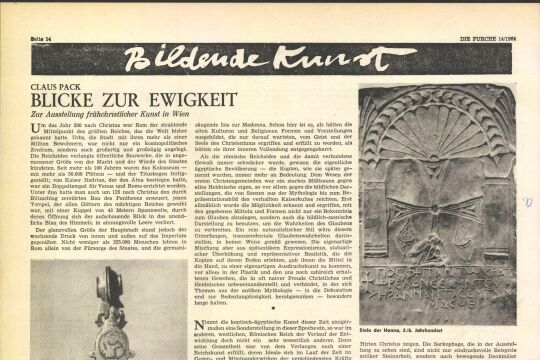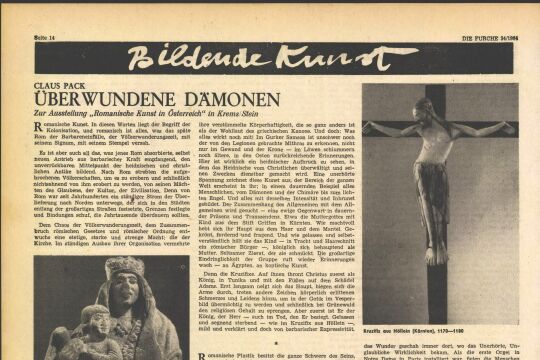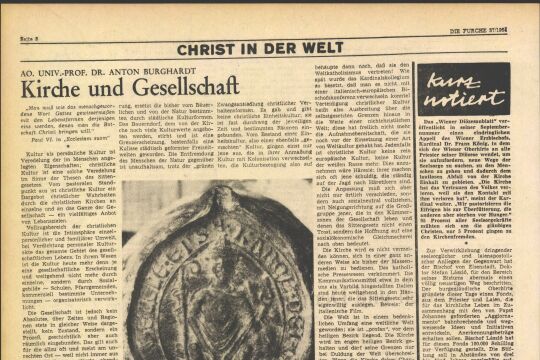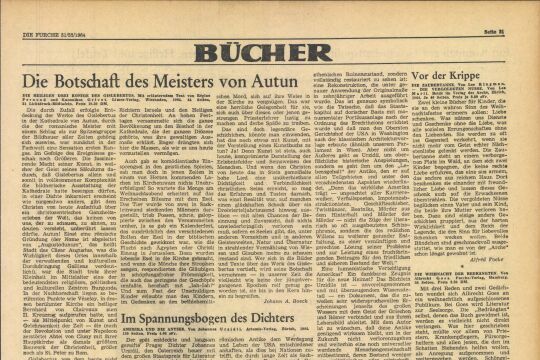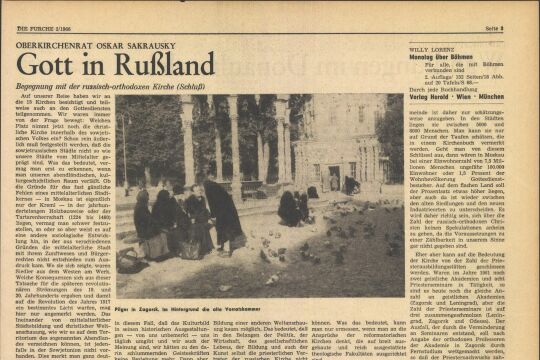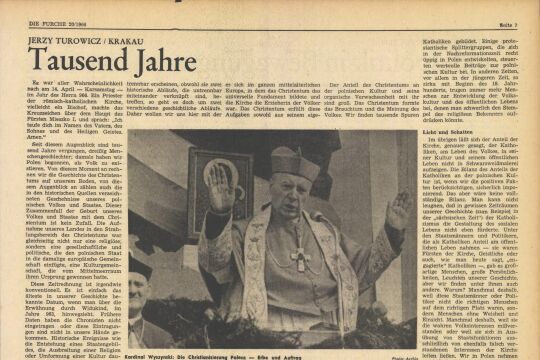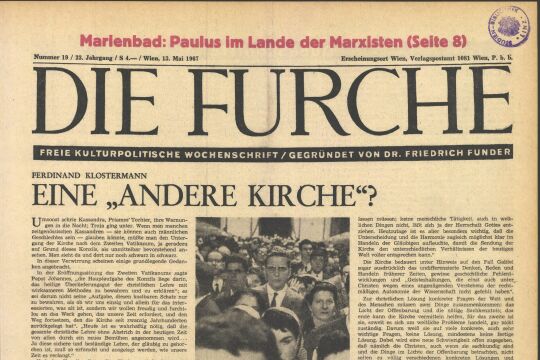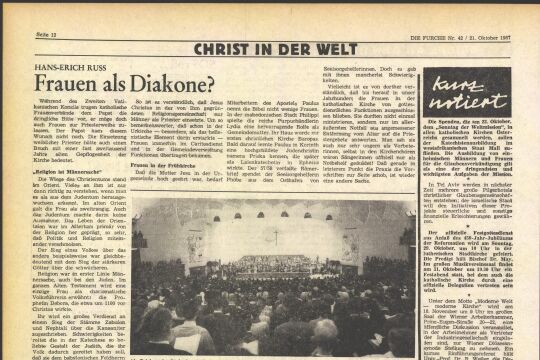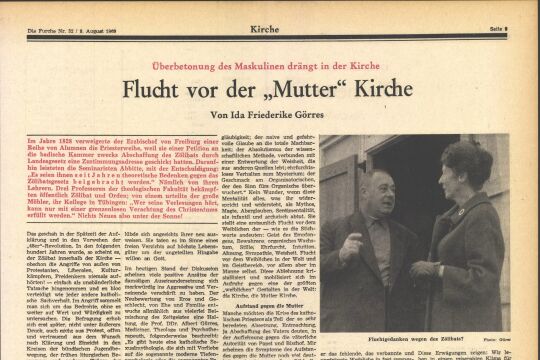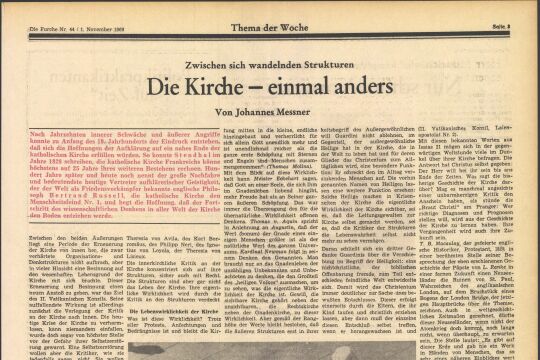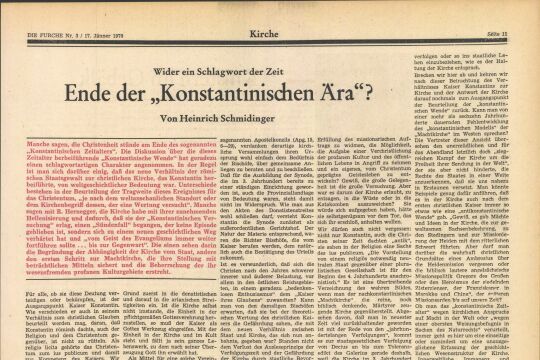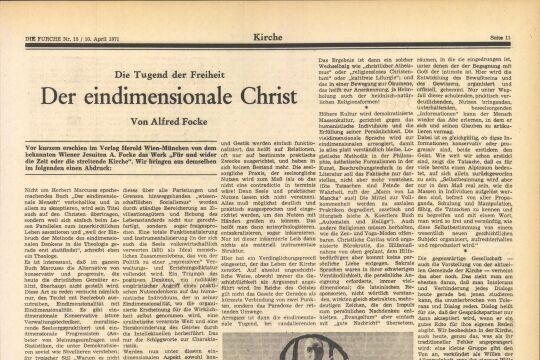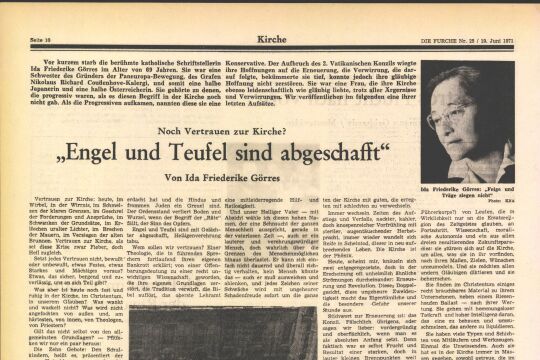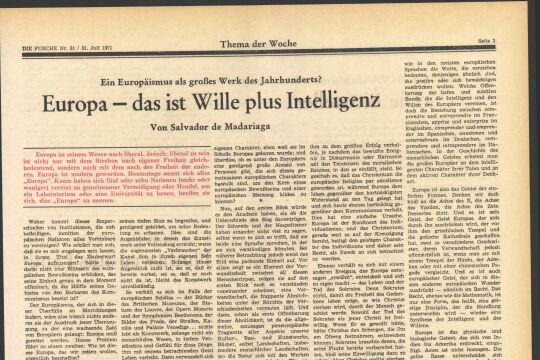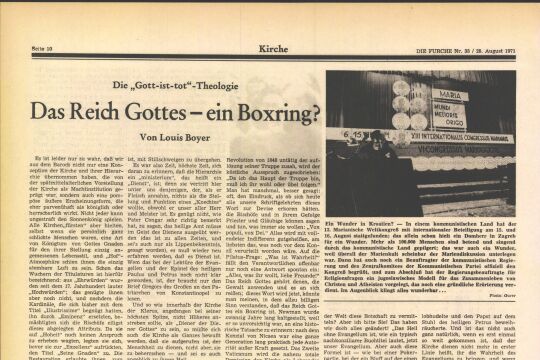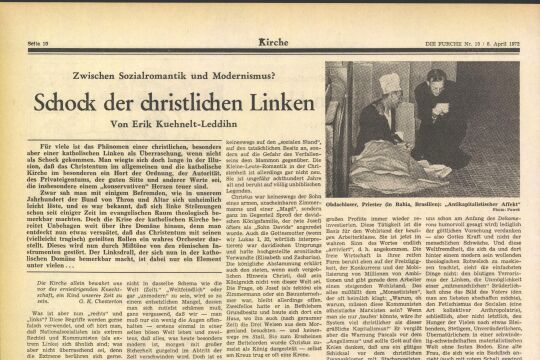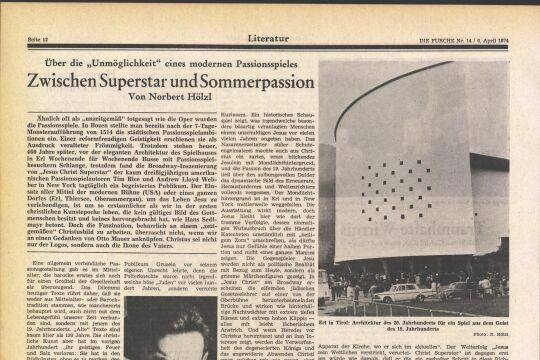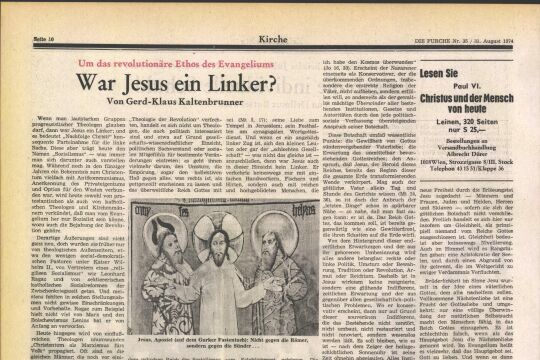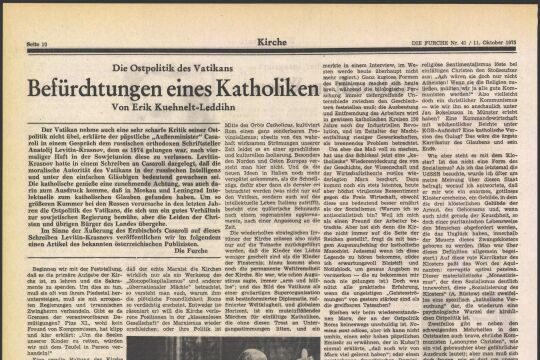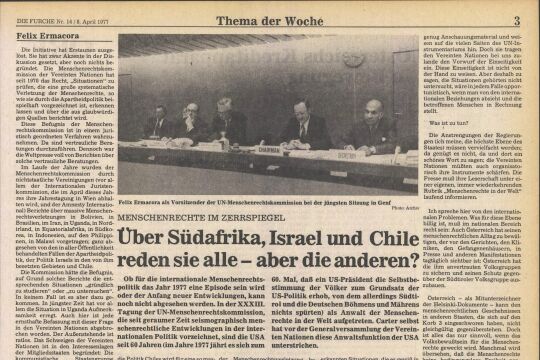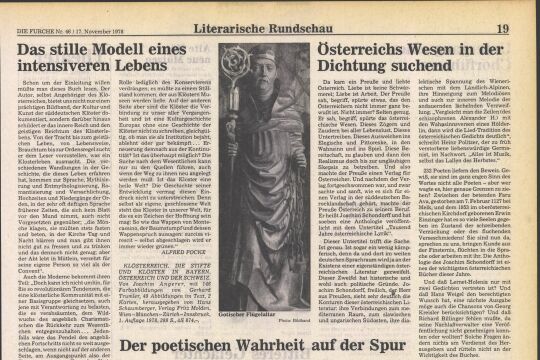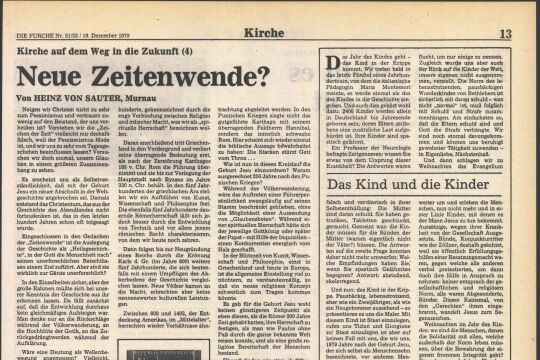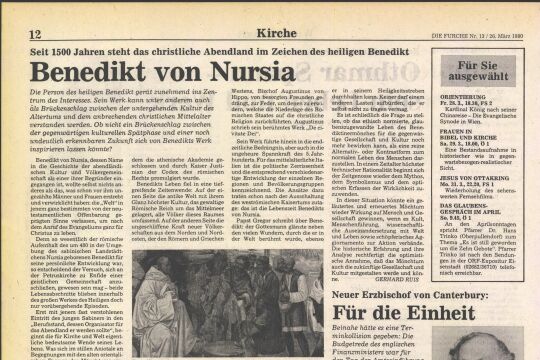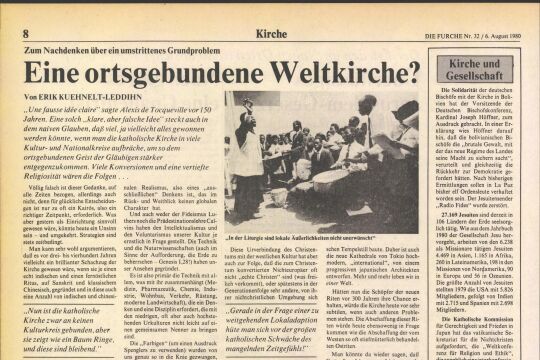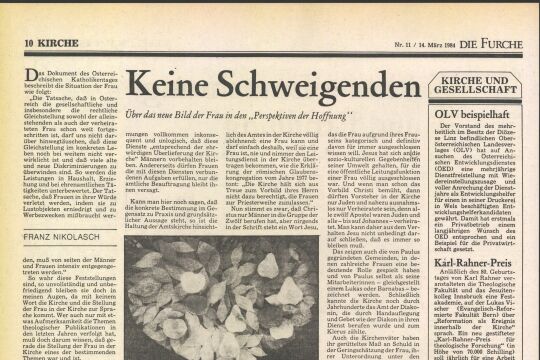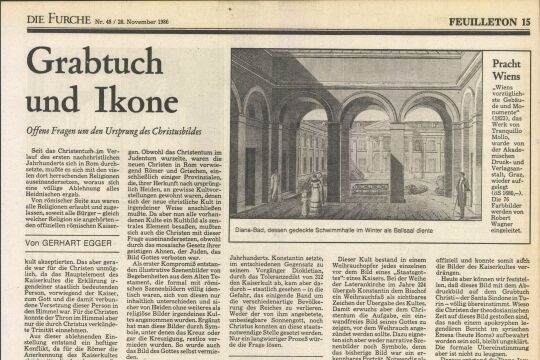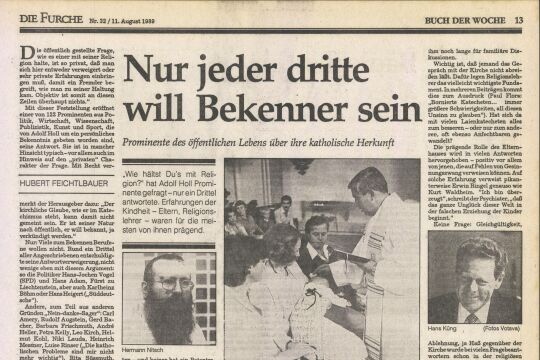Christliche Dunkelheit?
Catherine Nixey zeichnet in ihrem Buch „Heiliger Zorn“ ein düsteres Bild des frühen Christentums – und kontrastiert es mit der hellen Antike. Eine einseitige Sicht.
Catherine Nixey zeichnet in ihrem Buch „Heiliger Zorn“ ein düsteres Bild des frühen Christentums – und kontrastiert es mit der hellen Antike. Eine einseitige Sicht.
In der Deutschen Verlagsanstalt erschien kürzlich in deutscher Übersetzung ein Werk von Catherine Nixey. Der deutsche Titel „Heiliger Zorn“ ist eine sehr freie Übertragung des englischen Originals „The Darkening Age“. Catherine Nixey erzählt aus ihrer eigenen Perspektive die Entwicklung des Christentums in seinen Anfängen von einer Minderheit zur bestimmenden Religion des Römischen Reiches.
Die grundsätzliche Perspektive ist durch das bereits im Titel des Werkes angedeutete Paradigma gekennzeichnet: von der aufgeklärten Antike zum dunklen Mittelalter. Während die weihnachtlichen Texte der Christen von einem „Licht, das dem Volk, das im Dunkel wandelt, leuchtet“ (Jes 9,2) wissen, habe das genaue Gegenteil stattgefunden. Die lebensfrohe Antike, die Kunstwerke von überwältigender Schönheit hervorgebracht habe, sei durch ein dumpfes und lebensfeindliches Christentum ersetzt worden. Während in der Antike Toleranz herrschte, seien mit dem Anbruch der Herrschaft des Christentums ab dem vierten Jahrhundert Tempel zerstört, Kunstwerke vernichtet und Heiligtümer von Christen geplündert worden. Ohne es direkt auszusprechen, sind die Parallelen zu den Kunstschändungen islamistischer Fanatiker im 21. Jahrhundert offenkundig. Die Leserschaft soll selbst die angedeuteten Parallelen entdecken.
Die Christen als IS von damals
Man muss der Autorin zugestehen, dass sie überzeugend zu schreiben weiß, eben das macht das vorliegende Werk problematisch. Schließlich kann man ihr den Vorwurf nicht ersparen, dass sie einseitig erzählt. Sie übersieht, dass nicht nur die Christen religiöse Bauwerke anderer Traditionen nicht immer bewahrten. Dies traf auch auf die angeblich so tolerante römische Antike zu. Die Zerstörung des zweiten jüdischen Tempels fand im ersten nachchristlichen Jahrhundert statt. Dessen Ruinen künden noch heute in Jerusalem von einer durchaus nicht allen geltenden Toleranz der Römer.
Man darf dem Christentum sicherlich vorwerfen, dass es, was die Sexualität angeht, im Vergleich mit den Römern „verklemmt“ war. Allerdings hatte die christliche „Verklemmtheit“ durchaus gerade für schwache und benachteiligte Personen auch Vorteile. Die antike Welt hatte zugegebenermaßen mit praktizierter Homosexualität – unter gewissen Bedingungen – weitaus weniger Probleme als das Christentum. Schließlich war Homosexualität gesellschaftlich nur dann akzeptabel, wenn der Mann in der Rolle des Mannes war und nicht penetriert wurde. Dieses Recht der Penetration hatte der Pater familias beispielsweise gegenüber seinen männlichen Sklaven. Man wird die Frage aufwerfen müssen, ob vielleicht die Klöster gerade deswegen für benachteiligte Personen einen durchaus interessanten Lebensentwurf darstellten, weil dort bei den angeblich so düsteren und ungebildeten Mönchen Schutz vor sexuellen Übergriffen geboten wurde, der in den patriarchalen Strukturen der antiken Häuser so nicht immer bestand.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!