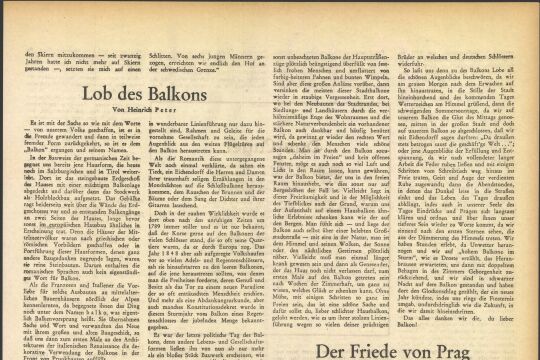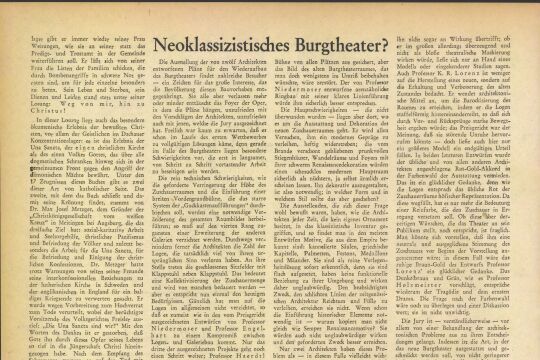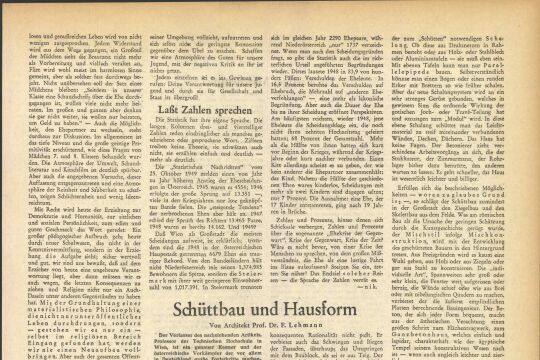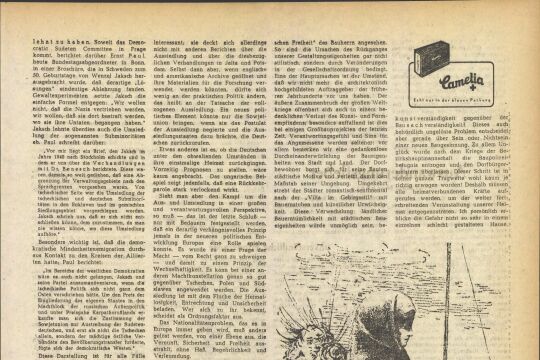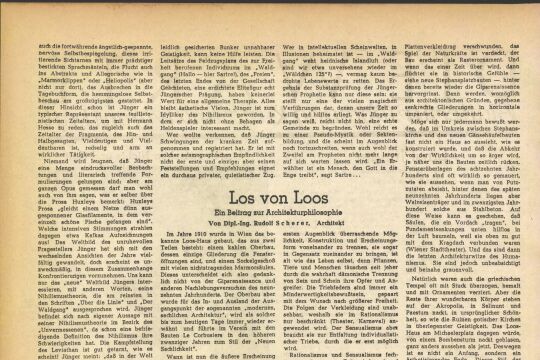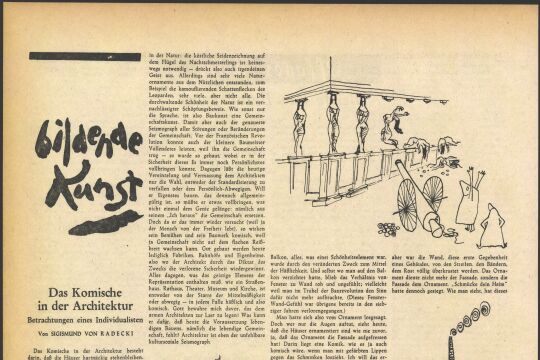Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
BetonscJimocIeerei
Das Komische der Architektur besteht darin, daß die Häuser hartnäckig stehenbleiben. Ein schwaches Gedicht, eine verpatzte Sonate werden vergessen, ein gemalter Schinken kommt in die Rumpelkammer, aber so ein Schmarren von einem Haus steht seine guten hundert Jahre, wobei Tausende es täglich anschauen müssen. Dichter, Musiker, Maler können sagen: „Ein Jugendwerk. Beachten Sie das nicht. Damals war ich noch unreif.“ Aber was hilft es uns, daß der Architekt damals noch unreif war — deshalb bleibt sein Haus doch nicht weniger dauerhaft stehen als ein Palazzo Pitti. Dabei fallen die Namen sonstiger Kitscherzeuger dem Spott anheim: es ist gar nicht so angenehm „Courths-Mahler“ zu heißen, während ein Architekt mit zwanzig unsignierten Häusern ein Stadtbild verschandeln kann, ohne daß jemand nach seinem Namen fragt.
Architektur ist nämlich wie die Sprache, Kunst und Notwendigkeit zugleich: ohne Musik und Malerei könnten wir immer noch leben, ohne Verständigungsmittel und ohne ein Dach überm Kopf nicht. Und anderseits hat es die Baukunst mit der Musik gemein, daß sie in einer Vorform bereits bei den Tieren zu finden ist: Vögel singen und bauen Nester. Darum sind Architektur und Musik die beiden nicht-abbildenden Künste — weil noch nie ein Tier etwas abgebildet hat.
Baukunst bildet nicht ab, sondern drückt aus, und weil sie zugleich notwendig ist, drückt sie zuerst einmal ein Bedürfnis aus: den bestimmten Zweck, dem das Gebäude dienen soll. Doch weil sie eben auch Kunst ist, sind in ein Haus zugleich noch Schönheit, Religion, Gemeinschaft, Persönlichkeit und was noch alles hineingebaut. Schon aus dem Grundriß eines Tempels läßt sich die Art der Gottesbeziehung ersehen. Vor allem aber läßt das Ornament, weil es über der Notwendigkeit steht, den Geist erkennen.
Wie sonst nur die Sprache, ist also Baukunst eine Gemeinschaftskunst. Damit aber auch der genaueste Seismograph aller Störungen oder Veränderungen der Gemeinschaft. Vor der Französischen Revolution konnte auch der kleinere Baumeister Vollendetes leisten, weil ihn die Gemeinschaft trug — es wurde so gebaut, wobei er in der Sicherheit dieses E s immer noch Persönlichstes vollbringen konnte. Dagegen läßt die heutige Vereinzelung und Vermassung dem Architekten nur die Wahl, entweder der Standardisierung zu verfallen oder dem Persönlich-Abwegigen. Will er Eigenstes bauen, das dennoch allgemeingültig ist, so müßte er etwas vollbringen, was nicht einmal dem Genie gelänge: nämlich aus seinem Ich heraus die Gemeinschaft ersetzen. Doch da er das immer wieder versucht, so wirken sein Bemühen und sein Bauwerk komisch, weil ja Gemeinschaft nicht auf dem flachen Reißbrett wachsen kann. Gut gebaut werden heute lediglich Fabriken, Bahnhöfe und Eigenheime, also wo der Architekt durch das Diktat des Zweckes die verlorene Sicherheit wiedergewinnt. Alles dagegen, was das geistige Element der Repräsentation enthalten muß, ist entweder von der Starre der Mittelmäßigkeit oder abwegig — in jedem Falle häßlich und also komisch.
Der erste Weltkrieg fegte die Könige und die Ornamente fort. Unter dem Ansturm der Technik sprach die neue Baukunst: Wir können keine neuen Ornamente schaffen, abgesehen davon, daß sie zu teuer kämen, und die alten sind längst zur Lüge geworden. Fort damit!
Nun — wenn der Zweck eines Gebäudes gut ist und dem Menschentum dient, dann wird er, auch schmucklos ausgedrückt, schön wirken wie z. B. jedes rechtschaffene Bauernhaus. Ist aber der Zweck eines Gebäudes zwar notwendig, aber nicht unmittelbar menschenwürdig, so wird die ihm innewohnende Fadheit mit der Schmucklosigkeit um so nackter hervortreten. Nun sind die beiden charakteristischen Häusertypen unserer Großstätte — das Bürohaus und die Mietskaserne — beide gewiß notwendig, aber nicht gerade menschenwürdig; denn jeder ersehnt sich ein Eigenheim und nicht jeder ein Leben auf dem Büroses'sel.
Und so brachte der nackte Zweck dieser Gebäude Unschönheit zutage. Beim Bürohaus kam das so: wo alle an Schreibtischen sitzen, braucht man Licht, also viele Fenster, eines dicht neben dem anderen. Dadurch aber wurde das Grundthema jeder Fassade, welches in dem schönen Verhältnis von Fenster zu Wand besteht, sogleich zerrissen. Denn Wand ist, was vor dem Außen schützt, Fenster, was mit ihm verbindet — beide beziehen sich auf den Menschen. Die Bürofenster aber wurden eine durchlaufende Laternenserie, ein horizontaler Glasstreifen, wodurch mit Notwendigkeit auch die Wand darunter zu einem Betonstreifen wurde. Und so kam es zu dem modernen Sandwich- oder Bandagenhaus, dessen Fassade aus alternierenden Glasstreifen und Wandstreifen besteht. Diese Häuser blicken einen nicht mehr menschlich aus ihren Fenstern an. sondern es ist eine unmenschliche Starre in sie gekommen.
Ein Aehnliches geschah mit der Mietskaserne. Denn der Mieter war jetzt so weit von der Natur weg, daß er einen Terrassen- und Verandaersatz haben wollte — den Wohnbalkon. Der einstige Balkon mit seinem geschwungenen Eisengitterwerk war nicht etwas zum Wohnen*, sondern zum Hinaustreten: ein luftiger Schmuck, der die starre Glätte der Wand erst zur Wirkung brachte. Aber der heutige Wohnbalkon, wo jeder Mieter für sich Kaffee trinken, Blumen züchten oder sonnenbaden will, macht das Haus zu einer Kommode mit herausgezogenen Betonschubladen und gibt ihm ein monströses Gesicht, das aus lauter Nasen besteht. Wand, Fenster, Balkon - alles, was einst Schönheitselement war, wurde durch den veränderten Zweck zum Mittel der Häßlichkeit. Und selbst wo man auf den Balkon verzichtet hatte, blieb das Verhältnis von Fenster zu Wand roh und ungefühlt.
Man hatte sich also vom Ornament losgesagt. Doch wer nur die Augen auftut, sieht heute, daß die Häuser ornamentiert sind wie nie zuvor, ja daß das Ornament die Fassade aufgefressen hat! Darin liegt eine Komik, wie es ja auch komisch wäre, wenn man mit gefärbten Lippen gegen das Schminken loszieht. Ich will das erläutern. Höhe und Länge eines Gebäudes — das sind die beiden Tendenzen, die im Kraftfeld einer Häuserwand spielen. Es gibt eben eine höhere architektonische Notwendigkeit als den bloßen Nutzzweck: jene nämlich, das Kräftespiel innerhalb eines Gebäudes zum Ausdruck zu bringen, weil es sonst eine tote Schachtel bleibt. Daß zum Beispiel das Erdgeschoß die ganze Last zu tragen hat, möchte irgendwie zum Ausdruck kommen, wie ja auch auf dem Rücken eines Lastträgers die Muskeln spielen. Die klassizistische Bauweise brachte dieses Kräftespiel in Harmonie, indem sie die Wand vorherrschen ließ und auf ihr durch Fenster, Simse, Lisenen, Quaderungen den Kampf zwischen Horizontale und Vertikale andeutete. Die Kraftlinien blieben fast unsichtbar und eine Funktion der Wand.
Doch die neue Architektur suchte diese ewige Aufgabe gewalttätig, gewissermaßen totalitär zu lösen. Entweder entschied sie sich für die Vertikale, so daß die Wand nur noch aus Vertikalstreifen vom Pflaster bis zum Dach bestand: die ganze Fassade wurde zu einem einzigen Streifenornament. Oder sie entschied sich (wegen der Bürofenster) für die Horizontale, so daß das Haus wie aus Brotscheiben aufgeschichtet erschien, was bei Schwarzweißfarben auch noch an Zebra erinnerte: wieder war das Ganze ein einziges Ornament geworden. Die dritte Gewaltlösung bestand darin, daß man Vertikal- und Horizontallinien einfach als gigantischen Rechtecksrost an die Fassade pappte, wobei das Ganze wie mit einem Waffeleisen angedrückt schien. Das bißchen Wand, was dahinter noch übrigblieb, wurde als Fensterfortsatz kaschiert Hier waren die zwei Tendenzen nicht, wie einst, in diskrete Harmonie gebracht, sondern blieben plump in ihrer nackten Gegensätzlichkeit stecken. Und wiederum war das ganze Gebäude zu einem Ornament geworden. Man könnte das Betonschmockerei nennen. In allen drei Fällen aber war die Wand, diese erste Gegebenheit eines Gebäudes, von den Streifen, den Bändern, dem Rost völlig überkrustet worden. Das Ornament diente nicht mehr der Fassade, sondern die Fassade dem Ornament.
Wie man sieht, hat dieses moderne Ornament seinen Ursprung nicht im Geistigen, sondern es heuchelt Zweckmäßigkeit. Einst hatte man, weil man wahr sein wollte, das zur Lüge gewordene Ornament als unzweckmäßig verbannt — doch nun wurde der Zweck selber zum Ornament!
Wie du auch bauen magst, dein Bauwerk wird stets ein Inneres ausdrücken, denn Architektur ist Ausdruckskunst. Die Straßenhäuser von 1905 mit ihren individualistischen Mittelgiebeln sind eine Kreuzung aus Uebermensch und Jörn Uhl — wir lesen das heute ihren Fassaden ab wie einem aufgeschlagenen Buch. Stil bedeutet, daß der Mensch nicht vom Brot, nicht von der Notwendigkeit allein leben will. Wird aber das Notwendige selber zum Ornament, so ist das ein Zeichen, daß der Mensch, über den Umweg des Geistes, wirklich nur vom Brot allein leben will. Das zum Selbstzweck erhobene Leben verfällt in die Starre des Ornaments.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!