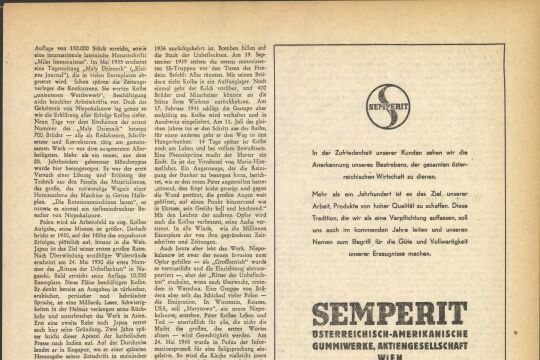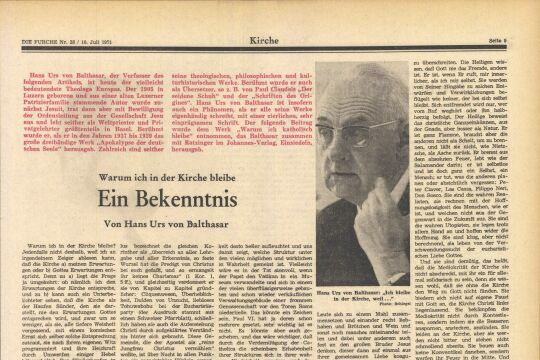Die Narben der Kirche
Was abseits von Macht, Skandalen und Missbrauch wirklich auf dem Spiel steht: Eine theologische Analyse der Kirchenlage.
Was abseits von Macht, Skandalen und Missbrauch wirklich auf dem Spiel steht: Eine theologische Analyse der Kirchenlage.
Die katholische Welt steht dieser Tage unter Dauerschock. Nur zwei Tage nach dem Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan die nächste Schreckensmeldung: Der australische Kardinal George Pell wurde wegen Kindesmissbrauchs in den 1990er Jahren in erster Instanz verurteilt. Nach der Laisierung des US-amerikanischen Ex-Kardinals Theodore McCarrick ist dies der nächste ranghohe Kleriker, der in den Strudel von Sex, Macht-und Amtsmissbrauch gezogen wird. Kardinal Pell betont weiter seine Unschuld, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Dennoch wirkt die Nachricht verstörend. Kein Stein der Kirche bleibt offenbar auf dem anderen.
Die Stimmen der Opfer verstummen nicht, der öffentliche Druck wächst. Der jahrzehntelang kirchlich inszenierte Mantel des Schweigens wärmt längst nicht mehr, der Schleier des Vergessens deckt nichts mehr zu. Die Glaubwürdigkeit des kirchlichen Institutionsriesen liegt am Boden, innerkirchliche Stabilisierungsversuche wirken mancherorts hilflos und halbherzig. Lethargie und Zorn machen sich breit. Den Verantwortlichen dürfte klar sein, was ohnedies viele befürchten: Die römische Kirche befindet sich in ihrer schwersten Krise seit der Reformation.
Die Ursachen dafür sind aber kein Fremdangriff, der die Kirche von außen erfasst hat. Die Verantwortung lässt sich nicht abstreifen, eine kirchliche Opfertheorie mag ebenso wie eine theologische Schuldzuweisung an den Teufel nicht wirklich zu überzeugen. Zu einfach wären solche Erklärungen. Niemand anderer hat die bedauernswerte Mutter Kirche so weit gebracht, sondern maßgebliche Momente der Kirchenskandale scheinen hausgemacht oder zumindestvonTeilendeskirchlichenSystems begünstigt.
Macht-Sex-Geld, die traurige Triade
Macht, Geld und Sex - so lautet die traurige Triade, wenn man sich die Skandale anschaut. Hinzu kommt der enorme Streit der Kirchenvertreter, wie man diesen Problemen Herr werden könnte. So gut gemeint die Ratschläge sind, spiegeln sie dennoch die innere Zerrissenheit wider, die viele Flügel des Kirchenvolkes seit Jahren lähmt. Lösungsversuche bewegen sich zwischen dem altbekannten Rezept, lieber selbst alles wieder ins Lot zu bringen ("Arzt, heile dich selbst!"), bis hin zu radikalen Forderungen nach strukturellem, inhaltlichem oder personellem Wandel.
Manche Verantwortliche beschreiten den Weg der Aufarbeitung mit dem Mut einer neuen Transparenz. Dieser ist durchaus zu begrüßen, wenngleich man sich manchmal nicht sicher ist, wie freiwillig diese Karte gespielt wird. Wenn die kircheninterne Visitation versucht, die Vorgänge in der Diözese Gurk-Klagenfurt nach einem bischöflichen Vier-Augen-Prinzip (Salzburgs Franz Lackner und Feldkirchs Benno Elbs) und unter Mithilfe nicht-kirchlicher Experten aufzuklären, kann dies als erster Schritt gelten. Dass die Grazer Staatsanwaltschaft in demselben Fall zusätzlich Ermittlungen aufgenommen hat, wirkt für viele Beobachter dennoch irgendwie beruhigend. Zu viel Vertrauen ist in den letzten Jahren verspielt worden. Dies soll keinesfalls die angestellten Bemühungen um Ehrlichkeit schmälern, aber wer könnte den Menschen ihre Vorbehalte übelnehmen?
Zur gleichen Zeit ringen die deutschen Bischöfe angesichts des kürzlich bekannt gewordenen Ausmaßes an Missbrauchsfällen der vergangenen Jahrzehnte um ihre Stimme. In medialen Auftritten und Interviews stellen manche Oberhirten öffentlich zentrale Regelungen kirchlicher Amtsführung, Sexualmoral und Zentralisationsgewalt infrage. Keine Themen, weder Zölibat, Frauenweihe noch machtpolitische Fragen sollen ausgespart werden. Dennoch ernten die Leitungskreise dafür nicht nur Lob unter ihren Gläubigen. Selbst dem Kirchenvolk gehen manche Forderungen dann doch zu weit. Wo der Kern des katholischen Kirchenbildes berührt wird, kann der Gegenwind enorm werden.
Gefälle zwischen Identität und Realität
Hier gelangt man an nichts Geringeres als an das Selbstbild der Kirche. Irrtümer oder Makel hatten dort über die Jahrhunderte nur wenig Platz. Die Kirche Christi gilt schließlich seit den ersten Konzilien als heilig. Verbrechen, Verfehlungen oder Scheitern? Fehlanzeige. Wenn schon Fehler passiert sind, dann gingen die auf das Konto von sündigen Einzelpersonen, die jedoch der Heiligkeit der Kirche nichts anhaben konnten. Diese dogmatische Immunität wirkt gegenwärtig jedoch gar nicht mehr so entlastend. Denn: Was nützt die ideale Heiligkeit eines unantastbaren Systems, wenn dessen geschichtliche Realität von persönlichen und strukturellen Fehlleistungen nur so wimmelt?
Eben dieses Gefälle zwischen Idealität und Realität markiert einen problematischen Punkt kirchlicher Identität: Man fühlt sich berufen, der Welt und den Menschen das Evangelium zu bezeugen. Dies bedeutet nichts anderes, als dass sich die Kirche als Wegweiserin versteht, die den Menschen etwas Ahnung von Gottes Botschaft geben möchte. Die Kirche selbst jedoch ist nicht göttlich. Zugegeben: Das wird gerne übersehen. Sie kann sich aber nicht aus den irdischen Realitäten herausstehlen und vorgeben, sowieso nichts mit menschlicher Not, Scheitern und Bedrängnis zu tun zu haben. Die Kirche ist eine geschichtliche Größe. Ihr Auftrag spielt sich in der Welt ab -am Ziel des gläubigen Pfades, im "himmlischen Jerusalem", braucht es keine Kirche, braucht man keinen Wegweiser mehr (Offb 21,22). Angesichts der prekären Kirchenkrisen steht Einiges auf dem Spiel: Wer auf ein falsches Selbstbild pocht, wer auf eigene Fehler nicht glaubhaft reagieren kann, läuft Gefahr, die eigene Überzeugungskraft vollständig zu verspielen. Da ist die Kirche keine Ausnahme. Dann stehen die Autorität der Kirche sowie die Tiefe der ihr anvertrauten Botschaft zur Disposition. Wenn die Gemeinschaft unfähig wird, die Botschaft von Liebe, Respekt und Toleranz weiterzugeben, dann verliert sie ihre eigentliche Existenzberechtigung.
Was es tatsächlich braucht, ist ein Kirchenbild, das sich nicht einfach in schwarz/weiß, unheilig/heilig abbilden lässt, sondern auch das Scheitern in die eigene Identität einarbeiten kann. Biblische und kirchliche Vorbilder gäbe es genügend, doch manchmal müssen auch diese Figuren von den goldenen Schutzmänteln narrativer Idealität befreit werden. Dann erscheint Petrus etwa nicht mehr als der Apostelfürst und der unverrückbare Fels, sondern als der hinfällige Knecht, der trotz seines Scheiterns am Evangelium seines Herrn festgehalten hat. David ist plötzlich nicht mehr das Ideal des israelischen Königs, sondern der Sünder, der trotz seiner himmelschreienden Verbrechen zum Werkzeug Gottes wurde.
Sich den eigenen Fehlern stellen
Solche Bilder beschönigen nichts von dem, was in der Kirche gegenwärtig im Argen liegt. Sie können aber den Weg von Worten und Bekenntnissen hin zu Taten und Wandel weisen. Die Zeit, in der man wegblicken konnte, ist vorbei. Die geschlagenen Wunden sind real, die Schmerzen schier unerträglich. Wer sich den eigenen Fehlern aber stellt, kann auch Entlastung vom eigenen Selbstideal schaffen, welches man möglicherweise schon lange nicht mehr erreicht hat: Kirche sollte sich deshalb mit ihrem Scheitern niemals lethargisch abgeben oder es leugnen. Sie sollte sich nicht zu schade sein, diese Wunden zu versorgen und Hilfe von außen anzunehmen. Hochmut wäre an dieser Stelle fehl am Platz. Offene Wunden dürfen nicht aus Scham unbehandelt gelassen werden, selbst wenn man sich dann bewusst machen muss, dass schon der gesamte kirchliche Leib mit tiefen Narben der Geschichte übersät ist.
Man muss sich angesichts der zahlreichen Fehlleistungen eingestehen: Ekklesiale Heiligkeit ist nicht mit einer unangreifbaren Unversehrtheit gleichzusetzen. Die Gemeinschaft ist nicht immun gegen menschliches Versagen. Ihr sind Arbeit, Hoffnung, Freude, aber auch Scheitern, Klagen und Verbrechen von 2000 Jahren Kirchengeschichte eingeschrieben. Davon ist sie nicht zu lösen. Der kirchliche Leib ist mit zahlreichen Wundmalen eigener Schuld gezeichnet. Leugnen, Schönreden, Wegschauen oder der Fingerzeig auf Andere helfen in dieser Situation wenig. Wiedergutmachung ist oftmals unmöglich, viele Opfer sind gezeichnet oder schon längst tot. Möglicherweise wäre es aber genau in dieser Aussichtlosigkeit möglich, ein zartes Pflänzchen neuen Vertrauens zu säen. Doch dazu braucht es ein neues Bewusstsein. Eines, das nicht auf Verteidigung angelegt ist, sondern auf ehrliche und echte Arbeit an sich selbst und den eigenen Fehlern aufbaut.
Der Autor ist Theologe und Erwachsenenbildner in Salzburg
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!