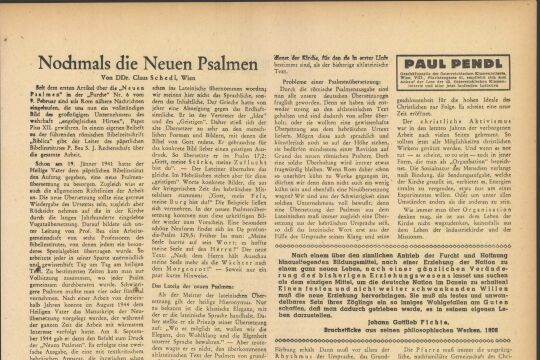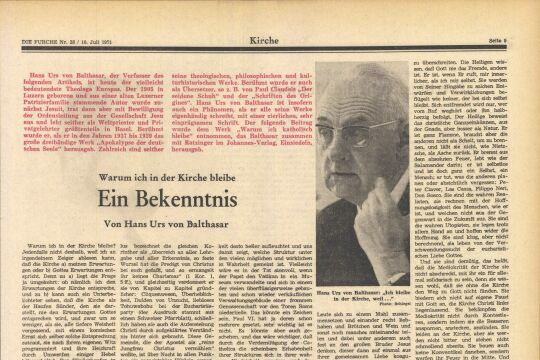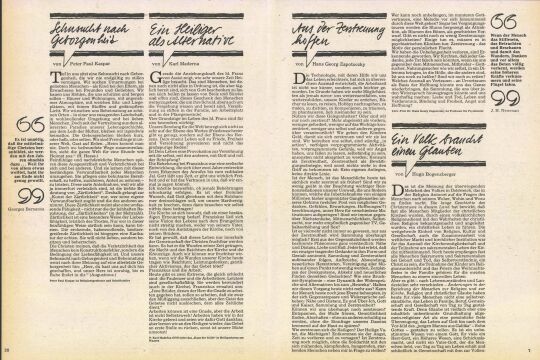Katholische Kirche am Scheideweg
Die Windböen, denen sich die katholische Kirche weltweit wie hierzulande im letzten Jahr ausgesetzt sah, scheinen enorm. Bruchlinien, die da sichtbar werden, führen sie auf ihren eigenen Auftrag zurück. Eine etwas andere Vorweihnachtsbetrachtung.
Die Windböen, denen sich die katholische Kirche weltweit wie hierzulande im letzten Jahr ausgesetzt sah, scheinen enorm. Bruchlinien, die da sichtbar werden, führen sie auf ihren eigenen Auftrag zurück. Eine etwas andere Vorweihnachtsbetrachtung.
Die Bilanzen der katholischen Kirche der letzten Zeit gleichen sich auf verblüffende Weise: Jahr für Jahr ringt die römische Kirche mit den Abgründen ihrer nicht selten selbstverursachten Krisen aufs Neue. Die Last auf dem „Schifflein Petri“, so ein traditionelles Bild für die römische Glaubensgemeinschaft, wiegt schwer. Immer neue Skandale erschüttern es. Die Windböen, denen sich Passagiere und Crew ausgesetzt sehen, nehmen zu. Panische Reaktionen, Orientierungslosigkeit, ja sogar Anzeichen von Meuterei werden vielerorts erspäht. Die Lage ist ernst.
Der Blick auf 2019 unterstreicht die brenzlige Situation: Im vergangenen Jahr fanden mit dem Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan (Februar) und der „Bischofssynode für Amazonien“ (Oktober) zwei kirchenpolitische Großereignisse statt, die unzählige Blicke auf und ebenso viele Hoffnungsmomente in sich vereinigt haben. Hier standen Fragen im Mittelpunkt, die den Kern christlicher Glaubwürdigkeit in der Welt von heute betreffen.
Was mit den teils großen Erwartungen an diese Versammlungen passiert ist, lässt sich noch nicht genau abschätzen, aber die von vielen erhofften 180-Grad-Wendungen in kirchlichen Geschicken wurden dort nicht erreicht. Manche meinen „Gott sei Dank!“, andere beklagen bereits jetzt ein erneutes Scheitern der vielleicht „letzten Gelegenheiten“. Diskutiert wurde viel, Texte wurden produziert, doch umfassende Maßnahmen lassen immer noch auf sich warten. „Wie lange denn noch?“, fühlen viele Gläubige die fragende Stimme aus der biblischen Apokalypse in sich aufsteigen.
Alte Probleme neu an der Oberfläche
Ungeduld macht sich bei vielen Gläubigen breit. Jahr für Jahr zieht im Kirchenkalender ins Land, die Diskussionen um die prekäre Lage der Kirche gehen weiter. Dennoch erreicht man nur bei wenigen Fragen tatsächlich den Boden konkreter Schritte. Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, dass viele der kirchlichen Vorsätze und Hoffnungen eher als Utopien eines längst enttäuschten Sehnens erscheinen. Als teils meditativ wiederholte Worthülsen, die sich Jahr für Jahr erneuern – doch die Probleme bleiben die alten, werden möglicherweise kaschiert, um dann in unerwarteter Eindringlichkeit wieder an die Oberfläche gespült zu werden.
Bischofskonferenzen suchen das Ruder in zahlreichen Reform- oder synodalen Prozessen herumzureißen. Diese Projekte sollen einen Lichtpfad aus den dunklen (Kirchen-)Wegen dieser Tage leuchten. Bildlich werden sie auf diese Weise zu Hoffnungsschimmern im Leben vieler Menschen, die schon fast kein Vertrauen mehr in ihre Kirche haben. Als Kardinal Marx am ersten Adventsonntag, dem Beginn des „Synodalen Weges“ in Deutschland, die symbolische Kerze dieses Vorhabens anzündete, war dies wie eine Selbstverpflichtung: Man möchte sich zumindest im deutschen Bischofskollegium auf eine offene und dennoch möglichst verbindliche Richtungsänderung angesichts der kirchlichen Missbrauchsfälle, aber auch aufgrund immer größer werdender Entfremdung vieler Menschen von der Kirche einschwören. Doch der Start dieses Weges verlief holprig. Bereits in der Vorbereitungszeit distanzierten sich einige Oberhirten vom Vorhaben ihrer Amtsbrüder.
Einigkeit auf dem gemeinsamen Weg sieht wahrlich anders aus, doch lassen viele der kirchlichen Entscheidungsträger keinen Zweifel daran, dass dieser Weg gegangen werden muss. Zwei Jahre soll er dauern. Welche Ergebnisse am Ende stehen, lässt sich nicht sagen. Hoffnungen, Erwartungen, Befürchtungen, ja sogar Drohungen gibt es zur Genüge. Die Initiatoren des Weges halten nichtsdestotrotz an ihrem Vorhaben fest, erfahren bei vielen Teilen der Gläubigen und auch der Theologie viel Rückenwind.
Nicht nur in Deutschland hat sich das Bewusstsein durchgerungen, dass die katholische Kirche an einem Scheideweg steht. Es könne nicht mehr beliebig viele Reformversuche geben, ohne dass die Kirche das letzte Quantum ihrer eigenen Glaubwürdigkeit einbüße. Die Fassade, die viele traditionalistische Kreise in einer Abkehr von den aktuellen Problemen hin zu einer idealisierten Vergangenheit retten wollen, bröckelt bereits zu lange. Der wehmütige Blick in die wohlige Wärme eines gemütlichen, unhinterfragten Kulturkatholizismus – wenn es ihn denn jemals gegeben hat – wirkt illusionär, ja ignorant, weil er jene Menschen aus dem Blick verliert, die gegenwärtig unter dem Versagen der Kirche leiden.
„Wie lange denn noch?“, das fragen etwa Missbrauchsopfer, die immer noch um Gerechtigkeit für ihr erlittenes Leiden kämpfen. Ebenso Menschen, die unter den Folgen einer kolonialistisch angehauchten Wirtschaftsausbeutung leiden; Generationen, die der Zerstörung ihres zukünftigen Lebensraumes ins Auge blicken müssen oder nicht zuletzt unzählige Frauen, die in ihrer Kirche immer noch um eine Gleichbehandlung kämpfen. Ja, all diese Menschen – und noch zahlreiche mehr – verbieten den Blick „zurück“. Sie fordern die Handlungsbereitschaft Jesu eindringlicher Botschaft, auf die sich die Kirche(n) berufen. In ihnen schreit die menschliche Ungerechtigkeit zum Himmel, gleichzeitig aber drängen diese Schicksale auch die Kirche(n), ernsthaft über ihren Weg nachzudenken.
Man wird nicht einfach sagen können, wann tatsächlich der Zeitpunkt einer „letzten Chance“ gekommen ist, aber man erkennt aus den mitunter panischen Maßnahmen und Reaktionen innerhalb der Kirchenleitung durchaus, dass dieses Szenario bereits wie ein Damoklesschwert über der Kirche hängt.
Sich der Menschen annehmen
Plötzlich geht es dann nicht mehr um das institutionelle Überleben der Kirche als Religionsgemeinschaft. Hier stehen vielmehr die Grundhaltungen des Evangeliums von Glaube, Hoffnung und Liebe selbst infrage. Diese Brisanz wird zu einer Richtungsentscheidung der kirchlichen Berufung: Man wird gezwungen, im Angesicht der eigenen Glaubwürdigkeitskrise noch deutlicher zu den gegenwärtigen Problemen Stellung zu beziehen, um nicht die anvertraute Botschaft zu verspielen. Die Frage nach der Authentizität der Kirche wird nicht in den sicheren Räumen sakraler (Selbst-)Beweihräucherung oder theologischer Abschottung entschieden, sondern auf dem harten Boden geschichtlicher und gesellschaftlicher Glaubwürdigkeit.
Die zahlreichen Bruchlinien, an denen sich die Kirche gegenwärtig abzuarbeiten hat, führen sie selbst auf ihren eigenen Auftrag zurück: Sie hat sich der Menschen anzunehmen, zu denen sie gesandt ist. Kirche ist in sich kein Selbstzweck, sondern sie hat als Werkzeug der Liebe Gottes den Menschen beizustehen. Sie ist immer wieder dazu aufgerufen, in ihren eigenen Grenzen an Momenten der Hoffnung zu arbeiten. Diese Wege führen sie hinaus aus den abgesteckten Wegen vorgefertigter Lösungsmodelle. Diese Berufung fordert, selbst in Zeiten, an denen die Nacht am kältesten und dunkelsten erscheint, Lichter des Heiles und der Zuversicht zu entzünden.
Der Autor ist Theologe und Pädagogischer Mitarbeiter des Katholischen Bildungswerkes der Erzdiözese Salzburg.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!