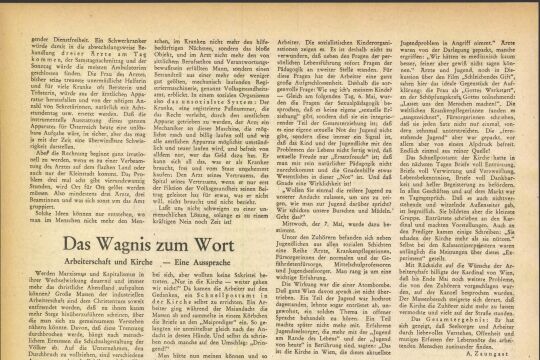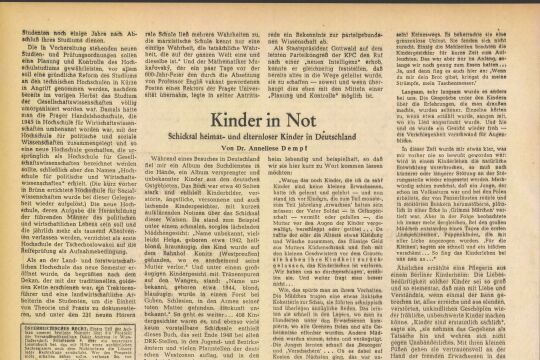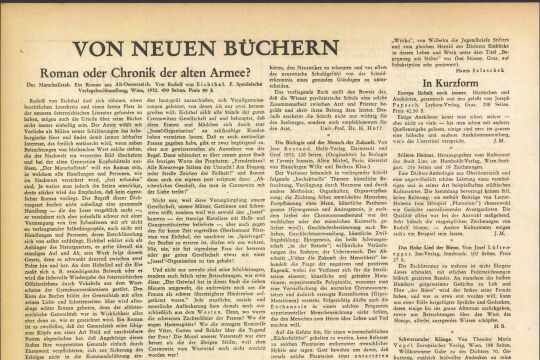FRAUEN im Krieg
Die Frauen im Hinterland hielten ihre "Alltagsgeschichte" selten schriftlich fest. Auch, um die Männer im Krieg nicht zu belasten.
Die Frauen im Hinterland hielten ihre "Alltagsgeschichte" selten schriftlich fest. Auch, um die Männer im Krieg nicht zu belasten.
In einer pointierten Erzählung aus dem Jahr 1918 mit dem Titel "Rückkehr" schildert Alfred Polgar das Schicksal eines Straßenbahnschaffners - und seiner Frau. Vor dem Krieg war dessen zwölf- oder mehrstündiger Dienst hart gewesen, das Privatleben allerdings bot Entschädigung. Kam er nach Hause, brachte seine Frau ihm die Pantoffeln, stopfte ihm die Pfeife und lieh ihm ihr bewunderndes Ohr für seine Erzählungen: "Man war zwölf Stunden Sklave draußen, aber dann zwölf Stunden Herr daheim." Als er aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrt, kommt auch seine Frau gerade nach Hause - von ihrer Arbeit als Straßenbahnschaffnerin. Hunderte Frauen, erzählt sie dem Verblüfften, seien nun als Schaffnerinnen tätig. Sie zieht sich die Pantoffeln selbst an und erzählt von ihrem anstrengenden Dienst. Als er seinerseits aus Sibirien berichten will, muss er feststellen, dass sie vor Erschöpfung eingeschlafen ist. "Sein Königtum war abgeschafft. Wie das russische", scheint es dem Heimkehrer. Was die Frau betrifft, schildert Polgar jedoch keineswegs einen emanzipatorischen Triumph. Sie übernimmt das Königtum nicht, dessen Insignien - die Pantoffel - sie mehr selbstvergessen als usurpatorisch überstreift. Niemand kümmert sich um ihr leibliches Wohl, niemand schenkt ihr Bewunderung. Alles, was ihr der neue Beruf - neben ihrem alten als Hausfrau und Mutter - bringt, ist völlige Erschöpfung. Heute würden wir es Dreifachbelastung nennen.
Emanzipation der Frau
1919 nimmt sich ein anderer großer Schriftsteller der Schaffnerinnen an. D. H. Lawrence beschreibt in seiner Erzählung "Tickets, Please!" die jungen Damen als kaltblütig "wie alte Unteroffiziere". Furchtlosen Seefahrern gleich rasen die mit ungewohnter Autorität Ausgestatteten in den Tramwaywaggons dahin. Nun gibt es da einen Kontrolleur, der sich mal mit dieser, mal mit jener Schaffnerin einlässt, nur um sie stets bald wieder abzuservieren. Irgendwann reicht es den Frauen und sie locken den Casanova in eine Falle. Sie schlagen ihn zu Boden und zwingen ihn, sich für eine von ihnen zu entscheiden. Die jedoch, auf die seine Wahl fällt, will ihn gar nicht. Nun beschließen sie, selbst zu wählen: Wer will ihn? Doch keine meldet sich, und während der Gedemütigte von dannen zieht, ordnen sich die Mädchen die Haare, "als hätte er niemals existiert."
Die herrlich sarkastische Geschichte zeigt die volle Bandbreite an männlichen Ängsten: Erst erlangen die Frauen Autorität im Beruf. Schon sind sie nicht mehr bereit, im Liebesleben die Opferrolle einzunehmen. Sie solidarisieren sich und werden handgreiflich, ja brutal. Sie kommen auf die Idee, ihr erotisches Gegenüber selbst wählen zu wollen. Am Ende stellen sie fest, dass sie den Mann gar nicht brauchen.
Die beiden von männlichen Autoren verfassten Erzählungen fokussieren auf die (befürchteten) Auswirkungen weiblicher Berufstätigkeit auf die männliche Würde. Wie die Schaffnerinnen sich selbst sahen, darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Wahrscheinlich fehlte ihnen die Zeit, über ihre so aufsehenerregende Tätigkeit schriftlich zu reflektieren. Oder lag es an etwas anderem?
Der 1. Weltkrieg stellte die Geschlechterrollen auf den Kopf - teils vorübergehend, was den Einsatz von Frauen in bestimmten Berufen betraf, teils dauerhaft, wie im Falle des Wahlrechtes, das für Frauen in Österreich 1919 eingeführt wurde. Tramwayfahrerinnen gab es übrigens weder hier noch dort: Diesen verantwortungsvollen Posten besetzte man mit Männern, die für den Kriegsdienst untauglich (geworden) waren - mit "Krüppeln und Buckligen", wie es Lawrence formuliert.
Die Entfremdung im Krieg
In meinem 1922 angesiedelten Roman "Eisflüstern" war es mein Anliegen, die elementare Entfremdung zwischen Front und Heimatfront am Beispiel eines Paares, das durch den Krieg auf Jahre getrennt worden war, auszuloten. Bei den Recherchen stellte sich, was das Ausmaß der Verschriftlichung der Jahre 1914-1918 durch Zeitzeugen betraf, ein mehrfaches Übergewicht heraus: der Front gegenüber dem Hinterland, der Männer gegenüber den Frauen, der oberen gesellschaftlichen Schichten gegenüber den ärmeren, ungebildeteren. Neben allgemeinen gesellschaftlichen Gründen (Frauen schrieben generell weniger als Männer, die Unterschiede im Bildungsniveau waren generell größer als heute) scheint dies vor allem zwei Gründe zu haben: Der erste ist durchaus praktisch, nämlich die Tatsache, dass es im militärischen Geschehen immer wieder Leerlauf gab. Warten auf Befehle oder Transporte, Ausharren im Schützengraben, in Gebirgsstellungen, erst recht in der Kriegsgefangenschaft. Auch die Frauen im Hinterland mussten viele Stunden mit Warten zubringen, und zwar in den Schlangen, in denen sie sich um Lebensmittel oder Kohle anstellten. Aber dabei schrieb man nicht viel.
Der zweite und wahrscheinlich wichtigste Grund ist das, was der Militärhistoriker Manfried Rauchensteiner den "Kampf um die Erinnerung" nennt. Man wollte, dass das Ungeheuerliche des Erlebens, das Leid und die tausenden Toten, nicht in Vergessenheit gerieten. Ernst Jünger, Edlef Koeppen, Erich Maria Remarque, Arnold Zweig, Heimito von Doderer, Jaroslav Hasek, Alexander Lernet-Holenia und viele weniger Berühmte fassten ihre Kriegserfahrungen in Bücher. Daneben gibt es informellere Aufzeichnungen, Tagebücher, Feldpost. Die Strategie des Hinterlandes, wo es ebenfalls Leid und durch Hunger, Krankheit und Seuchen viele Tote gab, war dagegen eher die Verdrängung. Die männlichen Verwandten im Feld wollte man durch das Schildern eigener Sorgen in Briefen zumeist nicht belasten.
Soziale Unterschiede im Hinterland
Die Front hatte etwas Egalisierendes, Offiziersprivilegien wurden im Kriegsgeschehen oft hinfällig. Kam tagelang kein Nachschub an Lebensmitteln, kam er für niemanden, musste man bei starkem Regen im Schützengraben bis zur Brust im eisigen Wasser stehen, mussten dies alle. Trommelfeuer und die Schreie Schwerverwundeter hörten sich für alle Ohren gleich an. Dagegen wurden soziale Unterschiede im Hinterland während des Krieges erst recht wirksam. Die Frauen, die Tag für Tag um das Überleben ihrer Kinder kämpften, die in den Munitionsfabriken oder am Feld schufteten und für jedes Stück Brot und jeden Schluck Milch unendliche Mühsal auf sich nehmen mussten, waren nicht die Frauen, die schrieben. Der ganze Jammer der Elendsquartiere und Flüchtlingslager wurde von den Betroffenen kaum je in Worte gefasst. Die Frauen wiederum, die schrieben, Berta Zuckerkandl etwa oder Rosa Mayreder, gehörten einer Schicht an, die sich zwar politisch durchaus engagiert zu äußern wusste, aber an realer Alltagsnot wohl am wenigsten zu leiden hatte. Denn während die Massen hungerten und froren, war über Schleichhandel und Schwarzmarkt zu Wucherpreisen fast alles zu bekommen. Wie ließen die Wohlhabenden die für den Alltag nötigen Waren beschaffen, wie schmuggelten die Lieferanten sie an den alles requirierenden Behörden vorbei? Dinge, über die man nicht schrieb.
Auch die Wissenschaft interessierte sich bis in die 1980er-Jahre kaum für das Hinterland, erst mit dem Aufkommen der Gender Studies begann man die "Alltagsgeschichte" im Ausnahmezustand näher zu erkunden. Die Auswirkungen von Trommelfeuer auf die Psyche der Soldaten waren analysiert - aber was bedeutete es für Mütter, jahrelang zu hungern, um den Hunger ihrer Kinder zu lindern, nur um sie zu Kriegsende an die Spanische Grippe zu verlieren?
Die Abwesenheit der Männer war es, was Frauen nie dagewesene berufliche Einsatzgebiete eröffnete, die Not und der Hunger aber waren es, was sie schließlich auf die Straßen brachte und nachhaltig politisierte.
Die Autorin lebt als freie Schriftstellerin in Wien
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!