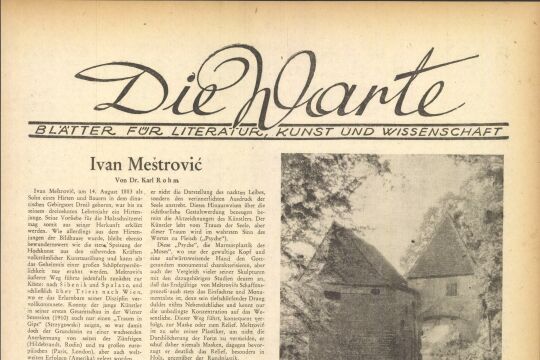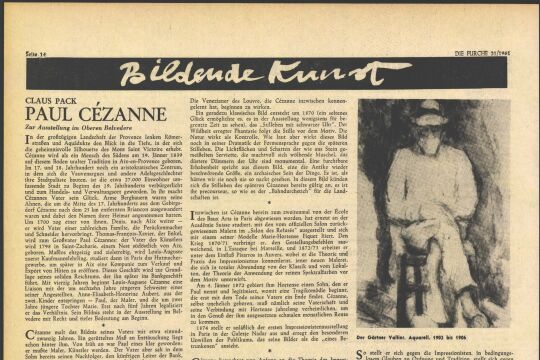Der 20. November ist der Internationale Tag des Kindes. Wie sich die Wahrnehmung von Kindern gewandelt hat, lässt sich an ein paar Streiflichtern der Kunstgeschichte zeigen.
Christoph Kolumbus hat nur Amerika entdeckt – ich habe das Kind entdeckt“, schrieb Victor Hugo. Ein schöner Ausspruch für die Wertschätzung des Kindes, historisch gesehen allerdings eine Übertreibung, denn bildende Künstler hatten das Kind bereits Jahrhunderte vor dem französischen Schriftsteller als faszinierendes Motiv entdeckt, an dem sie sich malerisch abarbeiten konnten. Dabei haben sie vor allem ein Kind dargestellt: das göttliche. Es ist in erster Linie der kleine Jesusknabe, im spielerischen Dialog mit Johannes oder am Schoß seiner Mutter Maria, der die Kunstgeschichte des Abendlandes dominiert. Allerdings wird das göttliche Kind in Buchmalereien des Frühmittelalters als kleiner Erwachsener ohne kindliche Proportionen gezeigt, denn für damalige Menschen war die Geschichte ein ausgedehnter Raum. Und das Christuskind stand stellvertretend für alle anderen Kinder. Für Darstellungen nicht-göttlicher Kinder gab es schlichtweg keinen Grund, denn offenbar war, wie Philippe Ariès in seiner „Geschichte der Kindheit“ mutmaßte, in jener „Welt kein Platz für das Thema Kindheit“.
Ganz anders finden sich Kinder auf Renaissancebildern dargestellt: Jetzt zieht der Jesusknabe den Blick auf sich, weil er hier als Kind in all der kindlichen Natürlichkeit auftritt, wie an einem winzigen, aber fantastischen Bild der Wiener Albertina zu sehen ist. Es ist eine auf Pergament gemalte Miniatur von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1493, die offenbar als Neujahrsgrußkarte gedacht war. Das Bild zeigt ein Kleinkind, ganz allein vor einer Fensternische in einem weißen durchsichtigen Hemdchen mit roten Backen und hoher Stirn. In beiden Händen hält es spielerisch einen goldenen Ball. Dass es sich dabei um kein Spielzeug, sondern um die Weltkugel handelt und somit eine zutiefst religiöse Botschaft transportiert, wird spätestens durch den Titel unübersehbar, denn der lautet: „Der Jesusknabe als Erlöser.“
Spielende Menschenkinder
Nicht mit dem göttlichen, sondern mit dem verspielten Kind befasst sich eines der ungewöhnlichsten Bilder des Wiener Kunsthistorischen Museums. „Kinderspiele“ von Pieter Bruegel dem Älterem aus dem Jahr 1560 könnte ein Vorläufer der beliebten „Wimmelbilderbücher“ sein. Der Hauptplatz mit dem Rathaus, die große Straße, die Wiesen, der Fluss – alles wird von über 230 Kindern eingenommen. Und diese tun nichts anderes als spielen. Steckenpferd reiten, Auf-dem-Kopf-Stehen, Sandspielen, Seifenblasen, Topfschlagen, Verstecken. Über neunzig, zum Teil auch heute noch aktuelle Kinderspiele, hat Bruegel gemalt. Die meisten Kinder kommen ohne Spielzeug aus. Vielmehr verwenden sie Dinge, die ohnehin im Alltag vorhanden sind: Holzstücke, Bäume, Schnüre und Mützen. Besonders überzeugend ist, dass Bruegel die Welt der Spiele nicht idealisierend schildert, dafür aber mit ungemein viel Humor. So erkennt man auf einer Szene Kinder, die mit einem Stecken in Kot herumrühren, während andere sich gerade heftig in die Haare geraten. Es ist ein Bild, das Friedrich Schiller gefallen haben müsste, denn der Schriftsteller schrieb dem Spieltrieb 1795 in seiner „Ästhetischen Erziehung des Menschen“ schöpferische und versöhnliche Bedeutung zu: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“
Das 18. Jahrhundert war auch jene Epoche, in der sich in der bildenden Kunst eine weitere Wende in der Darstellung von Kindern vollzog. Porträtmaler malen Kinder jetzt nicht mehr in ihren Repräsentationsaufgaben, dafür aber häufig mit ihren Spielzeugen. Zugleich räumen sie der Landschaft im Hintergrund als Freiraum, in dem Heranwachsende sich entfalten können, immer größeren Raum ein. Kinder werden als lebenslustige, eigenständige Wesen porträtiert, die ihre eigene Welt haben und nicht bloß für den Erwachsenen posieren. So wie auf Josef Danhausers Gemälde „Das Kind und seine Welt“ (1839), das in der aktuellen Ausstellung des Wien Museums hängt und ein Kind zeigt, das inmitten von Spielfiguren, Büchern und einem schlafenden Hund ungezwungen auf einem Sessel lümmelt. Es blickt verträumt lächelnd in die Höhe, ohne sich um die Betrachter zu kümmern.
In unmittelbarer Nähe zur Danhausers Ölgemälde findet sich im Wien Museum derzeit aber ein Bild, das einen ganz anderen Blick auf Kindheit wirft. Es stellt einen Buben dar, der in Wien bei eisiger Kälte Brezeln verkauft. Peter Fendis Ölgemälde aus dem Jahr 1828 mit dem Titel „Der frierende Brezelbub vor der Dominikanerbastei“ stellt Kindheit nicht wie so oft in der Kunst als ideale Daseinsform dar. Vielmehr weist es auf reale Zustände hin, zeigt Armut und die Ausbeutung von Kindern. Das Gemälde entstand in jenen Jahren, in denen Arbeitslosigkeit und Massenarmut in Wien nicht mehr zu übersehen waren und erstmals auch öffentlich als Problem zugegeben werden mussten.
Freude am kreativen Prozess
Auch das 20. Jahrhundert und seine Kunst sind vom Kind dominiert. Allerdings ging es Künstlern wie Pablo Picasso, Paul Klee oder Joan Miró nicht so sehr um das Motiv des Kindes, sondern vielmehr um die Auseinandersetzung mit der kindlichen Kreativität. So behauptete Pablo Picasso: „Ich konnte schon früh zeichnen wie Raffael, aber ich habe ein Leben lang dazu gebraucht, wieder zeichnen zu lernen wie ein Kind.“ Picasso hat zeitlebens Kinder gemalt, gezeichnet oder in Skulpturen verewigt. Oft waren es seine eigenen wie Paloma, Claude, Paolo oder Maya. Besonders aber haben Picasso die kindliche Wahrnehmung und die spielerischen Denkmuster von Kindern interessiert. Immer wieder hat er versucht – was für Erwachsene nahezu unmöglich ist – mit unverbildeten Augen die Welt anzuschauen und die kindliche Bedeutungsperspektive einzunehmen. Ihre Art zu basteln, alltägliche Gegenstände zu Objekten zusammenzufügen, aber auch ihr einfaches Formenrepertoire wurden ihm für seine eigene künstlerische Arbeit vorbildlich. Man kann Künstlern wie Picasso, aber auch anderen Protagonisten der Moderne vorwerfen, die kindliche Kreativität vereinnahmt zu haben, um selbst neue Wege in der künstlerischen Entwicklung zu finden. Genauso wahr ist aber, dass diese Werke die Aufmerksamkeit für die unverwechselbare Ausdruckskraft von Kindern, für deren schöpferische Originalität und deren Freude am kreativen Prozess verstärkt haben.
Kinder als Motiv sind bis heute nicht aus der Kunst verschwunden. Eindrucksvoll spiegelt sich dies in dem Werk der Medienkünstlerin Marie-Jo Lafontaine. Wenn man eine Ausstellung von ihr besucht, so tritt man in einen Raum mit über zwei Meter großen Schwarzweißfotografien. Zu sehen sind die Gesichter und die unbekleideten Oberkörper von ganz unterschiedlichen Kindern. Ein blondes Mädchen mit Sommersprossen und blasser Haut, ein asiatischer Bub mit schwarzen Haaren, ein peruanisches Mädchen mit dunklen Augen. Jedes einzelne Kind zieht den Blick durch das auf sich, was es unverwechselbar macht; durch die Mimik, die Gestik – durch den schüchternen oder den mutigen Blick. Lafontaine weist durch die immer gleiche Darstellungsart auf die Verwandtschaft aller Kinder hin, egal welcher Herkunft und Ethnie. Zugleich betont sie die Individualität jedes heranwachsenden Menschen. Durch die Monumentalität, die Ernsthaftigkeit und die strenge Frontalität findet keine Verniedlichung des Kindes statt. Stattdessen sind es die Kinder, die die Erwachsenen anblicken und daran erinnern, welch ungemeine Verantwortung sie für die Welt haben, in der diese Kinder aufwachsen.
Der Text basiert auf den dieswöchigen „Gedanken für den Tag“ (16.–21. 11., 6.57 Uhr, Ö1).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!