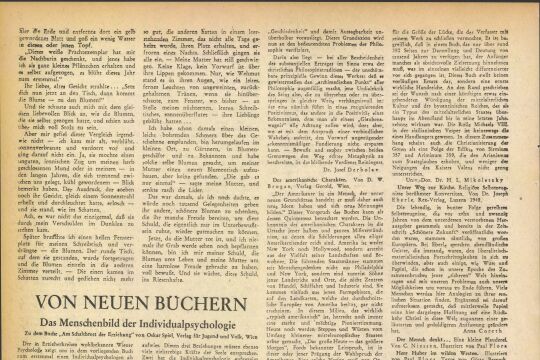Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das unzerstörte Kind kann alles“
Warum malen Kinder so gerne? Warum sind sie begeistert und beglückt von der Möglichkeit, zu gestalten, zu formen, mit dem Pinsel, der Farbe, dem Buntstift, der Kreide! Warum ist es so wichtig für ihre geistig-seelische Entwicklung, solcherart ihre Erlebnisse, Beobachtungen, Erfahrungen auszudrücken?
Diese Fragestellung ist nicht neu. Der italienische Kunsthistoriker C. Ricci hat sich schon gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts mit dem Problem des „Kunstcharakters der Kinderzeichnung“ befaßt. Später taten es ihm andere nach. Die Psychologie seit Freud versucht sich in Deutungen von Kinderzeichnungen. Es wurden dazu eigene Tests ausgearbeitet. C. G. Jung spricht davon, daß Seele Bild sei, und Bild Seele. Einer der ersten, der die auf diesem Gebiet aus der Philosophie und Psychologie sich ergebenden neuen Möglichkeiten der Pädagogik zuführte, war der Zeichenlehrer F. Cizek. Er gründete 1897 in Wien eine „Jugendkunstklasse“, in der die Kinder nicht so malen sollten, wie der Lehrer, sondern wie sie selbst es für richtig hielten. „Nichts lernen, nichts lehren, wachsen lassen aus der eigenen Wurzel“ war seine Devise.
Was damals eine Revolution bedeutete, beginnt heute langsam allgemeines Bildungsgut zu werden. Von der „Kunst des Kindes“ wird sehr viel gesprochen. Manche meinen sogar, zu viel, und verweisen auf formale Unzulänglichkeiten, auf die Unreife des Kindes und daß daraus auch kein reifes Kunstwerk entstehen könne. Wahrscheinlich jedoch ist die Frage: „Kunst oder nicht Kunst“ von vornherein falsch gestellt. Denn darum geht es ja im Grunde gar nicht. (Ganz abgesehen davon, daß der Begriff „Kunst“ einem ständigen Bedeutungswandel unterworfen ist). Es geht vielmehr darum, dem Menschen — in diesem Fall dem Kind — zu seiner größtmöglichen inneren Entwicklung zu verhelfen, seine eigentlichen Fähigkeiten zu erkennen, zu fördern, in dem Bewußtsein, daß jeder Mensch — und sei es der angeblich Unbegabte — über ganz bestimmte, einzigartige Fähigkeiten verfügt.
Als die von der Mitarbeiterin Cizeks (er starb 1946), Prof. Adelheid Schimitzek, weiter geführte Jugendkunstklasse im Jahre 1955 aufgelassen wurde, beauftragte das Landes-jugendreferat 1956 seinen kunstpädagogischen Berater Prof. Dr. Ludwig Hofmann mit der Weiterführung
dieses Unternehmens. Jetzt allerdings unter einem etwas veränderten, den modernen pädagogischen Einsichten entsprechenden Aspekt. Im Laufe der Jahre entstanden rund 30 solche Malklassen in den verschiedensten Wiener Bezirken und, als Krönung des Ganzen, im Jahre 1972 ein groß angelegtes, fünfwöchiges Kindermalen im Museum des 20. Jahrhunderts. Der Vorteil gegenüber den Malklassen: hier mußten die Kinder keine Rücksicht auf eventuell zu beschmutzende Gegenstände oder Böden nehmen. Der Raum war so eingerichtet, daß er ihnen maximale Mal- und Bewegungsfreiheit bot.
Der gegenwärtige Versuch, im „Zwanzigerhaus“ eine ähnliche Aktion zu starten, findet zwar im wesentlich kleineren Rahmen und mit wesentlich geringeren Mitteln statt, der Andrang mallustiger Kinder ist jedoch der gleiche: jeden Sonntag zu den festgesetzten Zeiten müssen grollende Eltern mit ihren Sprößlingen nach Hause geschickt werden, weil das Limit von 40 Kindern bereits überschritten ist. Prof. Hofmann, Leiter auch dieses Projekts, ist mit einer solchen Entwicklung nicht ganz einverstanden: „Wir wollen ältere Kinder heranziehen, dafür aber weniger“. Das Vorschulalter, so Hofmann, ist in dieser Hinsicht bereits gründlich unter-
sucht worden. Weniger oder kaum jedoch die Zeichnungen der 10- bis 15jährigen. Aber die hätten andere Interessen: Fußballspiel zum Beispiel, Kino und natürlich das Fernsehen. Hofmann, der im Ausland häufig Gastvorlesungen hält (in Österreich gibt es keinen Lehrstuhl für Kunstpädagogik), etliche kunstpädagogische Bücher veröffentlicht hat und „Kinderkunst“ in Ausstellungen präsentiert, sieht hier im Museum die Gelegenheit für die verschiedensten Experimente gekommen: mit Buntpapier, Glastafeln, die beidseitig zu bemalen sind, Collagen und vor allem mit entsprechenden
Farbmischungen, die über das einfache, an den Schulen gelehrte Spektrum hinausgehen und den Kindern die Möglichkeit bieten, Farbzusammenstellungen auszusuchen, die ihrer spezifischen seelischen Grundhaltung entsprechen. Aber dazu, sagt er, müsse er die augenblicklich zugelassene Zahl von 40 Kindern auf 20 beschränken, damit genügend Platz und Bewegungsfreiheit vorhanden sei und sich die insgesamt vier fachlich ausgebildeten Lehrerinnen in ausreichendem Maße um das einzelne Kind kümmern könnten.
Das Konzept wäre also vorhanden, die Realisierung ist vorläufig noch
nicht danach. Die kleinen (und kleinsten) Dreikäsehochs haben natürlich ihren Spaß daran: sie bepinseln die auf Wänden, auf dem Boden und auf langen Tischen ausgespannten Papierbögen, sie baden sich förmlich in Farbe — und das ist wörtlich gemeint: ihre Arbeitskleidchen und Hemdchen sind von oben bis unten bespritzt, manchmal fällt ein Farbtopf um und das Drei- bis Vierjährige patscht entzückt in der ausgeronnen Farbe.
Darin sieht Hofmann allerdings nicht Ziel und Zweck dieser Aktion: „Die Kinder müssen erst lernen, sich der Freiheit, die ihnen da geboten wird, zu bedienen.“ Und wie sieht das jetzt in der Praxis aus? „Freiheit ist Freiheit von etwas (also Zwang), und Freiheit für etwas“ zitiert Hofmann. Um die Beseitigung alter Hemmungen geht es hier in erster Linie allerdings nicht. Das hat die sogenannte antiautoritäre Erziehung bereits zur Genüge versucht. Es geht vielmehr um das neue Konzept, die neue Formel, das aufbauende Element. Und da bewegt sich die gesamte Pädagogik, also auch die Kunstpädagogik, vorläufig noch auf recht unsicheren Beinen. „Das Kind muß sich angenommen, es muß sich akzeptiert fühlen in seinem Tun“, sagt Ludwig Hofmann. „Es muß wissen: ich kann nichts schlecht machen. Wenn ich mit mir nicht zufrieden bin, nehme ich ein neues Blatt und versuche es noch einmal. Das Kind soll gar nicht in die Lage kommen, zu sagen: das kann ich nicht. Das naive, unzerstörte Kind kann alles.“
Zeichnungen von Kindern, die innerlich nicht angenommen, nicht bejaht werden, sehen, so Hofmann, elend aus. Denn so, wie sich der
Mensch in seiner Handschrift projiziert, so projiziert er sich auch in die Zeichnung. Hofmann geht es dabei um „urtümliche, archetypische Lösungen“. Je kleiner ein Kind ist, um so mehr kann es zeichnen. Je größer es wird, um so mehr ist es abhängig von Klischees: daß ein Dach rot sein, ein Schornstein rauchen muß. Daß Sterne gezackt zu malen sind und Berggipfel blau. Das Kind zeichnet mehr und mehr wie „man“ zeichnet, und immer weniger so, wie es selbst die Dinge sieht. Und schließlich, in der 6. oder 7. Mittelschulklasse, kann es das gar nicht mehr.
Das kleine Kind bringt sich selbst
in die Zeichnung, seine „existentielle Befindlichkeit“, wie Hofmann das nennt. Das größere Kind, der Erwachsene gar, haben diese Fähigkeit verloren. Muß das so, sein? Und hier nun ergeben sich Parallelen zur Kunst. Der Künstler ist in seiner individuellen Fähigkeit, die Welt zu sehen, sq stark, daß er sie durchsetzt und schließlich die allgemeine Auffassung dessen, was Kunst ist, entscheidend mitbestimmt. Nun kann nicht jeder Mensch das sein, was man „einen großen Künstler“ nennt, und soll es auch gar nicht. Aber er kann in seiner speziellen Begabung gefördert werden. Und daß hier große Möglichkeiten voran-den sind, daß viel ungenutztes Talent brachliegt, haben Versuche nicht nur an Kindern, sondern auch an Erwachsenen bewiesen. Hofmann sieht in diesem „existentiellen Zeichnen“ eine Ergänzung des formalistischen Schulzeichnens. Dem Kind müssen Grunderfahrunigen geliefert
werden, es muß den Farben, den Formen, den Gestaltungsmöglichkeiten begegnen. Vom Lehrer, so meint Hofmann, könne man natürlich keine psychoanalytischen Kentnisse erwarten. Aber er sollte wissen, daß „das Kind keine Tabula rasa ist“, daß man es nicht seelisch und geistig vergewaltigen darf, daß es vielmehr malend „zu sich selbst finden, seiner selbst innewerden soll“. Aus dieser Ichwerdung heraus soll dann die Daseinsbewältigung geleistet werden, durch sie soll das Kind soweit innerlich gefestigt werden, daß es mit 19 oder 20 Jahren der Welt in freien Entscheidungen begegnen kann.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!