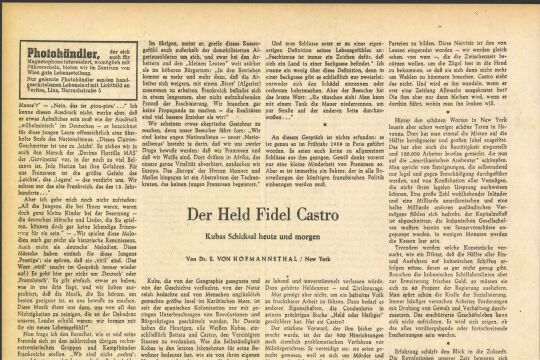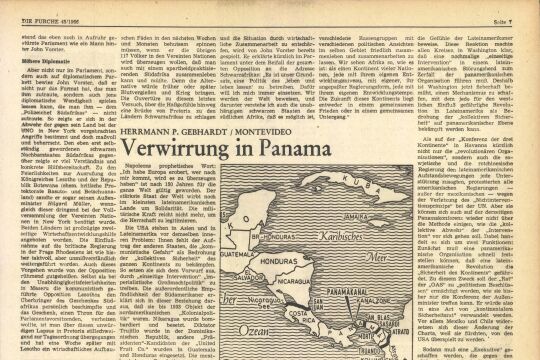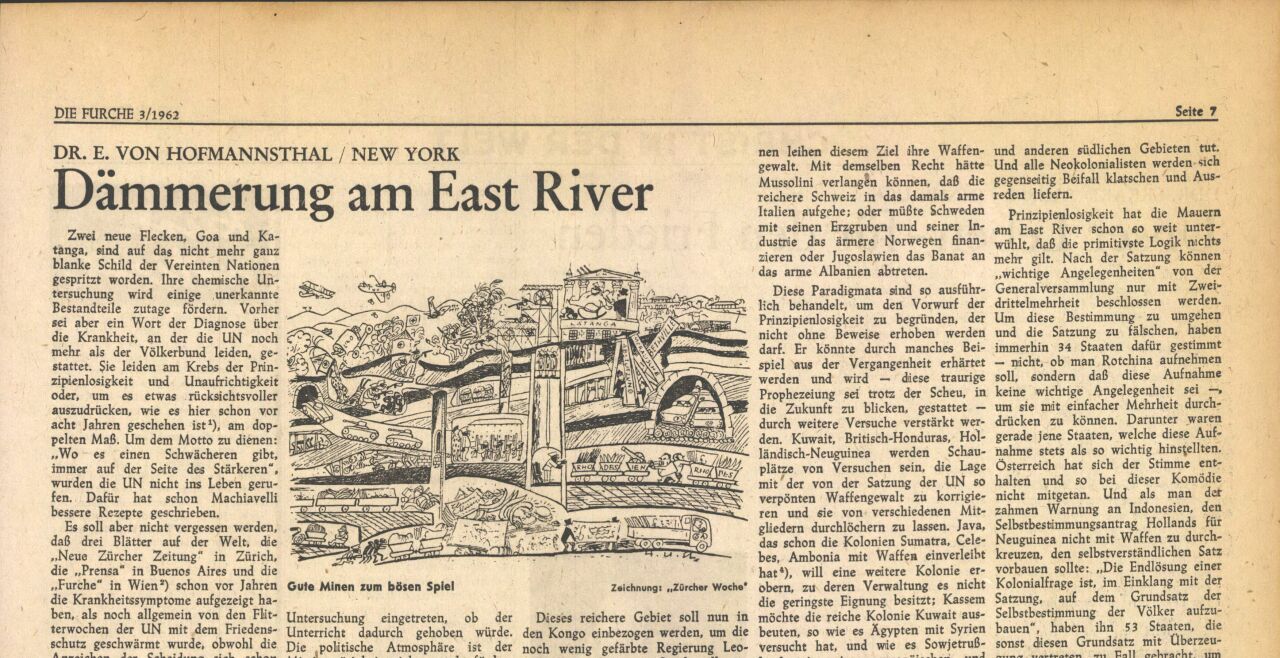
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vor Nachahmung wird gewarnt
Als Chruschtschow erklärte, er werde jeden Angriff der USA auf Kuba mit sowjetischen Raketen auf New York beantworten, traten die amerikanischen Außenminister im August 1960 zu einer Konferenz in Costa Rica zusammen. Sie verurteilten „jede, auch bedingte Interventionsdrohung einer extrakontinentalen Macht“ und erklärten, daß ihre „Annahme durch einen amerikanischen Staat die Solidarität und die Sicherheit des Kontinents gefährdet“. Aber alle Bemühungen Herters, sie zu Kollektivmaßnahmen gegen Castro zu veranlassen, scheiterten. Das „Nichtinterventions-prinzip“, mit dem Roosevelt 1933 seine „Politik der guten Nachbarschaft“ untermauerte, erwies sich wieder als unangreifbarer Leitsatz der inneramerikanischen Zusammenarbeit. Auch war die Stimmung in Lateinamerika Mitte 1960 so leidenschaftlich für Fidel Castro, daß kein Staatsmann es wagte, diesen „Volkshelden“ anzugreifen.
Zum Osten übergegangen
Nun hat sich die politische Situation Castros in den letzten 18 Monaten — seit der Konferenz von Costa Rica — stark verändert:
Er hat, wie man in Washington zusammenstellte, 72 Verträge mit Ostblockstaaten geschlossen, wickelt 80 Prozent seines Handels mit ihnen ab und unterhält durch ihre Militärhilfe von mindestens 60 Millionen Dollar ein supermodernes Heer von 250.000 Mann.
Kurz nach Castros Bekenntnis zum Kommunismus hat der kubanische Außenminister Raul Roa erklärt, daß Kuba „für immer“ zu der „zukünftigen sozialistischen Weltgesellschaft“ gehöre. Militärisch, politisch, wirtschaftlich und ideologisch ist also Kuba zum Osten übergegangen.
Nur einen Schritt hat Fidel Castro noch nicht getan, fcr ist nicht dem „Warschauer Pakt“, der aus Moskau dirigierten Militärallianz, offiziell beigetreten. Er hat sich sogar den Scherz erlaubt, als Mitglied der „OAS“ den „Interamerikanischen Verteidigungsausschuß“ um Mitteilung der letzten Verteidigungspläne zu ersuchen. Die Nachrichten über die Errichtung einer sowjetischen Raketenbasis in Kuba sind nicht bestätigt worden.
Vom Standpunkt der nordamerikanischen Machtpolitik aus ist es untragbar, einen Vorposten Moskaus auf dem amerikanischen Kontinent, noch dazu in der Nähe des Panamakanals, zu dulden.
Trotz aller Beteuerungen ihrer „panamerikanischen Solidarität“ identifizieren sich die lateinamerikanischen Regierungen nicht mit den machtpolitischen Interessen Washingtons. Das ist um so erstaunlicher, weil ihre Sicherheit völlig von den USA abhängt, erklärt sich aber aus dem politischen und wirtschaftlichen Antagonismus, der weiter zwischen Nord- und Südamerika besteht.
Für die lateinamerikanischen Regierungen gilt Castro nicht als Gefahr, weil er sich mit Moskau verbündet hat, sondern weil sie die Nachahmung seiner Revolution in ihren Staaten befürchten müssen. Castro sieht sich als „Befreier Lateinamerikas“ in seinem „zweiten Unabhängigkeitskampf“. In einem Interview (für die römische „L'Unitä“) erklärte er, er erwarte „gleichzeitige Revolutionen in mehreren lateinamerikanischen Ländern“, die „zu einer großen, freien und unabhängigen Nation führen“.
Die Schlacht um die 14. Stimme
Die Angst vor der castroischen Infiltration, die provozierenden Reden des Hysterikers Fidel Castro und der Einfluß der USA haben zusammen herbeigeführt, daß nunmehr 13 der 21 amerikanischen Staaten die diplomatischen Beziehungen zu Kuba (offiziell oder de facto) abgebrochen haben. Sie vertreten die „harte Linie“ auf der bevorstehenden Konferenz. Zu ihnen gehören nicht Brasilien, Argentinien, Mexiko und Chile.
Weiche Linie?
Eine „Einheitsfront“ für Sanktionen gegen Kuba kommt nicht zustande.
In Mexiko ist Castros Revolution — nach den eigenen Erfahrungen bei der Enteignung:%r Erdölquellen ;,u4!j} der Agrarreform.— so populär, daß keine Regierung gegen „Fidel“ stimmen kann. Dort sagt man, er müsse „in die amerikanische Familie zurückkehren“.
Der brasilianische Außenminister Santiago Dantas hat erklärt, nach seiner Auffassung stelle Kuba bei der augenblicklichen Situation keinen Herd der kommunistischen Infiltration dar, während „jede Unklugheit Castro gegenüber das Feuer dem Pulverfaß nähert“.
Brasilien, Argentinien, Chile und Uruguay hatten sich auf eine gemein^ same „weiche Linie“, die Ablehnung jeder Maßnahme gegen Castro, geeinigt. Der argentinische Präsident Dr. Frondizi soll aber seine Haltung nach dem kürzlichen Gespräch mit Kennedy gewechselt haben. Er will — wie jetzt auch Brasilien — die „panamerikanische Einheitsfront“ durch eine „mittlere Linie“ wahren.
Fidel Castro selbst nannte die bevorstehende Konferenz „mit ihrer feigen und erbärmlichen Verschwörung“ eine „Versammlung von Marionetten“.
Dr. „Che“ Guevara, Castros Wirtschaftszar, sagte auf der kürzlich abgehaltenen „Interamerikanischen Wirt-schaftskonferenz“ in Punte del Este: „Kuba ist die Henne mit den goldenen Eiern. Solange Kuba besteht, geben die Vereinigten Staaten.“
In der Tat fordern die lateinamerikanischen Regierungen schnelle Wirtschaftshilfe, als „einziges Mittel, im das Vorrücken des Castro-Kommunismus in Lateinamerika zu verhüten“, wie Dr. Frondizi an Kennedy schreibt. Man fragt, ob Washington durch einen Fehlschlag der Konferenz so verärgert würde, daß es Kennedys „Bündnis für den Fortschritt“ beiseite lege und die Zehn-Jahres-Entwicklungspläne nicht finanziere. Vor dem Sitzungssaal mag soviel über „Wirtschaftshilfe“ gesprochen werden wie in ihm über die Isolierung Kubas.
Die USA würden für sie gewiß einen hohen Preis zahlen. Denn der „sowjetische Brückenkopf in Amerika“ bedeutet — abgesehen von der militärischen Bedrohung — eine politische Provokation.
Der „Fall Kuba“ ist - wie der „Fall Berlin“ — von vitaler Bedeutung für das Prestige Washingtons im Ost-West-Konflikt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!