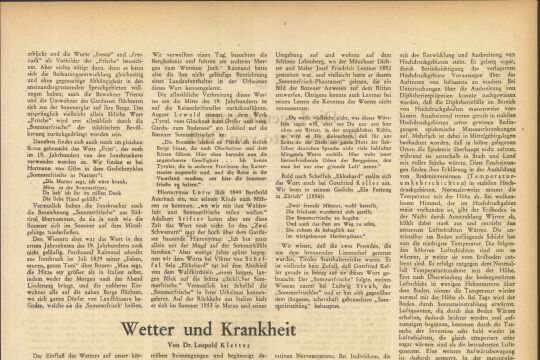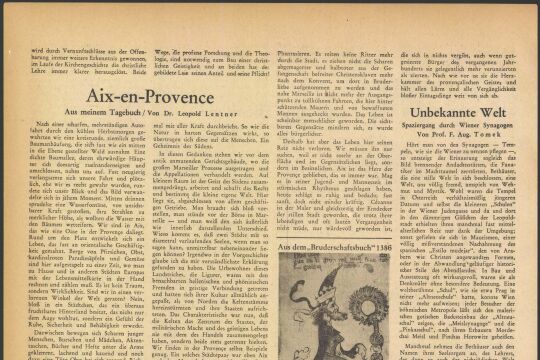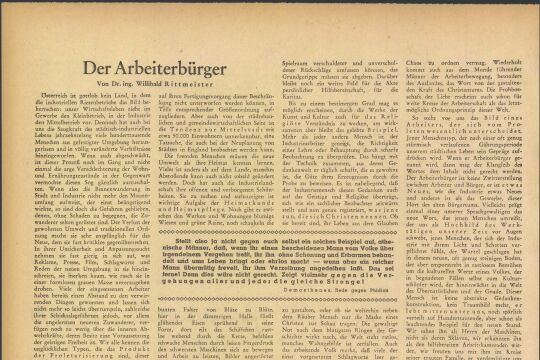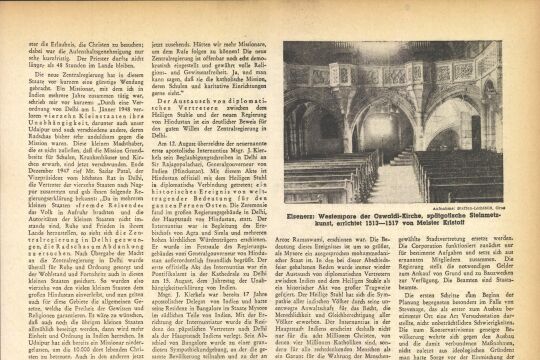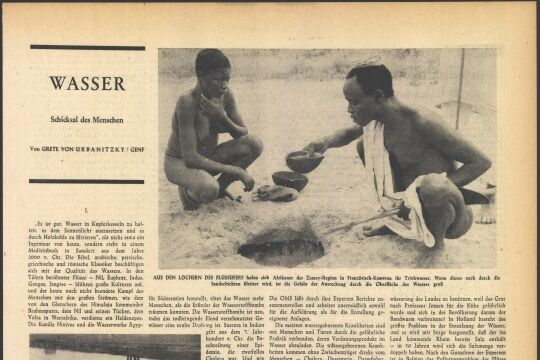Nun kommt das Scheusal also ins Kino: Jean-Baptiste Grenouille,
mörderische Wundernase, pathologischer Liebhaber des Dufts rothaariger, französischer Jungfrauen und Protagonist in Patrick Süskinds vielgerühmtem Roman "Das Parfum" (siehe Filmkritik Seite 23). Dass die Welt der Düfte faszinierend ist, weiß man freilich nicht erst seit Süskinds literarischem Wurf. Ob frisch oder fäkalisch, synthetisch oder natürlich: Gerüche prägen das menschliche Befinden. Ein Dossier über den unterschätztesten Sinn.
Redaktion: Doris Helmberger
Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die Küchen nach verdorbenem Kohl und Hammelfett; die ungelüfteten Stuben nach muffigem Staub, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach feuchten Federbetten und nach dem stechend süßen Duft der Nachttöpfe. Aus den Kaminen stank der Schwefel, aus den Gerbereien stanken die ätzenden Laugen, aus den Schlachthöfen stank das geronnene Blut. (...) Es stanken die Flüsse, es stanken die Plätze, es stanken die Kirchen, es stank unter den Brücken und in den Palästen."
Ein derart eindringliches Geruchspanorama, wie es Patrick Süskind gleich zu Beginn seines Romans "Das Parfum" vor unseren Nasen ausbreitet, mag für viele Städte des ausgehenden 18. Jahrhunderts charakteristisch gewesen sein. Zwischen den engen, dichtbevölkerten Häusermassen war der Gestank schier allgegenwärtig - besonders in einer Großstadt wie Paris, der mit mehr als 500.000 Einwohnern größten Metropole des Kontinents.
Pesthauch und Blütenduft
Die Wahrnehmung und Bewertung dieser Gerüche begann sich in jener Zeit, wie der französische Kulturhistoriker Alain Corbin in seinem mittlerweile zum Standardwerk gewordenen Buch "Pesthauch und Blütenduft" gezeigt hat, entscheidend zu wandeln. Denn immer lauter wies auch die Wissenschaft darauf hin, dass die verdorbene Luft für die überdurchschnittlich hohe Sterblichkeitsrate in den Städten verantwortlich sei. Die sich neu herausbildende Lehre der Stadthygiene sprach von einem giftigen "Brodem", den zu "trinken" die Bevölkerung ständig genötigt sei. Stadtluft mache nicht frei, wie es so gerne hieß, sondern krank.
Dabei waren es vor allem die aus dem Boden aufsteigenden fauligen Dünste (Miasmen), von denen nach Meinung der Zeitgenossen die größte Gefahr ausging. Sie erschütterten das labile Kräftegleichgewicht im Inneren des Körpers, führten früher oder später zu Krankheit und Tod. Unangenehme, stinkende Gerüche wurden demzufolge als Bewegung vom Tod zum Tod empfunden, während im Gegensatz dazu aromatische Wohlgerüche eine Stärkung der Lebenskräfte bewirken sollten. Sämtliche Abfälle, Exkremente und Kadaver wurden vom Boden wie ein Schwamm aufgesogen und in Form von giftigen Dämpfen wieder abgegeben. Der dampfende Boden war, so Corbin, mit Sicherheit einer der größten Alpträume jener Zeit. Ihm galt es mit der Nase nur ja nicht zu nahe zu kommen.
Aber auch die Umgebung der Flüsse, in die meist sämtliche Abfälle und Abwässer der Stadt entsorgt wurden, galten als olfaktorische Gefahrenzonen. Bestätigt wurden die Befürchtungen und Ängste nicht zuletzt durch regelmäßig ausbrechende Krankheiten und Seuchen. Nur allzu gut waren den Menschen noch die Verheerungen der Pest in Erinnerung (in Wien zuletzt 1713/14).
Desodorisierter Raum
Nun tauchte eine neue Seuche auf: die aus Indien kommende Cholera. 1830 erstmals unvermutet in Europa ausgebrochen, forderte sie in fast allen Großstädten das ganze 19. Jahrhundert hindurch tausende Opfer. Ihre Verbreitung schrieb man in erster Linie den aus verseuchten Gewässern aufsteigenden Miasmen zu.
All dies bewirkte, dass sich eine geschärfte Sensibilität gegenüber dem Gestank herausbildete - getragen und verbreitet vor allem vom Bürgertum, das mit seinen Vorstellungen von Ästhetik, Sauberkeit und Moral das urbane Leben entscheidend beeinflusste. Strategien zur hygienischen Neuordnung der Städte wurden entwickelt, bei denen die geruchliche Reinigung und Desodorisierung des öffentlichen Raumes eine wesentliche Rolle spielte.
Die Beherrschung der urbanen Geruchsemanationen geriet zum Brennpunkt des Kampfes der städtischen Zivilisation mit der als unberechenbar geltenden Natur. Nun ging es darum, Riechendes nachhaltig zu kontrollieren und sowohl im Städtebaulichen wie auch im Sozialen wirksame Maßnahmen der Regulierung und Disziplinierung zu setzen. Egal ob in Paris, Berlin oder Wien - die ergriffenen Desodorisierungsmaßnahmen waren stets die gleichen. Vordringlichstes Anliegen war zunächst die Errichtung eines dichten und weit verzweigten Kanalnetzes, das den bedrohlichen Gestank der Kloaken in den Untergrund verbannte; Flüsse wurden kanalisiert und zum Teil überwölbt, Straßen durch Pflasterung abgedichtet und regelmäßig gereinigt. Man errichtete öffentliche Bedürfnisanstalten, führte eine regelmäßige Müllabfuhr ein und verbesserte die Luftzufuhr durch den Abbruch der Stadtmauern und die Anlage von geraden Straßen und großen Plätzen. In Bewegung halten, zirkulieren, lautete das oberste Gebot der Gesundheitsbehörden, die besonderes Augenmerk auf die ausreichende Durchlüftung und Ventilation der Stadt legten.
"Miasmatische Infektion"?
Besonders stinkende Gewerbebetriebe wurden verboten, die Fabriken mit immer höheren Schloten ausgestattet und zunehmend an die Peripherie verlagert, ebenso wie die Mülldeponien und Friedhöfe. Innerstädtische Parks und Grünanlagen oder großzügige Wald-und Wiesengürtel wurden als Frischluftreservoirs angelegt. Entmischung, auch im geruchlichen Sinne, lautete die nunmehrige Leitlinie der funktional orientierten Stadtplanung.
Wie bedürftig die leidgeprüfte Nase des Großstädters mittlerweile war, belegt die Äußerung eines Wieners, der sich 1873 über die Geruchskollisionen im neu errichteten Stadtpark beiderseits des Wienflusses empörte: "Todte Tiere, Schlamm und Kehricht aller Art erscheinen am Ufer und mengen ihre Dünste mit den Wohlgerüchen der Rosen vor dem Cursalon. Der von der Hitze ermattete Wiener, welcher dort etwas Erholung und frische Luft zu finden hofft, athmet mit jedem Zuge giftige Miasmen ein."
Die Theorie der "miasmatischen Infektion" hielt sich, obwohl zunehmend umstritten, äußerst hartnäckig. Erst die mikrobiologischen Entdeckungen Louis Pasteurs widerlegten Ende des 19. Jahrhunderts endgültig die Gefährlichkeit der Miasmen (Koch entdeckt 1883 den Cholera-Erreger, Gaffky 1884 den Typhus-Bazillus). Die Versicherung der Gelehrten, dass ansteckende Keime für die Weitergabe von Krankheiten verantwortlich seien, brachte zunehmend eine - auch mentale - Trennung von schlechtem Geruch und Krankheitsgefahr. Allmählich setzt sich auch außerhalb wissenschaftlicher Kreise die Erkenntnis durch, dass nicht alles tötet, was stinkt, und nicht alles stinkt, was tötet.
Nichtsdestoweniger blieb der Geruch aber weiterhin ein wesentliches Mittel der sozialen Identifikation und Abgrenzung zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten. Schon der Philosoph Georg Simmel, einer der sensibelsten Beobachter des Wandels großstädtischer Sinneswahrnehmung, notierte über diesen zentralen soziologischen Aspekt des Riechens: "Daß wir die Atmosphäre jemandes riechen, ist die intimste Wahrnehmung seiner, er dringt sozusagen in luftförmiger Gestalt in unser Innerstes ein, und es liegt auf der Hand, daß bei gesteigerter Reizbarkeit gegen Geruchseindrücke überhaupt dies zu einer Auswahl und einem Distanznehmen führen muß." Für Simmel war die gestiegene Sensibilität für Gerüche eine wesentliche Ursache für die Distanziertheit des modernen Individuums.
"Kumpanen des Gestanks"
Die Nase fungierte als entscheidendes Distinktionsorgan, das sozialen Abstand von jenen Menschen forderte, deren räumliche Nähe man zu meiden trachtete. Sie wurden für stinkend erklärt und gesellschaftlich stigmatisiert. Dies traf auf Kranke, Gefangene, Bettler und Obdachlose ebenso zu wie auf Angehörige jener Berufsstände, die übel riechende Arbeiten verrichteten wie Lumpensammler oder Kanalräumer. Das Urteil der Nase über diese "Kumpanen des Gestanks" wurde letztlich auf alle Angehörigen der sozialen Unterschicht ausgedehnt. Peter Altenberg bemerkte einmal ironisch: "Edlere Frauen sollten unbedingt immer in der Natur bleiben oder in der heiligen Einsamkeit ihres Zimmers. Überall sonst stinkt es!"
Der Erfolg der weit reichenden hygienischen und städtebaulichen Maßnahmen sprach in den meisten Fällen für sich: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte man bereits wieder durch zahlreiche Großstädte flanieren, ohne sofort von üblen Ausdünstungen überwältigt zu werden. Wenngleich paradoxerweise gerade in jener Zeit ein neuer Gestankserreger auftauchte, der fortan die Stadtluft prägen sollte: das Automobil.
Der Autor ist
Historiker und Stadtforscher in Wien (vgl. www.stadt-forschung.at). 1997 veröffentlichte Peter Payer das Buch "Der Gestank von Wien. Über Kanalgase, Totendünste und andere üble Geruchskulissen" (Döcker Verlag, Wien), das zur Zeit leider vergriffen ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!