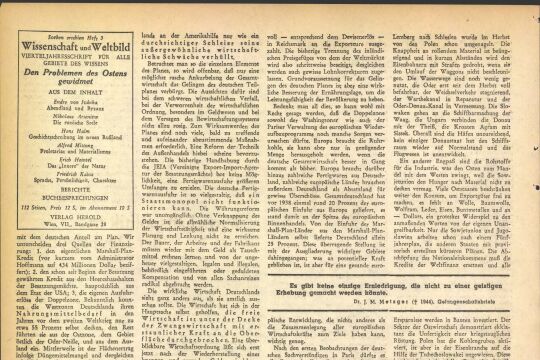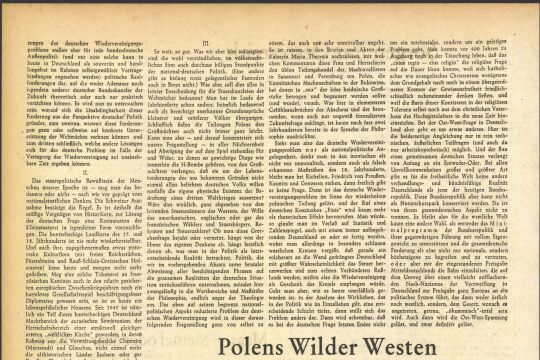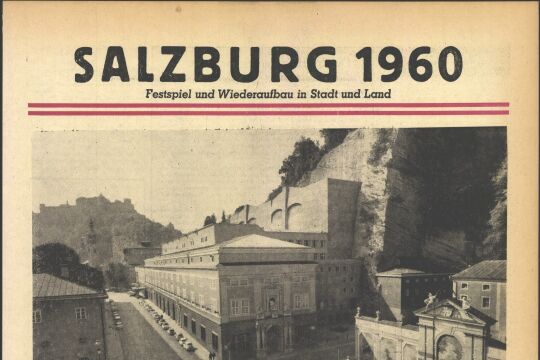Unser östlicher Nachbar Slowakei hat noch immer enorme Schwierigkeiten, den Scherbenhaufen des Kommunismus aufzuräumen. Trotzdem blickt die Bevölkerung mit ein wenig Optimismus in die Zukunft.
Zwischen den grünen Hügeln der Ostslowakei und Paris erstrecken sich mehr als eineinhalb Tausend Kilometer. Eine lange Anreise für die zwei blondhaarigen, pausbäckigen jungen Frauen in Jeans und bunten T-Shirts, die ihren Arbeitsplatz in der französischen Hauptstadt gefunden haben. Alle zwei Monate durchqueren sie auf dem Weg von der beschaulichen Kreisstadt PreÇsov (Preschau) in die Seinemetropole den halben Kontinent.
Seit dem heurigen Frühjahr beaufsichtigen sie dort den Nachwuchs von zwei neureichen französischen Familien. Als Kindermädchen sind die arbeitswilligen Frauen aus dem armen EU-Beitrittskandidaten im wohlhabenden Frankreich gern gesehen.
"Arbeit gab es für uns daheim keine", erzählen die beiden. Nach der Schule haben sie in ihrer Region monatelang gesucht. Ohne Erfolg. Nur in der Hauptstadt Pressburg hätte sich vielleicht eine Jobmöglichkeit angeboten. Aber sie hatten keine Wohnmöglichkeit in der slowakischen Metropole in Aussicht. Da kam ihnen die Stelle in Paris gerade recht. "Viel verdienen wir da nicht, aber wir sehen wenigstens etwas von der Welt", sehen sie ihre Situation realistisch.
Die beiden jungen Frauen sind keine Einzelfälle in unserem Nachbarland. Im Gegenteil. "Viele junge Frauen aus der Slowakei arbeiten als Altenpflegerinnen und Kindermädchen in Deutschland und Österreich. Auch eine Verwandte von mir hat jetzt eine Stelle in der Nähe von Wiener Neustadt gefunden", erzählt Maria Kozak aus der Kleinstadt Stadt Stara Lubuvna (Alt-Lublau). "Die Situation in unserer Stadt ist repräsentativ für die ganze Ostslowakei", sagt Frau Kozak. Das ganze Wirtschaftsleben von Alt-Lublau war bis 1989 von zwei Großbetrieben bestimmt: einer Schraubenfabrik mit 800 Beschäftigten und einer großen Textilfabrik. Beide sind jetzt geschlossen. Ersatz für die verlorenen Arbeitskräfte gibt es keine. In den nackten Zahlen der Arbeitslosenstatistik schlägt sich das nieder. Die offizielle Arbeitslosenrate für die Slowakei wird für das Jahr 2001 mit 17 Prozent angegeben. Diese Rate sei in der Ostslowakei aber viel höher, sagt man im Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Exakte Zahlen sind aber schwer zu ermitteln, denn viele Arbeitnehmer, die wegen die Schließung von unrentablen Industriebetrieben ihre Arbeit verloren haben, scheiden definitiv aus dem Arbeitsmarkt aus. Sie verstecken ihre Arbeitslosigkeit in der Landwirtschaft oder tauchen in der Schattenwirtschaft unter.
Wer Arbeit hat, ist in der Slowakei nicht viel besser dran. Mit 6.000 Kronen (2.000 Schilling) Durchschnittsgehalt macht man keine großen Sprünge. Lehrer sind mit 8.000 Kronen monatlich zwar etwas besser gestellt, müssen sich aber noch immer nach der Decke strecken. "Dieses Gehalt ist viel zu gering", beschwert sich ein junger Hauptschullehrer. Der Pädagoge ist per Autostopp unterwegs in die nächste Stadt, um für seine bevorstehende Hochzeit preisgünstig einen Anzug zu erstehen.
Die Folgen des wirtschaftlichen und politischen Transformationsprozesses nach 1989 bestimmen bis heute das Leben in der Slowakei. Dabei war die Slowakei einst gar kein Industriestaat. Das agrarisch geprägte Land wurde erst in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts industrialisiert. Sogar in den Kleinstädten entstanden damals große Industrieanlagen: Stahlwerke, Papierfabriken, Betriebe der chemischen Industrie und vor allem Waffenschmieden. Absatzmarkt für die Produkte war der gesamte RGW-Raum. Mit dem Ende des Kommunismus und der Auflösung der Tschechoslowakei brach mit einem Schlag für die slowakischen Betriebe der Absatzmarkt weg. Verschärft wurden die Probleme durch die drastischen Erhöhung der Rohstoffpreise. Dazu kam die politische Isolation, in die das Land durch den autoritären Kurs von Ministerpräsident MeÇciar zwischen 1992 und 1998 geriet.
Hartes Sparpaket
Die von dem Christdemokraten MikuláÇs DÇzurinda geführte Regierung, hatte ab 1999 nicht nur politische Aufräumungsarbeit zu leisten, sondern musste sich zudem mit dem wirtschaftlichen Scherbenhaufen auseinandersetzen, den MeÇciar hinterlassen hatte. Der hatte nämlich erheblichen Teil der Betriebe der slowakischen Wirtschaft in einer äußerst dubiosen "Privatisierung" Freunden und politischen Weggefährten zukommen lassen. Die geringen Erlöse brachten wenig für das Staatsbudget und führten außerdem zu einer Stagnation beim Zufluss ausländischen Kapitals.
DÇzurindas Koalitionsregierung begann sofort ein hartes Sparpaket durchzuziehen. Mieten, Elektrizität, Gas wurden drastisch erhöht. Die ermäßigte Mehrwertsteuer für Lebensmittel wurde von sechs auf zehn Prozent erhöht. Den Teuerungsschub spürte jeder Slowake in seiner Geldtasche. Besonders stark betroffen von den immer noch nachwirkenden Maßnahmen sind Alleinverdiener, Pensionisten und Arbeitslose. In den Familien macht sich die Teuerung massiv zu Schulbeginn im Herbst bemerkbar. "Meine Tochter besucht ab September eine Fachschule für Tourismus. Für Bücher, Hefte und die vorgeschriebene Schuluniform müssen wir 6.000 Kronen ausgeben. Das ist genau so viel, wie ich im Monat verdiene", klagt Maria Kozak.
Trotz der Schwierigkeiten für die Bevölkerung machte die Slowakei unter der Regierung DÇzurinda Fortschritte. So gelang es vor allem die außenpolitische Isolation aufzubrechen. Die Slowakei gilt nun auch als seriöser Beitrittskandidat für die erste Runde der EU-Osterweiterung.
Die volkswirtschaftlichen Indikatoren sehen im Jahr 2001 günstig aus. Der von der Bank Austria herausgegebene CEE-Report rechnet für das heurige Jahr mit einem realen Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent und einer beträchtlich steigenden Industrieproduktion (8,5 Prozent). Besonders erfreulich ist die gewaltige Steigerung der ausländischen Investitionen in der Slowakei. Im Jahr 2000 flossen zwei Milliarden Dollar an Investitionen in das Land. Das war mehr als in der gesamten Periode von 1989 bis 1999. Für heuer erwartet man ausländische Investitionen in einer Größenordnung bis zu sechs Milliarden Dollar. Verantwortlich für diesen Kapitalschub sind die angelaufene Privatisierungswelle und das verbesserte innenpolitische Klima in der Slowakei.
Auch österreichische Unternehmen sind hier federführend beteiligt. So erwarb die Erste Bank im vergangenen Oktober den Mehrheitsanteil an der slowakischen Sparkasse, und die Neusiedler AG sicherte sich für 80 Millionen Dollar 50 Prozent an der Papierfabrik SCP in Rozumberok (Rosenburg). Dieser Betrieb in der Mittelslowakei ist mit 3.800 Beschäftigten einer der größten Feinpapierhersteller in Zentral- und Osteuropa. "Wir wollten erweitern und fanden die in der Slowakei bestehenden Kapazitäten sehr attraktiv. Entscheidend waren auch die niedrigen Produktionskosten", sagt Günther Hassler, Vorstandsmitglied der Neusiedler zu den Motiven. Bereut hat man bei Neusiedler die Investition nicht. Im Gegenteil. "Unsere Erwartungen wurden erfüllt. Wir sind sehr zufrieden mit der Kooperation."
Obwohl davon meistens der verkehrsmäßig besser erschlossene Westen der Slowakei profitiert, gab es Investitionen im Osten des Landes. Die spektakulärste Transaktion ist der Erwerb der Ostslowakischen Stahlwerken (VSZ) in KoÇsice (Kaschau) durch US Steel. "Die Amerikaner kauften das größte Stahlwerk Ostmitteleuropas nicht aus Menschenliebe, sondern weil sie hier eine wirtschaftliche Zukunft sehen", betont Franz Erhart, der für die Slowakei zuständige Referent der Bundeswirtschaftskammer, das Potential der Region.
Der Riesenbetrieb VSZ prägte den Ruf KoÇsices als unattraktive Industriestadt. Ein Image, das der heutigen Realität nicht so ganz entspricht. Fährt man in KoÇsice vom Stahlwerk Richtung Zentrum, vorbei am Ring hässlicher Plattenbauten, dann kommt man in einen wunderbaren Stadtkern. Die Hochöfen und Walzstraßen scheinen auf einmal ganz weit entfernt. Dafür warten auf den Architekturliebhaber eine Fülle von Entdeckungen. Auf dem großen langgestreckten Marktplatz dominiert das klassizistische Theater. Daneben erhebt sich der pittoreske Elisabethdom. An den Fassaden der Gründerzeit- und Jugendstilhäuser glänzen wieder die Farben. In diesen mustergültig renovierten Häusern haben sich kleine Geschäfte niedergelassen. Die umfangreichen Restaurierungsarbeiten verdankt die Stadt Rudolf Schuster. Der Staatspräsident der Slowakei war als Bürgermeister von KoÇsice für diese gewaltige Sanierungsprogramm verantwortlich.
Vorbildlich saniert
Prächtige Stadtkerne, die bereits gut renoviert sind, gibt es auch in den anderen Kleinstädten der Ostslowakei. Einst waren viele dieser Städte über Jahrhunderte von der deutschsprachigen Bevölkerung, den "Zipser Sachsen" geprägt. Diese deutschen Siedler kamen schon im Mittelalter in die Slowakei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die meisten von ihnen ausgesiedelt oder verließen freiwillig das Land. Die schönen Stadtkerne aber sind geblieben. Zwar verkamen die Zentren in der Zeit des Kommunismus. Jetzt besinnt man sich aber wieder auf den Wert dieser Gebäude und putzt sie heraus. Ein Beispiel dafür ist Kezmarok (Käsmark), eine Kleinstadt am Fuß der Hohen Tatra. Die Fassaden der Barockhäuser sind gestrichen, die Kirche und der wunderschöne Glockenturm schön hergerichtet. Prächtig ist auch die im 19. Jahrhundert im byzantinischen Stil errichtete evangelische Kirche. Dort liegt der ungarische Graf Stefan Tököly begraben. Zeichen dafür, dass die Slowakei über Jahrhunderte zu Ungarn gehörte.
Trotz der tristen Gegenwart schauen die Menschen in der Slowakei mit Zuversicht nach vorne. Sie erwarten keine Wunder, erhoffen sich aber vom EU-Beitritt eine Verbesserung ihrer Situation. Dass die Aufgabe der slowakischen Regierung dabei sehr schwer ist, verstehen die Bürger. "DÇzurinda hat wenig Spielraum", macht sich Maria Kozak keine Illusionen.
Vorsichtig optimistisch ist man auch in der Wirtschaft. Günther Hassler glaubt, "dass das Land in den nächsten beiden Jahren keine großen Sprünge machen wird. Eine graduelle Verbesserung ist wegen der steigenden ausländischen Investitionen aber sehr wahrscheinlich." Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt auch Franz Erhart von der Wirtschaftskammer: "Die Situation verbessert sich, aber nur langsam. Auf Veränderungen im Eilzugtempo sollte niemand hoffen."