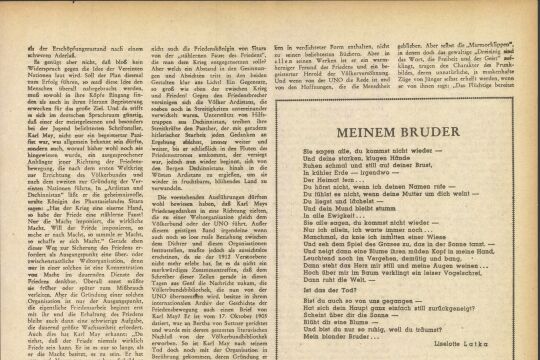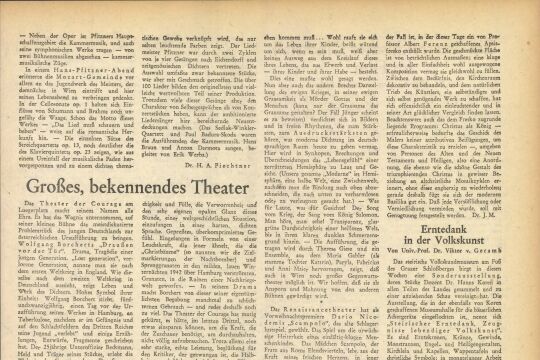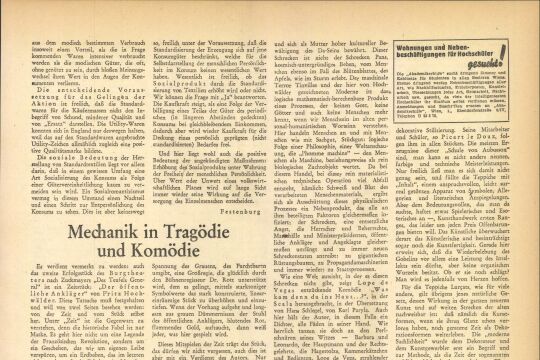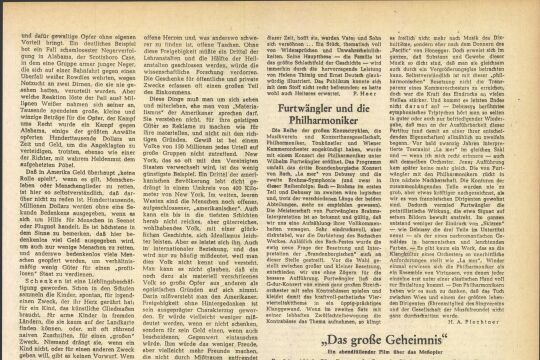Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Verfuhrung zur Gute
Unter den fünf dramatischen Hauptwerken des späten Bertold Brecht ist sein Parabelstück, „Der kaukasische Kreidekreis“ (1944/45 entstanden), vielleicht sein schönstes: schon vom Reichtum der Fabel und dem Hintersinn der Sprache her, aber auch dadurch, wie es Brechts virtuoser Szenentechnik gelingt, die Mannigfaltigkeit der Motive in dem komplizierten Handlungsgefüge zusammenzuhalten. Die in früheren Stücken gestellten Kardinalfragen des menschlichen Gewissens nach Wahrheit und Sittlichkeit werden im „Kreidekreis“ um eine weitere vermehrt: Was ist Gerechtigkeit? Brecht hat die altchinesische Parabel vom Streit zweier Mütter um ein Kind in das mittelalterliche Grusinien verlegt. Die Magd Grusche rettet das Kind des gestürzten Gouverneurs vor dem Zugriff der Aufständischen und zieht es unter Opfern auf. Denn „schrecklich ist die Verführung zur Güte“, und „einer muß der Helfer sein!“. An die Tragödie reiht sich die Komödie des Dorfschreibers und nachmaligen Richters Azdak, eines derbsinnlichen, bestechlichen, spitzfindigen Schelmes, eines Eulenspiegels der Gerechtigkeit, dessen saftige, humane Halunkendialektik ihm zum Wein und den Armen zum Recht verhilft. Diese Gestalt vom Fleisch und Geist Shakespeares widerlegt fast den Moralisten Brecht. Denn wem solch eine Figur gelingt, dem glaubt man die ideologische Begrenztheit nicht mehr, die in der Formel vArm gleich gut, reich gleich erzböse“ liegt und sich schon äußerlich darin ausdrückt, daß die „Bösen“, die Herrscher, Feudalherren und Panzerreiter, mit grimmigen oder lächerlichen Halbmasken versehen sind, während die „Guten“ ihr eigenes, naturgegebenes Gesicht zur Schau tragen dürfen.
Beide Geschichten münden in die Fabel vom Kreidekreis. Bei der klassischen Probe der Mütterlichkeit erhält nicht die leibliche Mutter, die herzlose Gouverneursfrau, die einst den Säugling über der Sorge um ihre Brokatkleider auf der Flucht vergaß, das Kind zugesprochen, sondern Grusche, die gütige Magd, deren Mutterschaft Kampf, Not und Arbeit war. So lautet das Urteil, das Azdak am Ende der für die Armen goldenen Zeit der Anarchie fällt. Aber schon muß er den Richtermantel abstreifen und davonlaufen, und auch die Magd mit dem Kind unterm Arm muß es tun, fliehen vor dem neuen Tyrannen, der nun die Macht hat. Die „goldene Zeit der Gerechtigkeit“ währte nur kurz, und trotz Tanz und Musik wirkt das Ende melancholisch. Darüber wie über so manche bittere Wendung im Text (wenn etwa Azdak, den Strick um den Hals, wieder einmal um Gnade winseln muß: „Hunde, meine Mithunde, gebt mir einen Stiefel zu lecken, gelegentlich.“) will der Sänger, der das Stück kommentiert, zum Schluß hinwegtrösten: „Die Kinder deh Mütterlichen, daß sie gedeihen, die Wagen den guten Fahrern, damit gut gefahren wird, und das Tal den Bewässerern, damit es Frucht bringt.“ Das ist nun wieder weit mehr als poetisch verkleidete Gesellschaftslehre, ist Segensspruch von fast biblischer Sprachkraft. Dieses Stück hat „der arme B. B.“ geschrieben, nicht der Klassenkämpfer, nicht der Theoretiker, nach dessen „Verfremdungstheorie“ die Figuren des Dramas kalt, starr und entfernt wirken müßten, um in ihrem Sinn aufzufallen.
Dem Volkstheater ist eine sehenswerte Aufführung zu danken. Regisseur Gustav Manker hat das Vorspiel, die Diskussion der Kolchosbauern, mit Recht gestrichen und auch sonst Straffungen zugunsten des Szenenflusses vorgenommen. Seine Inszenierung hält sich demnach, zum Wohle der Zuschauer, nicht streng an die Brecht-Tradition. Von den fast vier Dutzend Mitwirkenden, die große und kleine Chargen treffend verkörperten, können bloß die beiden Hauptdarsteller genannt werden: Hilde Sochor als ergreifende, mütterlich gütige Magd, deren Stimme, auch wenn sie vom Leid singt, nie grell und grob wird, und Fritz Muliar als Azdak. der in seiner schauspielerischen Vitalität eine überragende Leistung bot. Auch Peter Göller als Sprecher und Sänger, der die Vorgänge kommentiert und weiterleitet, machte seine Sache recht gut. Paul Dessaus etwas trockene und zu reichlich „angewendete“ Bühnenmusik stand unter der Obhut von Kurt Werner. Georg Schmids etwas karges Bühnenbild ermöglichte einen blitzschnellen Szenenwechsel. Der überreichliche Beifall galt gewiß den Darstellern, aber über diese hinweg auch dem Grundmenschlichen des Vorganges im Stück.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!