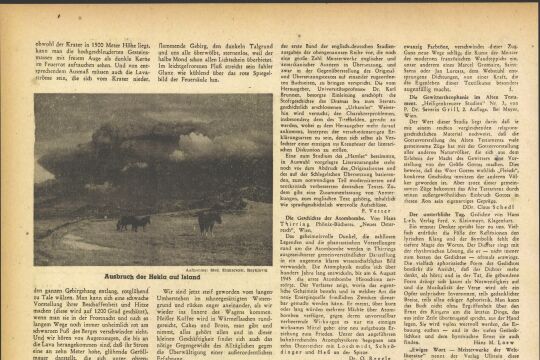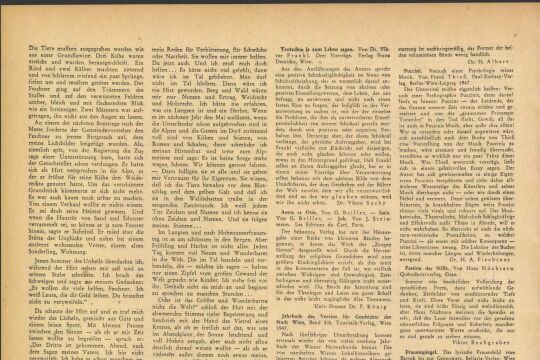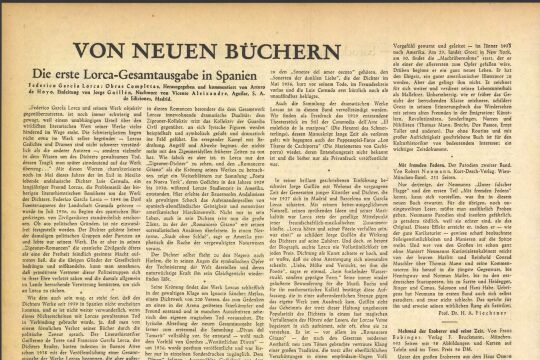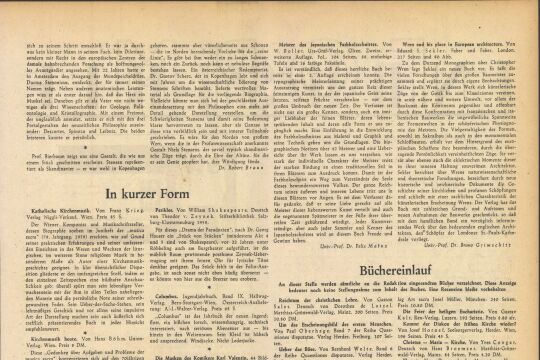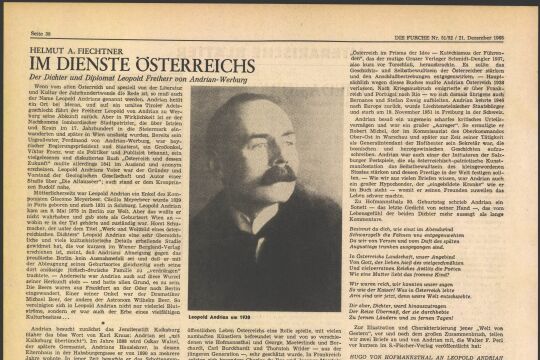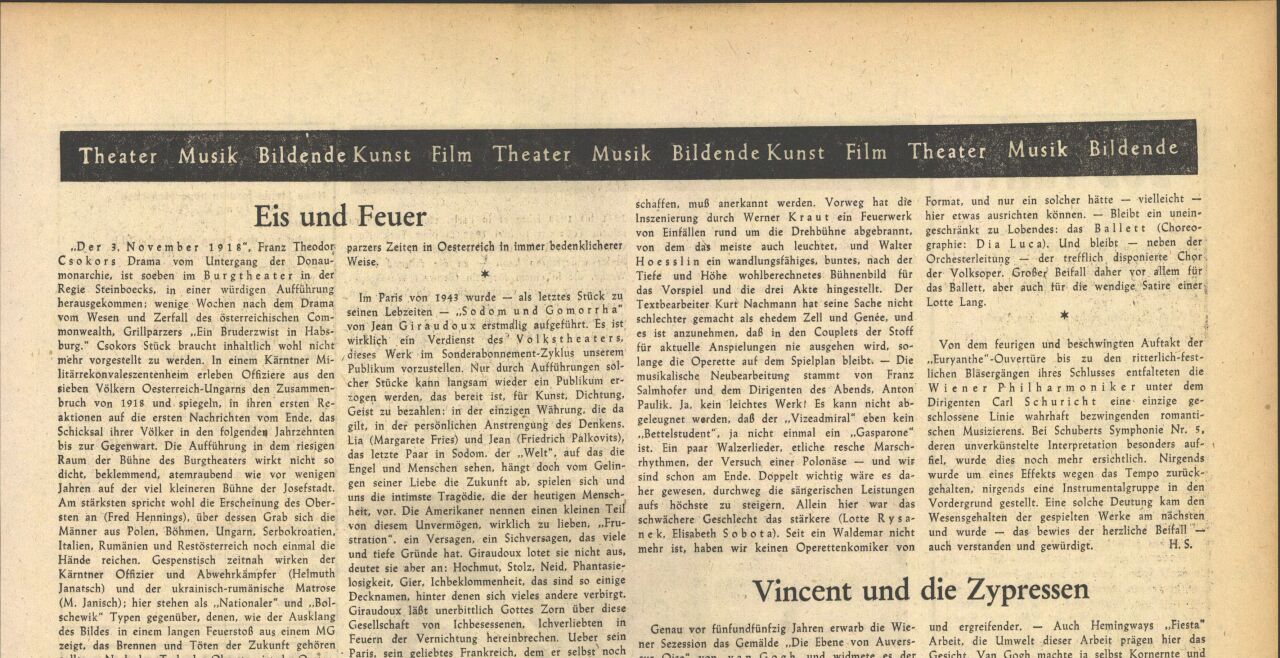
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eis und Feuer
„Der 3. November 1 91 8“, Franz Theodor Csokors Drama vom Untergang der Donaumonarchie, ist soeben im Burgtheater in der Regie Steinboecks, in einer würdigen Aufführung herausgekommen; wenige Wochen nach dem Drama vom Wesen und Zerfall des österreichischen Commonwealth, Grillparzers „Ein Bruderzwist in Habsburg.“ Csokors Stück braucht inhaltlich wohl nicht mehr vorgestellt zu werden. In einem Kärntner Militärrekonvaleszentenheim erleben Offiziere aus den sieben Völkern Oesterreich-Ungarns den Zusammenbruch von 1918 und spiegeln, in ihren ersten Reaktionen auf die ersten Nachrichten vom Ende, das Schicksal ihrer Völker in den folgende* Jahrzehnten bis zur Gegenwart. Die Aufführung in dem riesigen Raum der Bühne des Burgtheaters wirkt nicht so dicht, beklemmend, atemraubend wie vor wenigen Jahren auf der viel kleineren Bühne der Josefstadt. Am stärksten spricht wohl die Erscheinung des Obersten an (Fred Hennings), über dessen Grab sich die Männer aus Polen, Böhmen, Ungarn, Serbokroatien, Italien, Rumänien und Restösterreich noch einmal die Hände reichen. Gespenstisch zeitnah wirken der Kärntner Offizier und Abwehrkämpfer (Helmuth Janatsch) und der ukrainisch-rumänische Matrose (M. Janisch); hier stehen als „Nationaler“ und „Bolschewik“ Typen gegenüber, denen, wie der Auskiang des Bildes in einem langen Feuerstoß aus einem MG zeigt, das Brennen und Töten der Zukunft gehören sollte. — Nach dem Tode des Obersten ist das Oesterreichische nur noch durch den jüdischen Wiener Arzt-Offizier und ein gewisses Etwas präsent: es liegt noch etwas in der Luft, schwebt um die Menschen, was weder der Föhn noch die Granaten, nicht die Worte und das Eiend ganz wegwischen können: eine unvergeßliche Stimmung, in der letzten Geste des Obersten angedeutet, nun nachklingend. Fast vergessen, aber nicht ganz zu vernichten: die Erinnerung an die hohe Kunst mitmenschlichen Lebens, die seither überschwiegen, vergessen, auch vertan wurde. Zum Schaden nicht nur der unmittelbar Beteiligten, der Nationen, die nunmehr sich selbst preisgegeben wurden. — Es steht zu hoffen, daß die Schulen sich dieses Stück besehen: an Unterrichtsmitteln für eine staatsbürgerliche Erziehung fehlt es schon seit Grill-
parzers Zeiten in Oesterreich in immer bedenklicherer Weise. '■ '■ . 1 • ■. -:.,
'&&&&$fcmci$. .; :-,-A
Im Paris von 1943 wurde — als letztes Stück zu seinen Lebzeiten — „S o d o m und Gomorrha“ von Jean Giraudoux erstmalig aufgeführt. Es ist wirklich ein Verdienst des ' V o 1 k s t h e a t e r s, dieses Werk im Sonderabönnement-Zyklus unserem Publikum vorzustellen. Nur durch Aufführungen solcher Stücke kann langsam wieder ein Publikum erlogen werden, das bereit ist, für Kunst, Dichtung, Geist zu bezahlen: in der einzigen Währung, die da gilt, in der persönlichen Anstrengung des Denkens. Lia (Margarete Fries) und Jean (Friedrich Palkovits), das letzte Paar in Sodom. der „Welt“, auf das die Engel und Menschen sehen, hängt doch vom Gelingen seiner Liebe die Zukunft ab, spielen sich und uns die intimste Tragödie, die der heutigen Menschheit, vor. Die Amerikaner nennen einen kleinen Teil von diesem Unvermögen, wirklich zu lieben, „Frustration“, ein Versagen, ein Sichversagen, das viele und tiefe Gründe hat. Giraudoux lotet sie nicht aus, deutet sie aber an: Hochmut, Stolz, Neid, Phantasie-losigkeit, Gier, Ichbeklommenheit, das sind so einige Decknamen, hinter denen sich vieles andere verbirgt. Giraudoux läßt unerbittlich Gottes Zorn über diese Gesellschaft von Ichbesessenen, Ichverliebten in Feuern der Vernichtung hereinbrechen. Ueber sein Paris, sein geliebtes Frankreich, dem er selbst noch in später Stunde als Minister zu dienen gesucht hatte. Schmerz des Patrioten, des Intellektuellen, der ein langes und nicht unerfülltes Leben lang mitgespielt hatte mit Gestalten, wie er sie hier dem Gericht ausliefert. — Die Wiener Aufführung trifft das Schwebende, Leichte, Funkelnde und Glänzende, das im, Lesen dieses fast lyrischen Gedichtes sehr spürbar wird, nicht sehr. Günther Haenel als Regisseur macht aus dem Gedicht ein weltgeschichtliches Gerichtsdrama, fast wie eine barocke Moritat, die Figuren erstarren dadurch teilweise fast zu Eis. — Dennoch bleibt ein starker Eindruck. — Die Kostüme Maxi Tschunkos und die Bühnenbilder Gerhard Hrubys sind intelligent, klug, ansprechend.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!