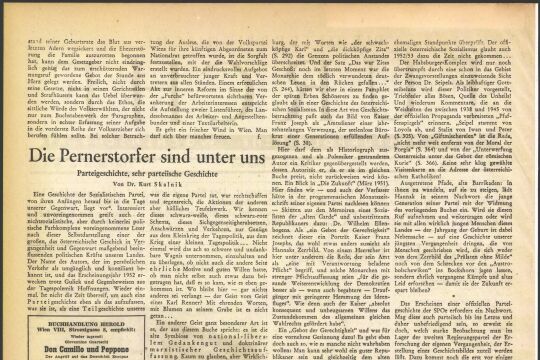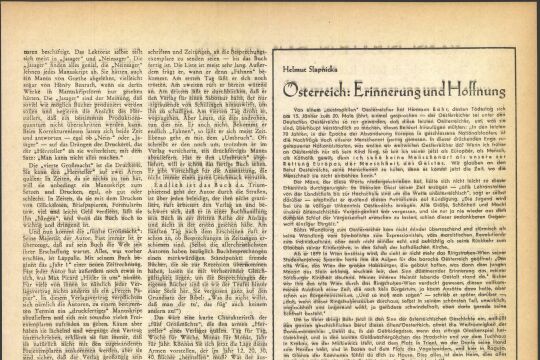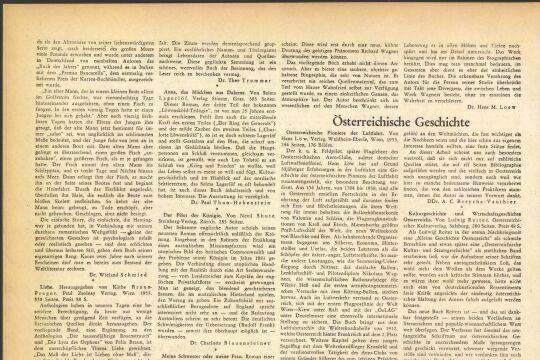Verlassen unsere jungen Schriftsteller die Gefilde „Kafkaniens"? Steigen sie die letzten Stufen der „Strudelhofstiege“ herunter? Treten sie heraus aus den diversen „elfenbeinernen Türmen“ — mögen diese der Zeit entsprechend auch aus Plexiglas gefertigt sein? Fast scheint es so. Vor uns liegen vier Romane österreichischer Autoren, deren Verfasser sich der Wirklichkeit stellen und — bewußt oder unbewußt — an den besten Traditionen österreichischer Erzähler anknüpfend, erzählen und nur erzählen.. Menschen, die durch die Gassen unserer Städte gingen und gehen, sind die Akteure. Die wechselnden Kulissen aber lieferte das „Große Welttheater, Abteilung Oesterreich“. Da und dort — wir werden sehen — wird auch bereits eine Erhellung und vielleicht sogar Deutung der Geschicke dieses Landes und seiner Menschen in den letzten Jahrzehnten versucht.
Das Stück heißt Oesterreich. Wir alle spielten und spielen mit. Laßt uns deswegen besonders aufmerksam sein, wenn wir für die kurze Zeit der Lektüre des einen oder anderen Buches einmal im Parterre Platz nehmen dürfen.
Großes, sehr Großes hat sich Fritz Habecl: vorgenommen. Sein „RITT AUF DEM TIGER" (Paul- Zsolnay-Verlag, Hamburg-Wien 1958, 610 Seiten) beginnt um die Jahrhundertwende und endet — zwangsläufig — in der Gegenwart. Eine Art öster reichische Buddenbrooks sollte es werden. Der gern genützte Vorwurf, an den Geschicken einer Familie die Geschichte eines Landes deutlich zu machen, wurde wieder bemüht. Der Richter Martin Leichtfried reitet mit den Seinen auf dem Rücken des Tigers. Durch viele Ringe hat er zu springen, über hohe Hürden und über breite, schwindelnde Abgründe geht die wilde Jagd. Wer könnte es leugnen, daß dies das Schicksal vieler Familien in Oesterreich war? Doch ach — unser, das heißt Habecks Tiger Ist eindeutig schwarzrotgold gestreift! Martin Leichtfried, eine grüblerische, komplexe Natur, dem die uneingeschränkte Sympathie des Autors gehört, war und ist niemals geistig in Oesterreich zu Hause. Und genauso wenig seine ganze weitverzweigte Sippe. Vor 1918 träumt er von der „großen deutschen Republik“. Nach vielen Prüfungen und bitteren Erfahrungen ist er 1945 nicht klüger geworden und bekennt einem wohlmeinenden Kollegen, „die große deutsche Republik war immer mein Traum... Sie ist es auch heute noch" (S. 557). Der geschmähte österreichische Staat hat jedoch darauf nichts Eiligeres zu tun. als Martin Leichtfried zum Rat des Obersten Gerichtshofes zu berufen. Aber das kommt nur in Romanen vor — oder... ?
Kurz und gut: Fritz Habeck entwirft mit besonderer Liebe hier ein nationales und sozialistisches (zur Klarstellung: beileibe kein nationalsozialistisches) Leitbild, wie es unter älteren Sozialisten zum Beispiel Pcrnerstorfer vertrat, wie es vor 1938 bei jenen anzutreffen war, die der Parole „Lieber Hitler als Häbs- burg“ folgten und wie wir es heute mit durch den weiteren Verlauf der Geschichte bedingten Variationen bei Mitgliedern des „Bundes Sozialistischer Akademiker“ (BSA) vor allem in den westlichen Bundesländern und im Kreis um die Grazer sozialistische „Neue Zeit“ antreffen können. Es wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn dieser Haltung auch die echte Gegenposition eines österreichischen Patriotismus entgegengesetzt würde. Aber hier reicht es bei Habeck mit einzelnen Ausnahmen nur zu Karikaturen. Und zu gehässigen Ausfällen. Wer sich die Mühe macht, kann unter anderem auf den Seiten 371 f, 321, 322. 336, 387. 393 f, 402. 545 Schmähungen über Oesterreich lesen, die — leider muß man es sagen — seit dem Ende des „Tausendjährigen Reiches nicht mehr gedruckt wurden.
Jede Selbstkontrolle verliert Habeck aber, wenn er auf die katholische Kirche, den christlichen Glauben und den Priesterstand zu sprechen kommt. (Vgl. die Seiten 234, 248, 269, 270, 281, 289, 314, 369, 383, 390, 395, 511. 533 f.) Hier verdunkelt blinder Haß den Blick bis zur Lächerlichkeit, wenn zum Beispiel die Behauptung aufgestellt wird, die Kirche begünstige den Analphabetismus (S. 369).
Rasch noch die Liste der „Errata : Niemals trug die Polizei in Oesterreich schwarze Stahlhelme (396). Nicht ein „blauer Turm" (S. 400), sondern ein ..blauer Bogen“ des Karl-Marx-Hofes stand im Zentrum der traurigen Februarereignisse 1934. Paukanten duzten ich nicht (S. 392). Ein Landesgerichtsrat verdiente um 1930 genug; er brauchte daher kein dürftige Leben führen (S. 362 f.). ln diesem Lager ist Oesterreich - von Schiller (S. 394). Aber! Auch das Märchen fehlt nicht, daß nach 1945 Ehrenräte- alle Offiziere vom St idium ausschlossen (S. 573). Die Wahrheit: der erste, 1946 gewählte Vorsitzende der Oesterreichischen Hochschülerschaft war selbst Oberleutnant in der deutschen Wehrmacht gewesen. Wenn schon der Autor gerne „Sonnabend , „Tram , „Droschke", „Schutzmann“ schreibt und bei ihm in Wien Häuset „freig chippt“ (S. 529) wurden, so hätte hier der Verlag die bei uns landesüblichen und nicht schlechteren deutschen Wörter unschwer ein- setzen können.
Ein großer Wurf. Daneben! Daneben! Schade. Denn schreiben kann Fritz Habeck, und die Technik des großen Romans beherrscht er ohne Zweifel.
Gleich Habeck steht auch Reinhard Federmann mit seinen Sympathien der österreichischen Linken nahe! Aber er ist ein Mann det „Generation von 1945“. Einer von jenen, denen 1945 nicht eine Welt unterging, sondern die Erfüllung lange zurückgestauter Erwartungen versprach. Zu hoch gespannter Erwartungen vielleicht — aber immerhin. Sein staats- politisches Bekenntnis ist klar und unkompliziert. Die unheilvolle Schizophrenie vieler Oesterreicher der Vergangenheit „Staat" und „Volk“ ist überwunden. Aber um etwas anderes geht es Federmann in seinem ersten Roman „DAS HIMMELREICH DER LÜGNER“ (Verlag Albert Langen — Georg Müller, München 1959, 530 Seiten). Wo steht der Mann, der in den dreißiger Jahren jederzeit bereit war, für seine Idee auf die Barrikaden zu gehen, in der heutigen Welt? Reinhard Federmann zeigt dies am Schicksalsweg des Jungsozialisten und Februarkämpfers Bruno Schindler, der nach seiner Flucht in die Sowjetunion — wo er während einer Säuberungskampagne die alten Illusionen verliert — 1945 mit der Roten Armee als Offizier nach Oesterreich zurückkehrt. Die weiteren Stationen? KP-Redakteur, Bruch mit der Partei, „heimatloser Linker“ und erfolgreicher Kommerzschriftsteller („Politisch? Nein. Alles andere.“ S. 500) in Westdeutschland. Doch im Inneren klingen oft mahnend die Signale. Jene, die einst die Völker hören sollteh...
Federmann hat sich also ein sehr aktuelles Thema gestellt. Die große Enttäuschung der politisch engagierten Generation der dreißiger Jahre. Sein Bruno Schindler hätte genauso gi t damals auf der anderen Seite der Barrikaden stehen können. Deshalb behandelt auch der Autor die in der Person des einstigen Heimwehrstudenten Eugen Naderny verkörperte Gegenseite zwar nicht mit Sympathie, aber mit Respekt vor ihrem österreichischen Patriotismus.
Federmann gelingen sowohl gut beobachtete Wiener Lokalskizzen wie auch die Beschwörung der prickelnden politischen Hochspannung in den Jahren vor und nach 1934 in Oesterreich. Die Schilderung, wie ein SA-Rollkommando versucht, eine Versammlung sozialistischer „Jungfrontler“ auszuheben, versetzt jeden, der ähnliches in jenen Jahren selbst erlebt hat, plötzlich um 25 Jahre zurück. Federmanns Engagement in der Welt der Illustrierten kommt dem Buche durch die Farbigkeit vieler Details im ersten Teil zugute. Im letzten Drittel unterliegt er jedoch der Gefahr, in die Kolportage abzugleiten. Man nippt eben nicht ungestraft als Literat am Freudenbecher der Wirtschaftswunderseligkeit...
Auch eine Frau hat sich zu Wort gemeldet. Und wir möchten auf die Wortmeldung von Dorothea Zeemann „DAS RAPPORTBUCH“ (Biederstein-Verlag, München 1959, 250 Seiten) nicht mehr verzichten. Es ist das stillste Buch unter den vorliegenden, was Zeit und Personenkreis betrifft, abgezirkeltste und vielleicht das literarisch stärkste. Die Aufzeichnungen des „Rapportbuches“ setzen im Herbst 1937 ein und enden wenige Wochen nach dem „Anschluß", Sie geben Kunde von den Aerzten. Schwestern und Patienten einer Wiener Klinik. Die politische Brandung bricht sich zwar an den Spitalsmauern, aber dennoch fallen auch die Schatten des Geschehens durch das Milchglas der hohen weißen Türen und reflektieren in dem Verhalten der Menschen: der Gejagten und der künftigen Jäger, der Opportunisten und der Ahnungslosen. Gleich einem Fels in der Brandung steht zu Beginn die Oberschwester Concha Maria Gräfin Monterossi, „Mensch einer Zeit, die längst versunken ist und vergessen hat, mitzureißen, was ihr angehört" (S. 10). Doch dieses lebende Denkmal Alteuropas trägt den Wurm in sich. So geht Concha auch unter — eine würdige Repräsentantin der Stoa, aber nicht eine Christin, ln ihr und ihrem Neffen Alberto, der bei der Erfüllung einer politischen Mission von Nationalsozialisten ermordet wird,
spiegelt sich auch die Tragik der vor 1938 in Oesterreich noch einmal zu politischer Verantwortung berufenen hochkonservativen Gesellschaftsschichten. Der Primarius Kurt Medler wiederum, und sein Leben im Schatten, Conchas, steht mit seiner inneren Um- Sicherheit, seiner Bonhomie und seinem Opportunismus für jene aus dem Kleinbürgertum aufgestiegene „neue Gesellschaft", die in unserer Gegenwart erst richtig zur Entfaltung kommen sollte. Die hilflosen Intellektuellen jüdischer und christlicher Konfession, die bösartige Fanatikerin Flora — wer kennt sie und viele andere, die die Autorin uns vorstellt, nicht? Dorothea Zeemanns besondere Stärke: nie im Stil des Leitartiklers zu schreiben, sondern aus den Reaktionen der Menschen verständlich zu machen, welche Leitartikel gerade geschrieben werden. Klio geht dufch die große Stadt. Wer einen Zipfel ihres Gewandes hinter Klinikmauern erhaschen will, darf sich nicht wundern, wenn er einen weißen Spitalskittel zu fassen bekommt.
Ein Einwand: Das Ende ist Müdigkeit, Resignation, Freitod. Und die Auferstehung? Die Auferstehung Oesterreichs! Sie war bekanntlich nicht nur eine Laune des Zufalls, auch nicht allein ein Geschenk der Alliierten ...
Errata: Die „Sturmscharen" waren keineswegs eine „Nachgeburt der Heimwehren“ (S. 115) sondern zeitweise ihr schärfster Konkurrent innerhalb des vaterländischen Lagers. 1936 wurden beide aufgelöst beziehungsweise in die „Frontmiliz" übergeführt. Alberto kann sich daher im Jänner 1938 nicht mehr im „violetten“ (soll wohl heißen graublauen) Hemd der Sturmscharen vorgestellt haben. Die Formationen der VF trugen damals einheitlich grüne Hemden.
Nach dem Abgesang der Auftakt! Ein junger, noch nicht hervorgetretener Autor hat sich vorgenommen, dem unbekannten Zeitgenossen im Wien des Jahres 1946 ein Denkmal zu setzen. Otto Jurka erzählt in seinem Roman „DAS LICHT WIRD NICHT SCHMUTZIG“ (Oesterreich-Bibliothek. Verlag „Das Bergland-Buch", Salzburg-Stuttgart, 303 Seiten) die Geschichte vom braven Werkstudenten Franz Zeilin- ger und seiner nicht weniger braven Schwester, die sich mitten unter Schleichhändlern, Denunzianten und Menschenräubern als anständige hilfsbereite Menschen bewähren. Die Absicht, in der das Buch geschrieben wurde, ist ohne Zweifel lobenswert. Die formale Durchführung dieses Erstlings läßt jedoch noch viele Wünsche offen. Schwülstige, unbeholfene
Wortbilder, wie zum Beispiel „ln milchigem Grau zerfloß die Sonne wie das Dotter eines aufgeschlagenen Eies. Unter der weißgetünchten Decke — mehr Deckel als Decke, dachte Zeilinger — schwirrte die Lärmwolke eines neuen Arbeitstages" (S. 31), stehen reihenweise neben Dialektperioden — bekanntlich am schwersten zu schreiben und unerträglich zu lesen, wenn nicht sehr gekonnt. So wirkt vieles platt und flach. Die Guten sind zu gut, die Bösen wahre Scheusale — wo bleiben da die unbekannten Zeitgenossen, denen doch dieses Buch zugeeignet ist: die überwiegende Mehrzahl von ihnen hielten und halten doch noch immer irgendwo in der Mitte. So war es auch im Wien des Jahres 1946, das — nebenbei bemerkt — nicht nur ein „Jahr des Zorns“ (S. 9) war, sondern neben vielen bitteren und düsteren Erlebnissen auch gerade im Kreis der damaligen Studenten hochgemute Stunden kannte, die ihresgleichen in der Sattheit und dem Desinteresse der Gegenwart nicht haben. Otto Jurkas Wiener Nachkriegsroman kommt also über den Versuch kaum hinaus. Das Thema „Viermal Oesterreich“ aber bleibt. Wer greift es auf? Genauer: Wer bewältigt es? Die junge österreichische Literatur ist aufgerufen!