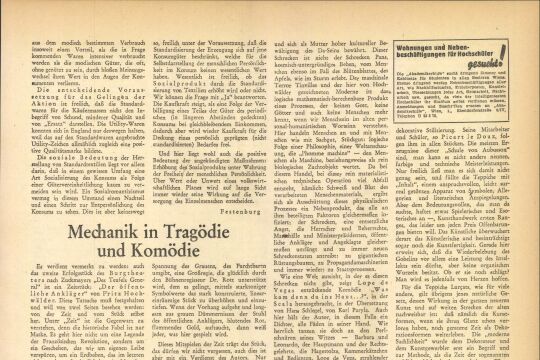Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Entlarvung der Heroen
Das Volkstheater nahm zum Saisonauftakt das 400. Geburtsjahr William Shakespeares (1564—1616) vorweg und feierte ihn mit der Aufführung seiner ganz selten gespielten Tragikomödie „Troilus und Cressida”. Das Stück, in seiner Stimmungsfarbe ein typisches Alterswerk, steht am Ausgang von Shakapeares tragischer Schaffensperiode, ln den fünf Akten sammeln sich nur Enttäuschungen, alles Unbehagen an der Welt. Shakespeare dramatisierte Homer. Aber der Kampf um Troja ist hier, Jahrhunderte vor Shaw und Offenbach, höchst unheroisch und die große Liebe zwischen dem Pria- mus-Sohn Troilus und der Kalchas-Tochter Cressida sehr kritisch gesehen. Denn Shakespeare hatte kein Verhältnis zur Welt Homers; seine „antiken” Helden sind in Wahrheit Ritter der Verfallszeit, deren Erschütterung schon im „Don Quichote” des Cervantes spürbar war.
Hohler Schein, dumme Phrasen, überschminkte Gemeinheit triumphieren auf beiden Seiten: in der Festung Troja, wo immer noch die schöne Helena den Ton angibt, wie bei den griechischen Belagerern. Es beginnt wie eine Burleske, wie eine Parodie auf die müden Helden: Die Könige sind Hohlköpfe, die Feldherren spreizen sich wie die Pfauen, die Haupt- matadore (Achilles, Ajax, Hektor) sind Prahlhänse oder jugendliche Heißsporne. Intrigen, Verkommenheit, Angst und Hemmungslosigkeit herrschen in den Lagern. Aus dem großen Gedicht über den trojanischen Krieg nahm Shakespeare das Mittelstück heraus, den Kampf zwischen Hektor und Achill. Und hier spielt die schrecklichste aller Szenen, die Shakespeare je erdacht: der Mord am waffenlosen Hektor. Achill, der strahlende Held Homers, ist hier ein verkommener, gemeiner Mörder. Bis ins Mark geschwächt von männlichen Buhlereien, unterliegt er im Zweikampf gegen Hektor und läßt darauf den Unbewaffneten von seinen Mordgesellen einkreisen und zerfleischen. Den Ltichnam an den Roßschweif gebunden, schleift er ihn über das Feld und läßt sich schallend als Sieger ausrufen.
Wie immer bei Shakespeare kommentieren „Narren”, die eigentlichen Weisen, das Geschehen. Hier ist es Thersites, der vielgeprügelte, häßliche Bastard, das Schandmaul, der Entlarver, der großartige Stänkerer, mit unerschöpflichem Witz begabt. Aber dieser „schäbige Schimpfhals” und „lausige Schuft” redet die Wahrheit. Die Idee des Krieges ist ein Weiberrock, Heldentum wird zur Farce.
Unter diesen Karikaturen des Helden- und Rittertums gibt es einen einzigen, echten Ritter, den Jüngling Troilus. ln der fratzenhaften Welt der Phrase und der Lüge bekennt er von sich: „Ich bin so treu, weil Treue dumm und schlicht ist. Und ich bin dumm — dumm wie ein kleines Kind.” Ein anderer Romeo, liebt er die schöne Cressida. Aber die ist keine Julia, sondern ein triebhaftes, listiges, verführerisches Dirnchen. Aus Gründen der Staatsräson an das Griechenlager ausgeliefert, verrät sie ihren Troilus bei der erstbesten Gelegenheit. Wie Thersites in den Lagerszenen, so agiert der andere „Narr”, der lüsterne, abgefeimte Kuppler Pandarüs als Entlarver und böser Spötter in den Liebesszenen. Fr verhöhnt die Lauterkeit und den Liebesidealismus des Jünglings und hat noch im Epilog (in der Aufführung des Volkstheaters allerdings gestrichen) mit seinem schlüpfrigen Geschwätz das letzte Wort.
„Die Stunde riecht nach Tod.” Lang ehe dieses Wort fällt, sind Komik und Pathos der Tragikomödie verschlungen, die in der Entfesselung tödlichen Hasses endet. Selbst Troilus, der zu Bevinn vom Krieg nichts hören wollte, verkündet am Ende Rache, Schonungslosigkeit und Untergang.
Ist es wirklich ein herzloses Stück, wie Richard Flatter im Nachwort zu seiner Übersetzung meint? Weil Liebe als Torheit erscheint, Schönheit ohne Treue, Vertrauen als Enttäuschung, das Hohe als das Fragwürdige und Heldentum ohne Ehre? Aber diese düstere und zugleich spöttische Weltbetrachtung stammt doch von einem, dessen frühere Stücke von tiefer Heiterkeit erfüllt waren. Wer die Menschen so verachtet wie in diesem Stück, muß sie ehedem sehr geliebt haben. Der Enttäuschung um den Menschen entstammt das trauervollste aller Stücke Shakespeares, das uns zugleich als sein modernstes anmutet. Denn steht nicht auch im zwanzigsten Jahrhundert die Menschheit immer noch vor Troja und in Troja, im Kampf um ein Phantom? Es braucht viel Geist und Mut, diese kühne, unerbittlich wahre Dichtung zu spielen. Schon Heine meinte: das Stück bedürfe einer eigenen Ästhetik, die noch nicht geschrieben sei.
Man kann mit diesem Shakespeare alles machen. Das Old-Vic-Theater kleidete seinerzeit die Trojaner in Uniformen der britischen Garde, während die Griechen preußischen Offizieren glichen, ln New York versetzte man das Stück in die Zeit des amerikanischen Sezessionskrieges. Der Kern, das Empörern™ dieses Stückes gegen das Abgründige und Gemeine, das Feuerwerk von Genieblitzen und philosophischen Betrachtungen über Leben, Menschen und Kriege blieb dabei immer erhalten. Gustav M a n k e r steuerte bei der Inszenierung im Volkstheater mit regie- licher Intelligenz und Intuitution eine mittlere Linie. Er kürzte (vielleicht allzu stark) und hielt sich ungefähr in der Mitte des Gegensätzlichen; zwischen der Travestie der Jahrtausende — weil so viel angeprangterte Dummheit und Falschheit nur zu verlachen ist — und dem tiefgründigen Ernst, der etwa aus den kapitalen Sätzen des Odysseus über das Weltbild der Elisabethaner, über den Irrweg von der Ordnung zur Unordnung, von der Heiterkeit zum Chaos zu hören ist oder aus der herrlichen Trauerrede des Troilus auf Hektor, in der er zugleich den Abgesang auf seine Liebe und auf den Anstand der Welt spricht. Von den vielen Mitwirkenden seien hervorgehoben: Michael H e 11 a u als leidenschaftlich jünglingshafter Troilus und Kurt S o w i n e t z als der große Schimpfer Thersites, Ernst Meister als kluger Sprecher Ulysses, während Elfriede 1 r r a 11 als Cressida etwas zu einseitig auf den Wedekind-Ton (Lulu) festgelegt schien und Fritz M u - liar als exemplarischer Kuppler Panda- rus sich manchmal zu sehr mit schmatzendem Behagen (vor allem in der Liebes- szene) in den Vordergrund spielte. Das nüchterne, unveränderte, grellweiße Bühnenbild (Georg Schmid) wird durch Epi Schlüsselbergers unkonventionelle Kostüme ein wenig aufgelockert. Alles in allem eine sehenswerte Aufführung, die den Beifall verdiente.
„Die kleinen Füchse” im Theater in der Josefstadt knüpfen an das Bibelwort an: „Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben “ Die Dramatikerin Lillian H e 11 m a n n führt uns in eine Familie im amerikanischen Süden um die Jahrhundertwende, als in der Gründerzeit der Baumwollindustrie skrupellose Geschäftemacher Reichtümer ansammelten und dabei die schwarzen Baumwollpflücker und -arbeiter wie Sklaven ausbeuteten. Die gesellschaftskritische Studie erweist sich allerdings mehr als Bühnenreißer, nach den Gesetzen der naturalistischen Dramaturgie gebaut. Das liefert mehr oder weniger ergiebige Rollen, was aber heute, da wir doch etwas mehr um den Menschen wissen, zu wenig ist. Recht gut Ursula Schult als schlaue Profitmacherin und Leopold Rudolf als ihr todkranker, aber grundanständiger Mann. Luise Rainer als weltfremde, lieblos behandelte Frau steigert sich stellenweise in eine unerträgliche Exaltiertheit, was die Regie (Heinrich Schnitzler) wohl hätte dämpfen müssen. Das Publikum sah über das Unerquickliche des Stückes hinweg und bedachte die Schauspieler mit Beifall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!