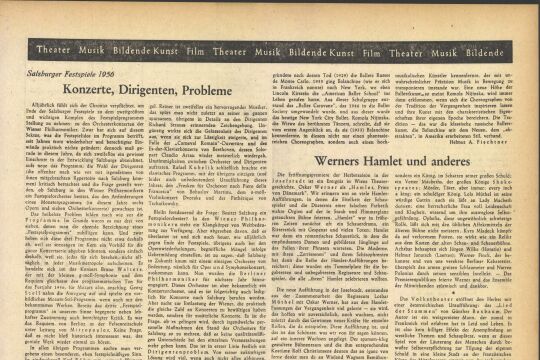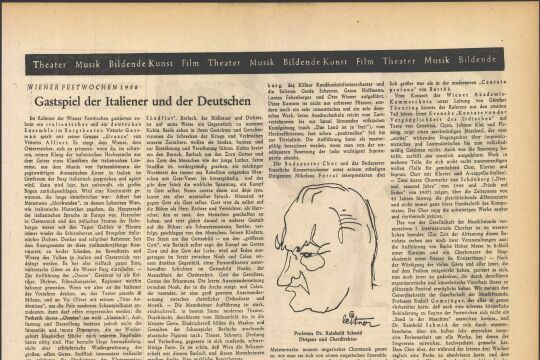Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wiener Theater an der Jahreswende
Die letzten Wochen des vergangenen Jahres brachten Wien zwei große Theaterereignisse: In der Josefstadt des jung verstorbenen ödön von Horvath „Jüngsten Tag“ und im Burgtheater Lessings „Nathan den Weisen“. Darf die Aufführung in der Josefstadt ein wahrhaft einmaliges Beispiel von Ensemblekunst genannt werden, so bot andererseits Raoul A s 1 a n als Nathan eine schauspielerische Leistung von solcher Ausgewogenheit und Reife, daß man sich nur schwer eine Höherentwicklung dieses großen Menschendarstellers denken kann. Zum erstenmal nach langer Zeit konnte man in einer Gedankendichtung, die voll innerer Problematik ist, die lebendige Diskussion subtilster Fragen der menschlichen Entwicklung genießen.
Die Dialektik von Schuld und S ü h ne, von Verbrechen und Strafe, gesehen aus der Lebensmitte christlichen Existenzdenkens, zwingt den Zuschauer im „J ü n g-s t e n Tag“ in ihren Bann. Die unheimliche Logik, die allem menschlichen Dasein innewohnt — trotz allem Unbegreiflichen und Unvernünftigen in unserem Inneren und in der Außenwelt —, die Erbsünde, die den Menschen schuldlos schuldig werden läßt, ihn hineinstoßt in das Verhängnis, aus dem es nur einen Weg der Erlösung gibt: die Schuld zu büßen und der Gerechtigkeit sidi nicht zu entziehen; die tiefe seelisdie Not der Kreatur wird in der Tragödie des kleinen Bahnbeamten Thomas Hudetz — den Hans Holt meisterhaft in seiner beklemmenden Verstocktheit und Getriebenheit Gestalt gewinnen läßt — sichtbar, in einer Tragödie, die bei allem Düsteren doch befreiend und erlösend wirkt, weil sie die Fähigkeit des Menschen zeigt, zu seinem Hineingestelltsein in den Prozeß des Gerichtes ja zu sagen.
ödön von Horvaths „Jüngster Tag“ ist ein Volksstück von hohem literarischen Rang, der Thomas Hudetz ein Bruder des Woyzek ebenso wie des Martin Schalanter oder Mitja Karamasoff. Das Schauspiel atmet eine österreichische Atmosphäre wie wenige Kunstwerke der letzten Zeit und die Regie hat es meisterhaft verstanden, diese österreichische Note in Horvaths Drama aufklingen zu lassen.
Und nun zu Lessings Toleranzdrama! Halb Schauspiel, halb orientalisches Märchen, Dichtung und Tendenzwerk in einem, vielleicht — wenn wir von der augenblicklich besonders gegebenen Aktualität des Toleranzgedankens absehen — nur deshalb ein so gewaltiger Erfolg, weil Aslan einen Nathan auf die Bühne stellt, der nicht nur ein großer Herr ist, sandern auch viel echten Humor hat. Ferdinand Kürnberger hat im Vorwort zu seinem Ron1 an „Das Schloß der Frevel“ als Liberaler die innere Größe des Lessing-schen Dramns, das die Tendenz des religiösen Liberalismus verfolgt, von einem Liberalismus der Partei abzuheben versucht, wie er etwa in Gutzkows „Uriel Acosta“ uns entgegentritt. „Nathan der Weise“, so schreibt Kürnberger, „verlangt das Recht des Liberalismus, gibt es aber zugleich! Do ut des. Er geht mit gutem Beispiele voran. Er lehrt Duldung, indem er selbst duldet. Das ist den Massen zu vornehm, zu uneigennützig. Auch herrscht man nicht damit, aber man verträgt sich, man ehrt alles Leben. Und das ist die Tendenz der Poesie. Es ist der Liberalismus der Gerechtigkeit.“ Kürnberger hat das Wesentliche der Problematik des Lessingschen Schauspiels gesehen. Ist der religiöse Liberalismus der Ausweg aus den Schrecknissen von Religions- und Weltanschauungskämpfen, die das Allgemeinmenschliche zu eliminieren drohen? Diese Frage wird durch den „Nathan“ jeder Zeit und jeder Generation gestellt. Lessing hat diese Frage in einem Sinne beantwortet, der absolut gegen die geschichtlichen Religionen nicht nur, sondern gegen alle Offenbarungsreligion überhaupt gerichtet ist. Lessings Drama liegt eine Entscheidung gegen die Offenbarung und für die Vernunft zugrunde, die dazu zwingt, dem liberalen Vernunftprinzip selbst seine Dogmatik nachzuweisen, seihe verborgene Intoleranz aufzuspüren. Lessings „Nathan“ ist das erste große B e.k e n n t-nis der Humanitätsreligion des deutschen Idealismus, das Schillers Gedankendichtung und Hegels Vernunftphilosophie vorwegnimmt. Dieser deutsche Idealismus, der eine Religion, zumindest ein religiöses Lebensgefühl war, hat aus dem Irrtum, der Offenbarung entbehren und fernerhin allein auf der Vernunft die Entwicklung und Erziehung des Menschengeschlechts begründen zu können, den Prozeß der Entchristlichung der deutschen Nation wen nicht hervorgerufen, so doch zumindest beschleunigt und damit die moralische und geistige Katastrophe, die heute in der Mitte Europas eingetreten ist, mitverschuldet. Der vor Jahren verstorbene Berliner protestantische Theologe Wilhelm Lutger hat in seinem großen Werke über die „Religion des Idealismus und ihr Ende“ den Nachweis dieser Schuld des Idealismus irn metahistorischen Sinne erbracht. Lessings „Nathan“ ist geradezu getragen von dem idealistischen Vorurteil gegen alle geoffenbarte Religion, vor allem gegen das Bekenntnischristentum, und das Schauspiel verleugnet nicht, daß Lessing mit ihm den orthodoxen Theologen,mit denen er sich herumstritt, einen Possen spielen wollte. Im Bereiche katholisch geprägter Kultur kann der „Nathan“ leicht die gedämpfte Note eines vornehm-gemäßigten Antiklerikalismus annehmen — wovor in der Burgtheateraufführung die souveräne Güte aus innerer Stärke, die Aslan dem „Nathan“ gab, bewahrte. Um so mehr muß darauf hingewiesen werden, daß die Regie Herrn Maierhofer einen Patriarchen spielen ließ, der die ohnehin verzeichnete Gestalt des Kirchenfürsten in einen komischen Theaterbösewicht verwandelte.
Trotzdem wir glauben, daß die Losung unseres gequälten Zeitalters nicht lauten kann, Menschlichkeit durch Überwindung der Religion, sondern Humanität auf der Grundlage der Bekenntnisse, Vernunft und Offenbarung und nicht Vernunft gegen Offenbarung, können wir die Aufführung des „Nathan“ nur begrüßen als den Beginn einer schöpferischen Diskussion mit der großen Gedankenwelt der europäischen Aufklärung und des Zeitalters der deutschen Bewegung, die bei aller ihnen anhaftenden Problematik zu dem unveräußerlichen Erbe unseres geistigen Daseins zählen.
Das Theater „D i e Insel“ In der Komödie geht seinen Weg unter der Leitung Leon E p p s konsequent weiter. Literarisch dürfte „Die Insel“ auch weiterhin ihre besondere Note wahren und mit großem Interesse sieht daas geistig interessierte Wien der Aufführung des „Bürge n“ von Claudel, die noch im Jänner stattfinden wird, entgegen. Diese Aufführung wird einen Maßstab abgeben für den Rang, den -man der „Insel“ innerhalb der Wiener Theaterwelt wird zuweisen müssen. Wir sind überzeugt, daß die „Insel“ auch das anspruchsvolle Wiener Theaterpublikum nicht enttäuschen wird.
Von den letzten Stücken, die in der „Insel“ herausgebracht wurden, verdient Galsworthys „Bis aufs Messer“ unsere Beachtung. Diese Tragikomödie vom Klassenkampf zwischen Landadel und Neureichen, der schließlich beide Teile immer stärker in Schuld geraten läßt, ist vielleicht nicht Dichtung im eigentlichen Sinne, auf jeden Fall aber interessantes Theater.
Direktor Epp hat die Absicht, auf seiner kleinen Bühne den Bogen der Weltliteratur von der Antike bis zur Moderne, von Aristophanes — dessen „Lysistrata“ eben über die Bretter der Komödie geht — bis zu Claudel, Strindberg und B a r 1 a c h zu spannen. Wenn es ihm gelingt, diesen großen Künstler, dessen Werk und Dasein der Nationalsozialismus totschweigen und auslöschen wollte, in Wien zu neuem Leben zu erwecken, wird er eine küntlerische Tat von bleibender Bedeutung vollbracht haben.
Das Volkstheater hat endlich Grillparzers „M e d e a“ herausgebracht und sich entschlossen, sie nicht nur als Theater der Jugend, sondern auch als Abendaufführung in den Spielplan einzufügen. Dies ist um so mehr zu begrüßen, als eine der interessantesten Charakterdarstellerinnen des Wiener Theaters, Frau Dorothea Neff, die Titelrolle spielt. Das Volkstheater kann nur dann hoffen, nach einer langjährigen Epoche der Versuche, einen einheitlichen Stil zu gewinnen, wenn es das Nebeneinander von klassischem und modernem Repertoire pflegt. An charakteristischen Schauspielerindividualitäten ist es ja nicht arm.
Die Aufnahme von „Lady W i n d e r-meres Fächer“ in den Spielplan ist von verschiedenen Seiten kritisiert worden. Wir möchten in diese Kritik nicht einstimmen. Sicherlich hat jedes einzelne Werk Wildes so wie der Dichter selbst seine großen Schwächen. Dennoch bietet eine Wilde-Aufführung stets dem Theaterliebhaber einen Genuß und man kann nicht sagen, daß Frau Mardayn die anderen Schauspieler an die Wand gespielt hätte. Im Gegenteil, in „Lady Windermeres Fächer“ hat das Volkstheater noch nicht ganz, aber fast jene Ensemblekunst erreicht, die eine Aufführung erst zu einem künstlerischen Ereignis werden läßt.
Martin Costas Wiener Volksstück „Dil Fiakermilli“ im Bürgertheater stellt einen — vom lebendigen dritten Akt abgesehen — mißlungenen, aber vom littrar-soziologischen Gesichtspunkte aus interessanten Versuch dar, das Wiener Volksstück wieder zu beleben, und zwar durch eine Handlung, die um eine der merkwürdigsten Frauen des Wiens vor achtzig Jahren spielt, um die Fiakermilli. Daß auch eine Volkssängerin in ihrer Art eine große Künstlerin sein kann und daß auch im Vorstadtmilieu der tragische Gegensatz von Kunst und Leben, von Dämonie des künstlerischen Berufes und privatem Lebensglück Menschen in tiefes Leid führen kann — dies ist für uns kein Problem mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Aber was zwei Filme, die in ihrer Art Kunstwerke waren — „Operette“ und „Schrammein“ — boten, dies bleibt Costas „Fiakermilli“ schuldig. Umso stärker regt dieser Versuch eines Volksstückes zu soziologischen und sozialen Betrachtungen an, besonders über das Problem einer einheitlichen, alle Stände und Schichten verbindenden Volkskultur, das gerade in Wien mehr als in anderen Weltstädten immer wieder in schöpferischer und dabei naiver Weise gelöst werden konnte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!