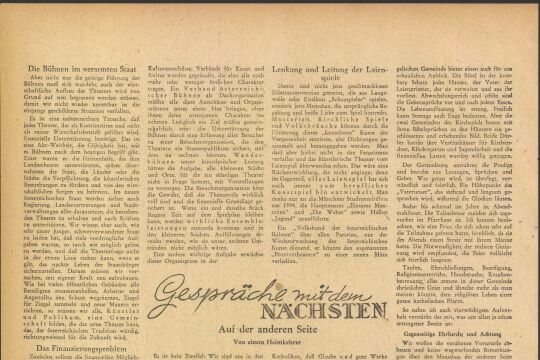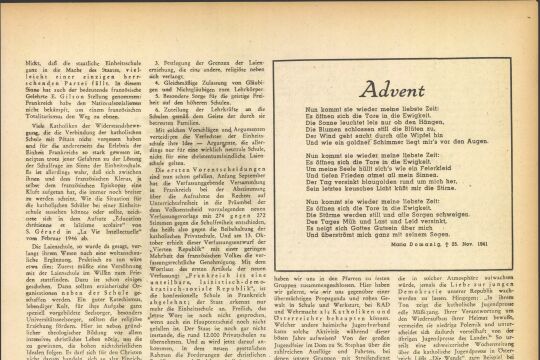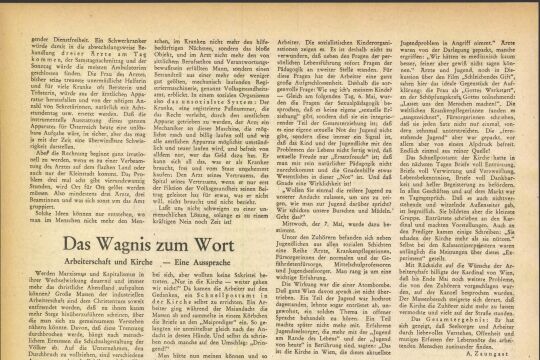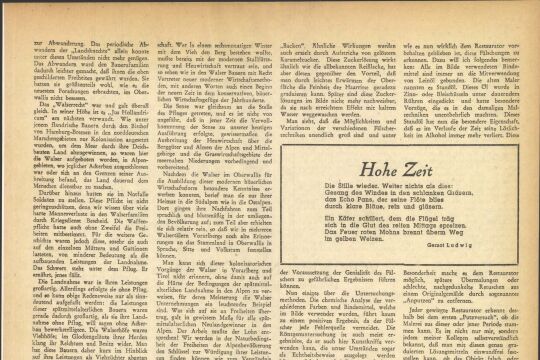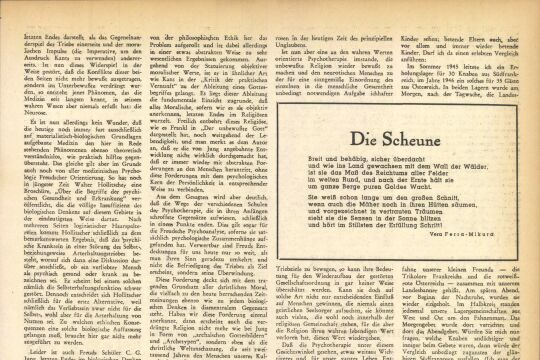Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Generation von Suchern“
„Was nicht brennt, zündet nicht“, schrieb Univ.-Prof. Dr. P, Adamer in der „Furche“ Nr. 35 in seinem Aufsatz „Mitarbeiter der Wahrheit“ über die Glaubensverkündigung in der Gegenwart. Hiezu meldet sich nun ein Heimkehrer zum Worte, dessen herbe Art nicht mißverstanden werden soll. Das männliche Bckentnis verdient Beachtung und mehr als eine theoretische Erwägung.
„Die Furche“
Wenige Wochen nach der Kapitulation, in einem Kriegsgefangenenlazarett in Italien war es, an einem hohen Feiertag. Der als Gottesdienstraum improvisiert eingerichtete Saal war vdll verwundeter und kranker Soldaten. Es hatte sich herumgesprochen, daß diesmal ein Hochamt mit Musik stattfinden würde. Dazu waren ein Harmonium, zwei Geigen und ein Cello beschafft worden. Die Männer hatten zu diesem Anlaß aus ihren verwitterten und zerschlissenen Uniformen den letzten Glanz herausgeholt. Etwas beklemmend war der Anblick von so vielen Arm- und Beinamputierten in einem Haufen. Ein kleiner Wald von Holzkrücken überragte die Sitzenden.
Ein Wehrmachtspfarrer, der mit uns das Los der Kriegsgefangenschaft teilte, zelebrierte. Seine Erscheinung machte auf die jungen Männer sichtlich Eindruck. Aufmerksam verfolgten sie die Handlung am Altar, die seine feierlichen Bewegungen begleiteten. Die anfängliche Neugier in den Mienen und Blicken ging allmählich in tiefen Ernst über. Als zum Tedeum am Schluß der Messe sich alle erhoben, auch die Beinamputierten mit Hilfe ihrer Krücken, und als das Lied erklang: „Großer Gott, wir loben Dich…“, da stimmten alle, ohne Ausnahme, mit fester, dankerfüllter Stimme in den Gesang ein. Tränen sickerten aus manchen Augen und suchten einen Weg über die jetzt seltsam gelösten Züge.
Wir gingen nun jeden Sonntag in die Kirche, manche von uns allerdings — um der Wahrheit die Ehre zu geben — auch jetzt noch, anfangs jedenfalls mehr zum Zeitvertreib und der Abwechslung halber in der Eintönigkeit der Kriegsgefangenschaft. Bald aber konnten wir aneinander bemerken, daß uns nach dem Besuch der Kirche eine seltsame Nachdenklichkeit einsilbig machte. Das lag an den Predigten unseres Pfarrers, wir gestanden es uns eines Tages ein. Er wußte in uns einen neuen Glauben zu wecken, mit dem Glauben an Gott auch den verlorenen Glauben an uns selbst; denn er, selber Soldat, fühlte es uns nach, daß wir ohne diesen Glauben bloß geborstene Gefäße wären, in die er schließlich sinnlos das Wort Gottes gießen würde. Er sprach in einer Sprache zu uns, die uns Wohltat: er ehrte uns als Soldaten — uns, die wir damals geächtet, verachtet und verstoßen schienen.
Seine schlichten, schönen Worte über die Kameradschaft, die Tapferkeit und die Treue sowie über die menschliche Größe des opferbereiten Soldaten erfüllten uns ihm gegenüber mit tiefer Dankbarkeit. In stundenlangen, ernsten Gesprächen, in denen zuweilen auch eifernder Streit nicht fehlte, unterhielten wir uns über den Inhalt seiner Rede und schließlich waren wir uns so ziemlich alle, wenigstens im wesentlichen, darin einig, daß die Rettung des Abendlandes nur oder doch hauptsächlich vom Christentum zu erwarten sei.
Mit diesem Glauben, dieser letzten Hoffnung in einer Zeit, die uns, wie es uns schien,
zu ersticken drohte in grauer Trostlosigkeit, kehrten schließlich die meisten von uns in die Heimat zurück. Es kamen Enttäuschungen. Wir suchten eine Brücke, wie sie uns unser Soldatenpriester geschlagen hatte, und fanden sie nicht. Niemand kümmerte sich um uns — es sei denn die politischen Parteien, aber denen mißtrauten wir. Wir hofften, daheim wenigstens den inneren Frieden zu finden, und suchten, in Erinnerung an unseren Pfarrer in der Kriegsgefangenschaft, Kontakt mit der Geistlichkeit. Wir hatten dann das ernüchternde Gefühl, sie verstünde uns nicht ganz. Man wußte offenbar mit unserer Art, die weder Demut noch Hoffart war, wenig anzufangen. Es kann aber auch sein, daß unser Hemmungen, unser Anliegen in rückhaltlosem Vertrauen vorzubringen, sie selber hemmte. Statt daß die Scheu voreinander allmählich schwand, wuchs sie nur noch. Wir merkten das mit ehrlichem Bedauern, wußten uns aber nicht u helfen. Wir waren durch sechs Jahre Krieg hindurch gewohnt, Befehle auszuführen und vielleicht auch zu befehlen — da aber, was zwischen beidem lag, war für uns eine Art Niemandsland, in dem wir uns nur mit größter Vorsicht bewegten. Wir brauchten jemand wie unseren Soldatenpfarrer, der uns gleich begriff, ohne erst auf unsere — im übertragenen Sinne zu verstehende — Beichte zu warten, die uns so schwer fiel, weil wir Worte und lange Erklärungen nicht gewohnt waren.
Dazu kam, daß die Predigten, denen wir anfangs daheim erwartungsvoll lauschten, uns irgendwie — man verzeihe uns den vielleicht etwas harten Vergleich — nicht selten an Schallplatten erinnerten, die vor langen, langen Jahren und in einer Sprache aufgenommen worden waren, die wir nicht mehr mühelos und ganz verstanden. Wir sagten uns wohl, daß die Kirche eben nicht genug Priester aus unserer Generation hatte, aber wir hatten uns vorgestellt, daß diese Lücke vielleicht durch eine Art von Wanderpredigern, die aus unserer Zeit und unseren Reihen hervorgegangen waren, oder durch regelmäßige, für uns abgehaltene religiös gerichtete Zusammenkünfte wenigstens notdürftig erfüllt werden könnte. Wir warteten vergebens. Wohl vernahmen oder lasen wir von diesem oder jenem wortgewaltigen Prediger in Wien, aber sie trafen wir draußen nicht und es fragt sich im übrigen ja auch, ob sie trotz ihrer Sprach gewalt für uns die richtigen Mittler sind. Denn wir sind weder ganz Einfältige noch Nur-Intellektuelle und besitzen doch ein sehr feines Ohr. Wehn da ein Ton nicht ganz echt ist, fällt gleich die weit geöffnete Tür zu unserem Herzen von selber ins Schloß. Wir wollen auch keine Stars im Priestergewand, sondern ganze, unverfälschte Menschen, die uns einfach deshalb helfen wollen, weil sie uns auf dem Wege zur Wahrheit und inneren Freiheit schon ein gutes Stück voraus sind.
Wir verlangen offenbar viel und vielleicht sogar Unmögliches. Aber vielleicht erreichen wir damit wenigstens das irgendwie doch noch Mögliche. Wir sind ja keine Generation von Stürmern und Drängern, sondern von Suchern. Wir sind — durch das Erlebnis des Krieges, aber auch der totalen Politik, die bis in den letzten Winkel unseres Daseins gedrungen ist — reifer, einsichtiger, duldsamer. Wir geben um mit Unvollkommenem eher zufrieden, wenn wir bloß spüren, daß das Vollkommene trotz allem ehrlichen Bemühen eben nicht erreicht werden kann. Man setze uns nur keine „fromm" klingenden Worte vor und man rede mit uns nicht gewissermaßen in der Kindersprache… Wir verstehen sie nicht und fühlen uns selber unverstanden. Wir suchen — im übertragenen Sinne — unseren Soldatenpriester aus der Kriegsgefangenschaft und warten voll Sehnsucht, daß er sich melde und uns wieder beistehe in unserer Not.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!