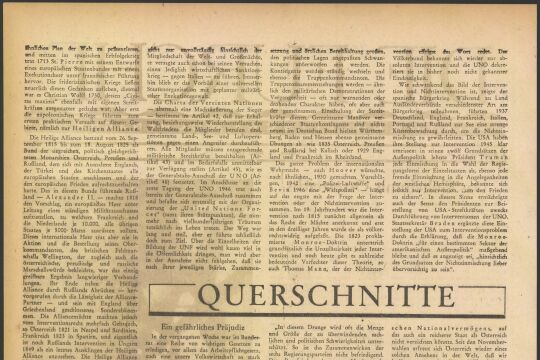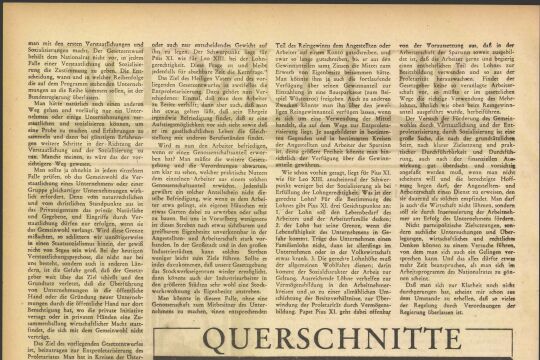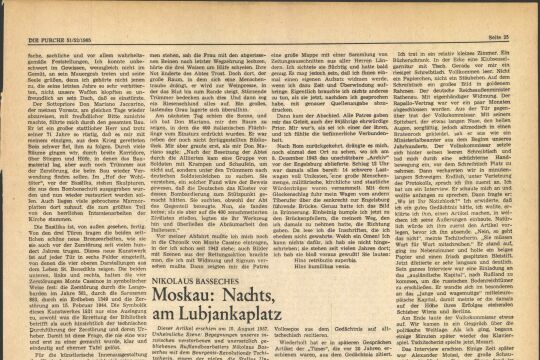Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hilsenrath und Lind: Jüdische Nachkriegsschicksale
Zwei jüdische Dichter erzählen ihr Leben. Edgar Hilsenrath tat es soeben romanhaft. Jakov Lind schrieb seine autobiographischen Bücher schon vor langer Zeit. „Selbstporträt” und „Nahaufnahme” wurden aber, da längst vergriffen, vom Wiener Picus-Verlag neu aufgelegt und erweisen sich als völlig frisch. Hilsenrath erzählt in seinem autobiographischen Boman „Rüben Jablons-ki” mit viel Witz und nicht ganz ohne Bosheit von der Zeit, die er mit Lind verbrachte. Lind erwähnt ihre Begegnung nur in einem Nebensatz. Ihre Bücher haben viel gemeinsam. Die beiden Autoren sind gleich alt, Hilsenrath wurde 1926 geboren und Lind 1927. Beide haben im Machtbereich der Nazis überlebt, beide entgingen dem Lager. Sie erzählen, wie ihnen das gelang - und von ihrer Jugend.
Beide fuhren nach dem Krieg für längere Zeit nach Palästina (Israel war noch nicht gegründet), kehrten nach Europa zurück, erlebten Jahre materieller Not. Beide schildern ihr weiteres Leben teils sarkastisch, teils mit Selbstironie, völlig ohne Pathos und streckenweise im Stil des erotischen Schelmenromans. Doch Jakov Lind war wohl der noch größere Schelm.
Über beiden Büchern könnte stehen: Jüdische Überlebensgeschichte, zweiter Teil - wie ich als Überlebender überlebte. Und bei Lind: Wie ich mein Überleben überlebte. Es gibt eine umfangreiche Literatur über den Weg in die Ghettos und Konzentrationslager, über die Lager selbst, aber recht wenig darüber, wie sich Juden in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Deutschland und Österreich fühlten. Jakov Lind schrieb es nieder: „Als ich die grünen Uniformen der österreichischen Grenzer ohne Hakenkreuz sah, fühlte ich mich gleich wohler. Die gleiche Uniform, die gleichen Stimmen, aber nirgendwo ein Hakenkreuz, kein Heil Hitler, kein ausgestreckter Arm- Höfliche Polizisten grüßen drei ihren Gräbern entstiegene Juden .!. Alles ist vergeben”1 und vergessen, alles war nur ein Mißverständnis. Wir haben euch nie gehaßt, wir wollten das nicht, was geschehen ist... Wen interessiert schon, ob man es gewollt hat oder nicht. Es ist eben passiert. Bein in die Öfen, raus aus den Öfen. Unsere Glückwünsche, ihr schlauen Juden! Warum habt ihr euren Glaubensbrüdern nicht verraten, wie man das macht, dann hätten wir heute in der Welt einen besseren Ruf.”
Dieses knappe Stimmungsbild trifft die Art, in der ein beträchtlicher Teil der Österreicher nach 1945 wieder zur Tagesordnung überzugehen versuchte, mit einer geradezu beängstigenden Exaktheit.
Sollte jemals jemand eine Geschichte der Wiener Nachhol-Avant-garde von 1950 bis 1952 niederschreiben, müßten unbedingt folgende Sätze Jakov Linds hinein: „Ip Wien gab es nur den Art Club, einen Keller gleich an der Kärntner Straße, wo Leute, die nicht heimgehen wollten, bis zum frühen Morgen saßen. Qualtinger, Hundertwasser, Fuchs, Artmann, Lehmden, Hutter, .Bayer, Gulda, London, Wally. Wally kam frisch aus Australien und war zweifellos der erste Hippie in Europa. Sie trug zerfranste Blue Jeans, keine Schuhe, war ganz weiß geschminkt und tanzte und sang vor sich hin. Außerhalb dieses Nachtasyls war Wien genauso mürrisch, fett, grob und verschlafen wie vor dem Krieg.” Hart, aber gerecht. Was wohl aus Wally geworden ist?
Jakov Lind wurde 1939 von seinen Eltern als Kind zu Pflegeeltern nach Holland geschickt und überlebte, weil er einen eisernen Überlebenswillen besaß und teilweise in die Haut der Verfolger schlüpfte. Vor der Bäumung des Judenviertels zog er Beit-hosen und Stiefel an, steckte ein Naziabzeichen an den Bockaufschlag und ging fünf Minuten nach Ende des Ausgehverbots „wie ein Nazi, der vom Dienst zurückkommt... mit militärischem Schritt” zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Später verwandelte er sich in Jan Gerrit Overbeek und wurde Matrose auf einem Lastkahn auf dem Bhein. Sah ihn jemand an, als hätte er Verdacht geschöpft schaute er nicht weg, sondern starrte aggressiv zurück. Den Satz „Jan ist wie ein richtiger Jude, er weiß alles” quittierte er mit einer Ohrfeige.
„,Die Juden sind doch in Ordnung! Reg dich nicht auf.'
,Ich kann sie aber nicht leiden', sagte ich. Da entschuldigte er sich.”
Im „Selbstporträt” schildert Jakov Lind eine jüdische Jugend im Vor-kriegs-Wien. Diese Seiten, vor allem die Analyse der Sprache, zählen zum besten, das über Wien in dieser Zeit geschrieben wurde.
Bei Hilsenrath hingegen wird das Schtetl noch einmal lebendig. Sein Vater schickte, als die Verhältnisse in Deutschland unerträglich wurden, die Familie zum Großvater in die Bukowina. Allein die Seiten über den Sabbat in Sereth würden genügen, um dieses Buch lesenswert zu machen. Im Oktober 1941 werden die Ju -den aus der Bukowina nach dem Osten abgeschoben. Bei einer Bazzia im Ghetto von Moghilev-Podolsk wird Hilsenrath aufgegriffen und deportiert. Er springt aus dem auf freier
Strecke haltenden Zug und ernährt sich auf dem Bückweg ins Ghetto von Vögeln, Eidechsen und Feldfrüchten. Die Tage, in denen eine einsame Bäuerin den Halbwüchsigen nicht ganz uneigennützig versteckt, gehen später in stark zugespitzter Form in den Roman „Der Nazi und der Friseur” ein. Nach dem Krieg fuhr Hilsenrath mit jüdischen Auswanderern nach Palästina.
Lind schrieb - 1969 - nur: „Ich lernte recht unterhaltsame Leute kennen. Einer, Edgar Hilsenrath, ist Schriftsteller geworden und wohnt jetzt in Berlin. Was aus den anderen geworden ist, weiß ich nicht.”
Hilsenrath hingegen konnte endlich eine offene Bechnung begleichen. Er habe Lind einen Job als Krankenträger im Hadassa-Krankenhaus verschafft. Als 1947 immer mehr englische Munitionslager und Kasernen in die Luft flogen und sie einen toten Engländer in die Leichenkammer tragen mußten, habe ihn der Freund reingelegt, indem er - „zu klug, um das vordere Ende zu nehmen” - das hintere Ende der Bahre packte und Hilsenrath vor ihm die Stiegen hinuntergehen ließ. Der Tote „rutschte mit seinen nackten, kalten Füßen auf meinen Nacken. Ich zuckte wie elektrisiert zusammen und fing mit der Bahre zu rennen an. Lindberg wurde mitgezogen und stolperte hinterher. Wir erreichten die Leichenhalle mit dem hopsenden Toten rennend. Dort setzten wir die Bahre ab... Wir gingen anschließend in die Kantine und versuchten, bei einem guten Essen den Toten zu vergessen ... ,Die Leiche liegt mir trotzdem im Magen', sagte ich zu Lindberg. ,Dann iß noch ein Stück Erdbeerkuchen', sagte Lindberg.”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!