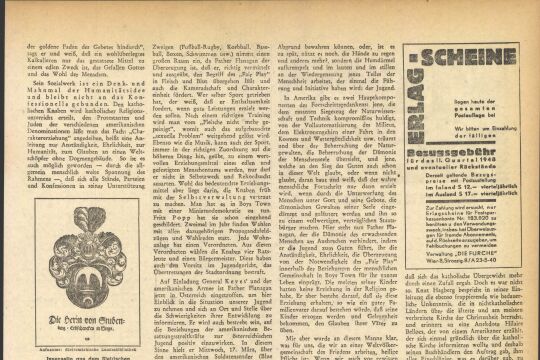Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lauter Langeweile
Wenn fremde Menschen Sie unvermittelt anreden, ist entweder Frühling, Pfingsten oder beides. „Ich freu' mich", sagte die Dame, die eine Reihe vor mir im Züricher Opernhaus des Beginns der Oper „Schlafes Bruder" von Bobert Schneider und Herbert Willi harrte, „Ich hab' einfach das Gefühl, das wird was Wunderbares." Die Dame hatte offenbar das Buch gelesen oder den Film gesehen und war innerlich prophylaktisch aufgewühlt. Ob sie bekommen hat, was sie suchte?
Robert Schneiders Gemeinde — und als solche kann man die Verehrer seines Romanerstlings wohl bezeichnen - das sind dankbare Leser einer klaren, spannenden Geschichte mit einem Anfang, einem Höhepunkt und einem Ende. Erzählt wird ihnen, was jeden interessiert: von der Suche nach Liebe, von ihrer Unmöglichkeit, vom Tod, von Musik und Genie, vom Universum und von Gott. Und das in einer Sprache, die so manieriert wie mitreißend ist und zudem das ganze tragische Musikerleben des Elias Aider auf weniger als zweihundert Seiten abhandelt. Was will man mehr?
Robert Schneider wollte mehr. Nach dem schweren Start und dem
überraschenden Erfolg kam der Film, pflückte all jene Ingredienzen aus dem Buch, die süffig und leicht verständlich sind und bog den Inhalt dort zurecht, wo das dem Publikum entgegenzukommen schien. Was blieb, war die zarte, exaltierte Liebesgeschichte eines zu früh pubertierenden und zu spät entdeckten Musikgenies, traurig, schön, nachvollziehbar und eindimensional, kurz ein sicherer Er-folg.
Und nun also die Oper: die Vorauspropaganda war mannigfaltig und konzentrierte sich auf die merkwürdigen Parallelen zwischen der Biographie des Komponisten Herbert Willi und jener des Johannes Elias Aider. Willis prominente Auftraggeber und Förderer, sein Librettist -wieder Robert Schneider - und nicht zuletzt seine Abkunft aus dem Mon-tafon schienen hochgespannte Erwartungen zu rechtfertigen. Er praktizierte merkwürdige Schlaf- und Wachrhythmen, während er sein Werk verfaßte, hatte - wie Aider -nach langer Krankheit eine Art musikalischer Erweckung erlebt und gilt darüber hinaus nicht als angepaßt. All das nährte die Hoffnung auf ein „Hörwunder", von dem auch der vierzigjährige Komponist selbst allerorten redete. Doch dem Projekt, das schon paktiert war, ehe das Buch noch
einen Verleger gefunden hatte, kam der Erfolg des Romans dazwischen. Um nicht als Wellenreiter zu erscheinen, bestand Willi auf einem neuen Libretto und bekam es. Zu seinem Schaden.
Da durfte all das nicht mehr vorkommen, was dem Buch die Kraft gab, ein Bestseller und trotzdem von Literaturkritikern ernstgenommen zu werden. Willi interessierte nur, was ihn selber betraf, also die Er-weckungsszene des Elias Aider, dessen Einsamkeit im dumpfen Dorfmilieu und das für nicht komponierende Menschen relativ irrelevante Problem des Verhältnisses von Wort und Musik. Was dem Roman das Fleisch gab und die Oper lebendig machen könnte, sollte wegfallen.
Schneider, angestachelt vom hochtrabenden Pathos der Gattung Oper und einer spröden Vorstellung von Modernität, kleisterte peinlich-platte
Wortmasken zu einem pseudotiefsinnigen Konglomerat, das sich in seiner Sperrigkeit nicht als Vorlage für ein Musikdrama eignet.
Die Zeche dafür zahlte Willi. Nur dort, wo Reste von dramatischer Lebendigkeit verblieben sind - in der ersten Begegnung von Elias und Els-beth etwa - ist ihm Musik gelungen, die überzeugend klingt, weshalb er sie nach dem Tod des Helden und einer wirren, entbehrlichen Texteinlage des virtuosen Udo Samel noch einmal spielen läßt.
Das zentrale „Hörwunder" bleibt abstrakt und Willis Idee, „Schlafes Bruder" aus dem Off als innere Stimme des Elias mitreden zu lassen, wirkt dramaturgisch blaß und musikalisch angestrengt.
Vollends der Schluß: „Jedes Musikstück muß auch Hoffnung geben", sagt Willi und biegt das düstere Ende des Bomans in eine Apotheose auf die
Liebe um. Hilft auch nichts mehr.
Erich Wonders abstraktes Alpen-Panorama, sein abgesenktes Mini-Dorf und die darübergelegte Spiel-Platte samt versenkbarer Orgel erwiesen sich als praktisch, doch wußte selbst ein Regisseur wie Cesare Lievi nicht recht, wofür. Wo nichts ist, haben auch Kaiser das Recht verloren.
„Lauter Langeweile", spricht Udo Samel im großen Monolog einer rätselhaften und nicht erklärten neuen Figur am Ende des 75 Minuten langen Stücks. Es klang wie eine Diagnose. Und dennoch - ein dankbares Publikum ließ sich seine Freude auch von Buh-Bufern nicht trüben.
Die österreichische Schneider-Gemeinde, die man in solchen Fällen gerne „umsichtig" nennt, kann „Schlafes-Bruder" unter der Leitung von Manfred Honeck, am 19. und am 20. Mai im Bahmen der Wiener Festwochen begutachten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!