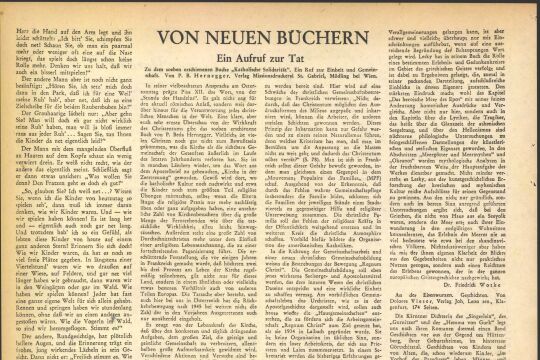Ohne Heimatrecht gibt es keinen Anspruch auf ungestörten Aufenthalt und keinen Anspruch auf Armenund Altersversorgung.
An den Rändern, nah der Wildnis, endet zwar nicht das Gesetz, aber es ist nicht mehr in aller Konsequenz durchsetzbar.
Elend, das alte Wort für die Fremde, ist überall; kein Wunder, dass der erste selbstbiographische Versuch mit der Anrufung Gottes endet:'Ach schicke uns doch süsse Lebensfreuden.'
Vor Allem denke ich immer wieder an ein Armen-Versorgungshaus in Krieglach, wenn ein Bestreben in dieser Richtung in der Gemeinde einmal Anklang fände. (Peter Rosegger)
Abseits der Schriftkultur, ohne soziales, symbolisches oder gar ökonomisches Kapital, beginnt der 1843 am Alpl bei Krieglach, Steiermark, geborene Bauernsohn Peter Rosegger im Medium der Schrift (und des Bildes) seinen Ort in der Welt zu bestimmen. Rechtschreibung braucht er dafür keine. In seiner mit erst fünfzehn Jahren ungewöhnlich früh und ohne institutionelle Veranlassung verfassten Lebns-Beschreibung platziert sich der Schreiber vorsorglich im Mittelpunkt der Welt: "Peter Roßegger ist im Jahre 1843 Geboren, in Welttheil Eiroba, in Keiserthum Teitzlants, im Land Steiermark, in Kreis Bruk, in Bezirk Kindberg, in der Pfar Kriglach, in der Gemeinde Alben, beim Bauern-Kluppenegger, welches in Besitzthum Seiner Eltern".
Beheimatung durch die Schrift
Diese Beheimatung durch die Schrift folgt, wie die Titelzeichnung des elterlichen Hofs beweist, dem engen Bedeutungsumfang des Wortes 'Heimat' im Sinne von bäuerlichem Besitz, Haus und Hof. Der für eine weitgehend illiterate Umwelt - nur die Mutter kann "den Druck" lesen -exzentrische Hang zum Lesen und Schreiben bringt den Biographen seiner selbst in ein Dilemma: "Ein Haubtstuck in meiner Jugend war auch dieses, das ich sehr ville Feinde hatte, den in der Nachbarschaft, waren mir die Leide nicht hollt, obzwar auch ich wie ander Arbeitten mußte, so sagten sie doch: 'Er der Lenzn Peterl sitzt den ganzen Dag in der Stuben, und Kratzelt' indem mir Fremte Leide Holt und Gutt waren, und so kam es das ich mich manchmahl hinaussähnde in die Weide Welt, um dord bei den Fremten mein Glück zu suchen." Diese Glückssuche ist umso dringlicher, weil das Ende dieses Lebenslaufs mit der Nachricht über die Vernichtung der Ernte durch den furchtbaren Hagel vom 13. August 1859 schließt: "Nun musten meine Ältern das ganze Jahr hindurch Nahrung kaufen, theure Nahrung. Welches Elend dieses ist weis nur jener, der es brobiren muste." Elend, das alte Wort für die Fremde, ist überall; kein Wunder, dass der erste selbstbiographische Versuch mit der Anrufung Gottes endet: "Ach schicke uns doch süsse Lebensfreuden."
Die ambivalente Differenz zur Herkunft verschärft sich; aus diesem Hin und Her gibt es vorderhand kein Entrinnen. Mit dem ökonomischen Ruin des elterlichen Hofs ist die alte Vorstellung von Heimat obsolet; sie lädt sich auf mit Trauer und Schuld, die Sehnsucht nach der fremden weiten Welt wird zur bitteren Notwendigkeit, zunächst ohne Anhaltspunkt, einen Bildungsweg zur Selbstbehauptung zu finden. Die Option, Geistlicher zu werden, ist verspielt, was Rosegger auch dem Verhalten der kirchlichen Instanzen zur Last legt. Sein Antiklerikalismus, Basisideologem des Liberalismus (und auch des Deutschnationalismus), wird so verstärkt. Ohne die Sprachformen, Rede-Gattungen und Rituale der Kirche (und des Kirchenjahrs) ist jedoch Roseggers Beheimatung in der Schrift nicht denkbar. Das befördert auch die Lust an parodistischen Imitationen und ironischen Kontrafakturen und verstärkt die Effekte der sprachbildenden Kraft des katholischen Kinderglaubens.
Das Weggehen, das zeigen Roseggers stärkste Waldheimat-Texte, ist mit Schuldgefühlen gegenüber den in der Einöde (so der programmatische Titel seines ersten Romans) zurückgebliebenen Eltern und Geschwistern verbunden. In dem Bild vom in der Mitte entzweigeschnittenen Regenwurm hat Rosegger ein kräftiges Zeichen für die Verspätung seines autodidaktisch beschrittenen Bildungsweges gesetzt. Die erfahrenen Demütigungen, die nicht abzutragende Dankesschuld bei seinen Grazer Förderern und Wohltätern zum einen, zum andern die materielle Not der engsten Angehörigen daheim, dies alles macht das Konzept von Heimat als Besitz fragwürdig.
Entlang der Grenze zur "fröhlichen Armut"
Die "Waldheimat", der poetische und schließlich (seit 1906) auch geographische Name für die Herkunftswelt, hat im "Weltleben" ihren Kontrastbegriff. Es zu einem solchen "Weltleben" gebracht zu haben, ermöglicht erst den Kindheitsblick auf die Herkunft, die keine Zukunft mehr verheißen konnte. Je wunderloser dieses Weltleben sich ausnimmt, desto poetisch verheißungsvoller erscheint die poetisch erinnerte Waldheimat. Auch das ist kein linearer Prozess. In den zeitlich weit gestreuten Geschichten gibt es jeweils anders akzentuierte, schematisch skizzierte Welt-und Bildungserfahrungen. Momentaufnahmen vom Anpassungsdruck an das fremde bürgerliche Kulturmuster und von schulischen Ansprüchen, die den Aufsteiger zu überfordern drohen, überzeugen als Realitätspartikel und schützen die Geschichten vor dem Absinken in die sentimentale Tagtraumwelt. Dazu braucht es auch ein Widerlager in der Darstellung der bäuerlichen Kindheit, um der Wahrheit eingedenk zu bleiben, dass das, was nachträglich als poetische Heimat erscheint, keineswegs Heimat für alle bedeutete. Die Härten und Entbehrungen rückständiger Verhältnisse werden ebenso wenig verschwiegen wie das soziale Unrecht und das Elend der Dienstboten und Einleger. Roseggers Texte balancieren gleichwohl entlang der Grenze zur "fröhlichen Armut", wo selbst noch die Not und der Mangel als Genre-Herrlichkeit glänzen und die Genre-Menschlichkeit triumphieren dürfen, wie Dolf Sternberger die Ideologie dieser Gattung einmal bezeichnet hat. Der Kontrasteffekt zur "Welt" hilft, ihre soziale Pathologie zu verdrängen.
Etwas von der Pathologie beider Welten machen die Debatten über das Heimatrecht sichtbar, das in Österreich die Armenversorgung regelte. Sarkastisch spricht der Jurist und Politiker Josef Redlich in seiner Skizze der Geschichte des Heimatrechts von jenen, die "in der Regel bloß von Heimat als Sache des Gefühls und der Poesie gehört haben, nicht aber auch allzuviel von dem weniger poetischen Heimatrecht, das eine ganz besondere Umprägung des Gefühlswertes der Heimat vorstellt". Ohne Heimatrecht gibt es keinen Anspruch auf ungestörten Aufenthalt und keinen Anspruch auf Armen-und Altersversorgung. Diese Bestimmungen hatten in einer von zunehmender sozialer Mobilität gekennzeichneten Gesellschaft ungeheure Folgen, die auch von Rosegger gesehen wurden. Das österreichische Heimatgesetz von 1863 verpflichtete die Gemeinde, den, der in ihr heimatberechtigt ist, im Fall der Not zu versorgen. Da aber der Erwerb des Heimatrechts außer durch Geburt, Verehelichung oder Erlangung eines öffentlichen Amtes sehr eingeschränkt war, stimmten tatsächliche und gesetzliche Heimat immer seltener überein.
Was das in der Praxis bedeutete, hat der von Rosegger in seinen Reformvorschlägen unterstützte Politiker Heinrich Reicher so beschrieben: "Diese Fremden sind auch, so lange sie erwerbsfähig sind, selbstverständlich in jeder Gemeinde willkommen, haben aber in dem Augenblicke als sie, wenn auch nur vorübergehend, der öffentlichen Unterstützung bedürfen, einen Anspruch auf den ungestörten Aufenthalt in der Gemeinde verwirkt und werden der Heimatgemeinde zurückgeschoben. [-] Ist dies schon aus diesem Grunde eine Härte für den Einzelnen und seine Angehörigen: um wie viel greller aber muß diese Härte erscheinen, wenn man sich den Empfang vergegenwärtigt, welcher einem solch unwillkommenen Gaste in der Heimatgemeinde bereitet wird." Zu ergänzen bleibt, dass die von der ökonomischen Entwicklung pauperisierten Gemeinden auch materiell nicht immer in der Lage waren, die ohnedies minimale Versorgungspflicht zu erfüllen. Diesem "desolaten Zustand" (Redlich) des Armenwesens war zweifellos nicht mit einem poetischen Heimatbegriff beizukommen, der die Immobilität der Herkunftswelt rettet, um die Konsequenzen eines gesetzlichen Anachronismus zu vermeiden. Umgekehrt ist die zunehmende literarische Aufladung des Heimatbegriffs wohl auch als Indiz für die real produzierte Heimatlosigkeit zu verstehen.
Rechtlich garantierte Heimat
Dem Heimatschriftsteller Rosegger war die rechtlich garantierte Heimat auch in eigener Sache eine Erwähnung wert. Am 9. Dezember 1884 schreibt er nämlich an seinen Förderer und Entdecker Adalbert V. Svoboda: "Vor Kurzem hat mir die Stadt Graz das Heimatsrecht ertheilt, was mir moralisch von Wert, meinen Kindern praktisch von Vortheil ist." Im undatierten Schreiben an die Gemeinde Krieglach, Roseggers Heimatgemeinde, heißt es: "Mir ist wiederholt von massgebender Seite nahegelegt worden, für mich u. meine Familie das Heimatsrecht in Graz zu erwerben rsp. anzunehmen. Da Solches gegenüber der Zuständigkeit in einer Landgemeinde besonders für militärpflichtige Söhne von Vortheil sein soll, so habe ich mich entschlossen, meinen Knaben diesen Vortheil zuzuwenden."
Vom tatsächlichen Zustand der Armenversorgung in seiner alten Heimatgemeinde zeugt indirekt Roseggers Wunsch, für die "Heimat seines Herzens" "etwas Wesentliches u. Dauerndes wirken zu können"."Vor Allem denke ich immer wieder an ein Armen-Versorgungshaus in Krieglach, wenn ein Bestreben in dieser Richtung in der Gemeinde einmal Anklang fände."
In einer der bekanntesten Waldheimat-Geschichten Einer Weihnacht Lust und Gefahr (früher: Auf bösen Wegen bzw. In der Christnacht) taucht die übel beleumdete und von den Kindern gefürchtete "Mooswaberl" prominenter als sonst auf. Eingeführt wird sie mit einem Biogramm, das die Tücken des Heimatrechts exponiert.
"Die Mooswaberl war dagewesen, hatte glückselige Feiertage gewünscht und die Mutter hatte ihr für den Festtag ein Stück Fleisch geschenkt. Darüber war der Vater etwas ungehalten; er war sonst ein Freund der Armen und gab ihnen nicht selten mehr, als unsere Verhältnisse es erlauben wollten, aber der Mooswaberl sollte man seiner Meinung nach kein Almosen reichen. Die Mooswaberl war ein Weib, das gar nicht in die Gegend gehörte, das unbefugt in den Wäldern umherstrich, Moos und Wurzeln sammelte, in halbverfallenen Köhlerhütten Feuer machte und schlief. Daneben zog sie bettelnd zu den Bauernhöfen, wollte Moos verkaufen, und da sie keine Geschäfte machte, verfluchte sie das Leben. Kinder, die sie ansah, fürchteten sich entsetzlich vor ihr und viele wurden krank; Kühen tat sie an, daß sie rote Milch gaben."
Selbst in den unübersichtlichen Winkeln und Gräben der Waldheimat ist kaum Schutz zu finden. Das Abseits ist kein sicherer Ort für Flüchtlinge; nur an der Grenze zur Wildnis und zu der eigenen Verwilderung können sie ihre Existenz fristen, angewiesen auf das christliche Almosen. So heißt es in der Erzählerrede über die Außenseiterin, der selbst der Vater des Waldbauernbuben nichts Gutes will: "Als man draußen in einem Dorfe vor Jahren das Schulhaus baute, war dieses Weib mit dem Manne in die Gegend gekommen und hatte bei dem Baue mitgeholfen, bis er bei einer Steinsprengung getötet wurde. Seit dieser Zeit arbeitete sie nicht mehr und zog auch nicht fort, sondern trieb sich herum, ohne daß man wußte, was sie tat und was sie wollte. Zum Arbeiten war sie nicht mehr zu bringen; sie schien geisteskrank zu sein. [-] Der Richter hatte die Mooswaberl schon mehrmals aus der Gemeinde gewiesen, aber sie war immer wieder zurückgekommen.'Sie würde nicht immer zurückgekommen sein', sagte mein Vater, 'wenn sie in dieser Gegend nichts gebettelt bekäme. So wird sie hier verbleiben und wenn sie alt und krank ist, müssen wir sie auch pflegen; das ist ein Kreuz, welches wir uns selbst an den Hals gebunden haben.' Die Mutter sagte nichts zu solchen Worten, sondern gab der Mooswaberl, wenn sie kam, immer das gewohnte Almosen, und heute noch etwas mehr, zu Ehren des hohen Festes."
Verweigerte Nächstenliebe
Rosegger setzt das Elternhaus des Waldbauernbuben ganz an den Rand der Wildnis, deren Doppelcharakter die Sammlung seiner Geschichten entscheidend prägt. An den Rändern, nah der Wildnis, endet zwar nicht das Gesetz, aber es ist nicht mehr in aller Konsequenz durchsetzbar. Die institutionell verweigerte Unterstützung kann durch Almosen nur schlecht und recht kompensiert werden. Roseggers Erzählung setzt zwar einen Mechanismus der Zweckethik in Gang, demzufolge das erteilte Almosen unmittelbar fruchtet, aber das Rätsel der Mooswaberl behält seine Wucht als Anklage der verweigerten Nächstenliebe.
Zumindest im Elternhaus findet ein Umdenken statt und die Mooswaberl findet für den Rest ihrer Tage Unterschlupf. Als sich nämlich herausstellt, dass sie den verirrten Sohn in der Christnacht vor dem Erfrieren gerettet hat, richtet ihr der Bauer eine Kammer ein. Die Stigmatisierte mutiert, ähnlich wie der jüdische Wanderhändler Maischel in der von Gottfried Keller gelobten Geschichte Wie ich mit der Thresel ausging und dem Maischel heimkam, zur Helferfigur. Zumindest der Besitzer des Hofes in der Einschicht revidiert daraufhin sein Vorurteil. In der Erzählerrede nimmt die zunächst typisierte Gestalt tragische Züge an. "Und sie blieb bei uns. Oft strich sie noch in den Wäldern umher und brachte Moos heim, dann ging sie wieder hinaus zur Kirche und saß auf dem Grabhügel ihres Mannes, von dem sie nicht mehr fortzuziehen vermochte in ihre ferne Gegend, in der sie wohl auch einsam und heimatlos gewesen wäre, wie überall. Über ihre Verhältnisse war nichts Näheres zu erfahren, wir vermuteten, daß das Weib einst glücklich gewesen sein müsse, und daß der Schmerz über den Verlust des Gatten ihr den Verstand geraubt habe.
Wir gewannen sie alle lieb, weil sie ruhig und mit allem zufrieden lebte und niemandem das geringste Leid zufügte."