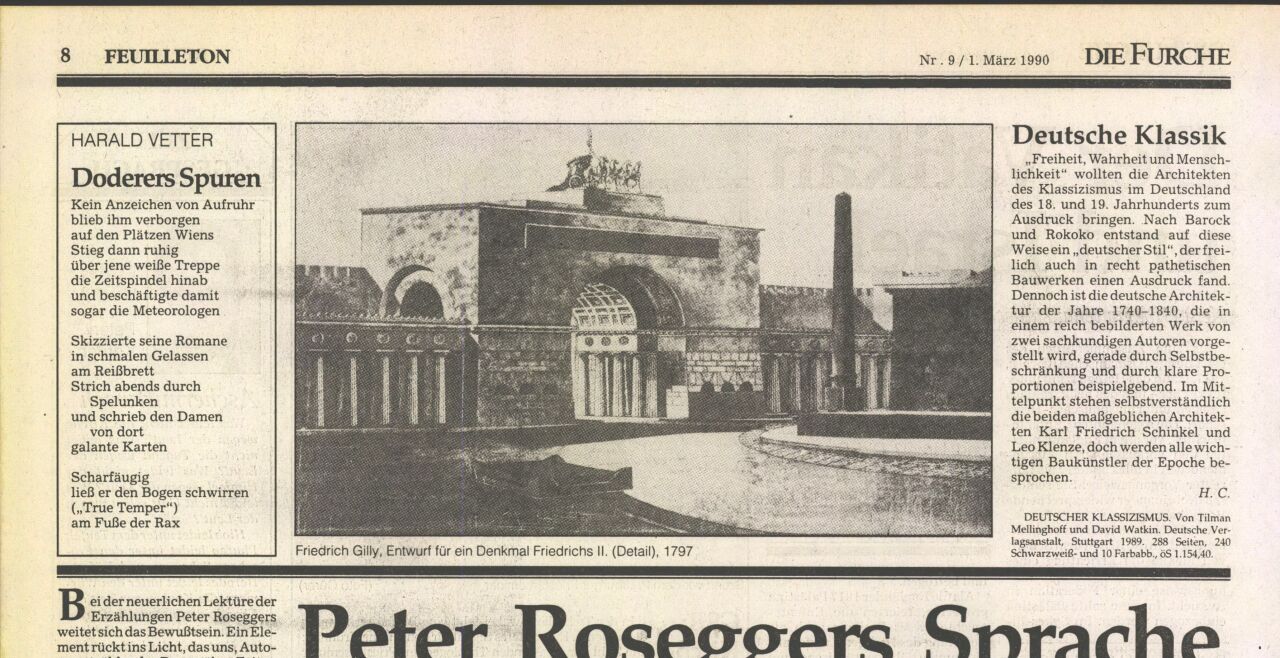
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Peter Roseggers Sprache Deutsche Klassik
Bei der neuerlichen Lektüre der Erzählungen Peter Roseggers weitet sich das Bewußtsein. Ein Element rückt ins Licht, das uns, Autoren erzählender Prosa, über Zeiten und Räume hinweg - und also auch mit Peter Rosegger - verbindet. Die Beschäftigung mit dieser Frage führt zu einem Punkt, an dem die Eigenart des Talents, vielleicht des Genies, von Rosegger zu orten ist, wie nicht anders zu erwarten in jenen Momenten der künstlerischen Arbeit, in denen sich das Instinktive mit dem Bewußtsein berührt. Das Ergebnis wird in der Sprache faßbar.
Roseggers Prosa wurde und wird von einer breiten Leserschaft als einfach, volkstümlich und ergreifend, von den Ästhetikern der modeinen Kunstprosa allerdings weniger geschätzt. In diesem Befremden kommen ein zeitbedingter Generationskonflikt, ein verallgemeinerndes Werturteil und ein Irrtum zum Ausdruck.
Zum ersten: Autoren, die, wie Rosegger, im Jahre 1843 geboren und dem Publikum 1864 vorgestellt worden waren, mußten von den Schriftstellern der nächsten Generation, die im Begriffe waren, ihre eigene Geltung hervorzuheben, zum alten Eisen geworfen werden, welche Geste in diesem Falle durch jene literarische Zeitenwende, die die Moderne aufkommen ließ, freilich noch mehr erleichtert wurde. Im Jahre 1864 wirkten noch diejenigen gesellschaftlichen Kräfte, die - teils in Erinnerung an die nationalen Leidenschaften der Napoleonischen Kriege und an die Ideen des Revolutionsjahres 1848, teils von jener gesellschaftskritischen Sachlichkeit erfüllt, die den Naturalismus hervorbringen sollte - das Hervortreten sogenannter „Naturdichter" begünstigten, und zu diesen wurde mit einigem Recht auch Peter Rosegger gezählt. Die Bezeichnung traf wohl die Herkunft seiner Sprachkunst, die Lebensrolle, die er spielte und darstellte, auch den Begriff, der zur Zeit der allgemeinen Industrialisierung in den Mittelpunkt einer nostalgischen Sehnsucht rückte, nicht aber das Wesen Roseggerscher Epik - doch darüber später.
Das verallgemeinernde Werturteil indessen wandte sich gegen die „Widerspiegelung der Welt" im Namen der „Neuschöpfung der Welt", gegen die „Natur- und Lebensschilderung" im Namen der „Stilisierung", gegen den „schlichten Bericht" im Namen der „Belebung durch die Idee", letztlich auch gegen das „Volkstümliche" im Namen des Artifiziellen. Solche scharfen Abgrenzungen werden jedesmal ins Spiel gebracht, sobald die eigene Identität nicht mit Sicherheit gefunden und definiert, sondern erst durch eine Geste des Fanatismus zum Selbstgefühl und Selbstbewußtsein verdichtet werden kann.
Der Irrtum, der zum Generationskonflikt und zur Verallgemeinerung als drittes Element hinzukam, betraf und betrifft Peter Roseggers Sprache und damit das Wesen seiner Epik. Diese ist an ihren Höhepunkten nicht das Werk eines „Naturdichters", sondern eines Autors, der in jenen Augenblicken und Stunden der Arbeit, in denen Ihspiration und bewußter Formwille ineinanderfließen, um die höchste Genauigkeit des Ausdrucks -damit aber auch um ihre lichteste und geheimnisvollste Poesie -kämpft. „Wir alle kommen aus Gogols Mantel", hat Dostojewski gesagt, und mit demselben Recht müßten wir, österreichische Erzähler, zugeben müssen: „Wir alle kommen aus dem .Nachsommer' Adalbert Stifters." Auch Rosegger hat, auf seine Art, Stifters Sprachlichkeit weitergeführt.
Einige Beispiele genügen, um Roseggers Methodik, die sowohl instinktiv wie bewußt ist, zu begreifen. Sie stammen alle aus der kurzen Erzählung „Allerlei Spielzeug", das als drittes Prosastück der bekannten Sammlung „Als ich noch ein Waldbauernbub war" einer breiten Leserschaft bekannt ist. Das Thema selbst führt freilich auf ein Gebiet, das keine moralische Belehrung, sondern pure Darstellung fordert und damit den inneren Weg jenen Seelenkräften öffnet, die im Sinn des L'art pour l'art mit dem Gegenstand spielen wollen. In diesem Spiel allerdings liegt wohl die einzige Möglichkeit, das Thema Spiel künstlerisch zu bewältigen.
„Ich habe als Kind mir meine Welt, die von Natur höllisch klein war, auseinandergedehnt", mit diesem Halbsatz, der die Erinnerungen einleitet, wird eine elementare Regung zum Ausdruck gebracht, deren Heftigkeit durch das Beiwort „höllisch" gleichsam mit zuckenden Flammen beleuchtet wird, deren Realität aber zugleich als poetisch - das heißt in diesem Falle nicht aus der Erinnerung abgeleitet - betrachtet werden muß, denn den meisten Kindern ist die „Kleinheit" ihrer Welt nicht gegenwärtig. Die Erklärung des Erzählers grenzt an eine literarische Konstruktion, bringt eine viel später erkannte Kraft, eine als glaubhaft annehmbare Hypothese zur Wirkung. Es handelt sich um einen Kunstgriff.
Nun wird eine alte Holzfäller hütte in einem ebenen Waldstück vorgestellt, dem Kinde anheimelnd seit dem Tag, an dem es hier mit dem Knecht Karten gespielt hatte. „Mir war dieser Bau", schreibt Rosegger, „unheimlich gewesen bis zu jenem Tage, da mich und unseren Knecht Markus im Walde ein scharfer Wetterregen überraschte und wir uns in die Hütte flüchteten." Die beiden spielen nun, „bis draußen die nassen Zweige funkelten und die helle Sonne zum Fenster hereinschien".
Man setze nun die drei Sprachbilder - den „scharfen Wetterregen", das Funkeln der „nassen Zweige" und zugleich das Licht der „hellen Sonne", die - offenbar lange nach der Mittagsstunde - „zum Fenster hereinschien". Bereits das Wort „Wetterregen", mundartlich gesichert und an der gewählten Stelle zugleich artifiziell, enthält Magisches; seine „ Schärfe " evoziert das Gefühl von Heftigkeit und Kürze, aber auch das graumetallene Blinken eines breiten Messers. Dieses Licht wandelt sich zum Funkeln der nassen Zweige, das im Schein der hellen Sonne plötzlich erstrahlt. Man mag das Sprachbild Roseggers - dessen aus Genauigkeit gewonnene Perfektion - als Hervorbringung eines instinktiven Talents bewundern, doch ist solche Naivität einer vermeintlichen Naivität gegenüber angesichts der nächsten Passage gewiß nicht am Platze.
In dieser baut sich das Kind aus den Blättern eines Buches „die große Weltstadt Paris" auf und kommt nun zum tätigen Spielen mit dem Halbsatz: „Als der Tisch voll geworden war und ich trunkenen Blickes hinschaute auf die vieltür-mige Stadt und ihre belebten Gassen, die ich gegründet und wie ein Schutzgeist beschirmte, dachte ich: ..." Das Bild von der vermeintlichen „Kleinheit" der Kinderwelt wird hier weitergeführt durch die nachträgliche Interpretation, die, uns allen vertraut, ins Archetypische reicht: Begründer und zugleich Schutzgeist einer selbst errichteten, leicht beherrschbaren eigenen Welt zu sein, die in diesem Fall - es handelt sich um ein Element der mittelalterlichen Gelehrtensprache - aus einer vieltürmigen Stadt besteht, weitet das Selbstgefühl. Deshalb betrachtet der Kleine „die große Weltstadt Paris" nicht verwundert oder geängstigt, sondern -der Drang der Genauigkeit stößt abermals ins Artifizielle - „trunkenen Blickes".
Noch in derselben Erzählung lüftet Rosegger übrigens das Geheimnis seiner Sprache. Er berichtet über sein erstes Leseerlebnis „ im grünen Grase": „Ein Buch, ein seelenvolles Buch genießt man dort ganz aus und gedeiht dabei."
Ähnliche Beispiele ließen sich in vielen anderen Prosastücken dieses angeblichen „Naturdichters" finden, allerdings gibt es im Geflecht der Erzählungen zuweilen freilich auch Absätze und ganze Seiten, die den Sprachfluß nicht verdichten, sondern einer vorübergehenden Schwäche des Arbeitsvorgangs verfallen, das heißt: die auf Genauigkeit dringende Form durch das fertige Klischee ersetzen. Selbst die geschliffene Prosa Gustav Flauberts, ja die auf funkelnde Augenblicke konzentrierte, Erinnerungen evozierende und gestaltende, sich als souveränes Kunstwerk aus der Phantasie lösende Sprachlichkeit Marcel Prousts ist von solchen Rückfällen ins Schemenhafte nicht frei: Dari;^ liegt keine Entschuldigung der Folgen künstlerischer Ermattung, wohl aber der Beweis dafür, daß Peter Roseggers Werk mit der Prosa der besten und subtilsten Erzähler verglichen werden kann - und das auch sollte.
Wenn wir aber danach fragen, was in solchen Augenblicken des Arbeitsprozesses tatsächlich vor sich geht, so bleibt uns nichts anderes übrig als die Antwort metaphorisch zu formulieren. Die Wirklichkeit läßt sich in diesem Fall nur als etwas Transzendierendes fassen. Denn es ist die Stimme der Seele, die in solchen Sekunden erklingt, zur Sprache und zur Schrift wird, und vielleicht ist es allein das selbstverständliche Gefühl, eine Seele zu besitzen, ja vor allem diese Seele zu sein, das den Autor zwingt, einerseits die staunenden Erfahrungen dieser Seele während ihres Verweilens in der als materiell empfundenen Wirklichkeit darzustellen, andererseits aber im Körperlosen zu verharren, nämlich in der Sprachlichkeit, die Hauch und Musik ist, Rhythmus und - in ihrer unhörbaren Erscheinungsform -eine unentwirrbare Einheit von aufkommenden, herbeigesehnten oder auch herbeigezwungenen, aber auch in diesem Fall flüchtigen Empfindungen und Gedanken -nur selten die Ergebnisse eines blitzartigen Begreifens. In der Prosa Peter Roseggers ist die Sprache der Seele immer wieder zu vernehmen.
Deshalb bleibt sein Beispiel für uns, Autoren erzählender Prosa der Gegenwart, nicht nur lehrreich, ja, was die Geheimnisse der Kunst -oder, bescheidener gesprochen, unserer Kunstfertigkeit - betrifft, richtungweisend, sondern in einer ganz bestimmten Art bezaubernd. Sobald wir, nach Zeiten des Zweifeins, die Analogien zwischen Poesie und Religion wieder einmal entdecken, vermag uns - bei Ertönen der Engelsprache der Seele - Peter Roseggers Sprachlichkeit über den Augenblick des Staunens hinwegzuhelfen: Siehe da, vielleicht ist es doch keine Halluzination!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































