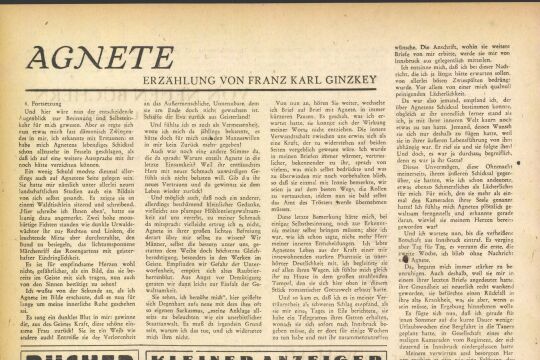Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Peter Rosegger an Wilhelm Kienzl
„Alle Ehren der Tonkunst! Doch höher noch preise ich jene himmlische Musik, die nur dreimal auf Erden dir Glücklichem klingt: Wenn deine Mutter dich ruft: Du gutes Kind! Wenn dein Bräutchen dir flüstert: Ich liebe dich! Wenn dein Kind das erstemal den Namen: Vater stammelt — das ist Musik, die, ein ewiges Lied der Menschheit, durch alle Saiten unserer Nerven fiebert. Ein goldener Hammer, der dreimal an die Glocke unseres Herzens schlägt.”
Mit diesen Worten, die Rosegger seinem jungen Freunde Kienzl am 5. Oktober 1875 ins Stammbuch geschrieben hat, wird eine Künstlerfreundschaft eröffnet, die sich bis zum Tode des Dichters vor nunmehr dreißig Jahren, am 26. Juni 1918, lebendig erhielt und ihren Niederschlag in einem umfangreichen Briefwechsel von persönlichster Art gefunden hat. Im gastfreien Hause des Grazer Bürgermeisters, Dr. Kienzl sen., begegnen die beiden einander zum erstenmal und schon wenig später berichtet Rosegger seinem nach Prag gereisten Freund:
„Ich komme sehr oft zu Ihren lieben Eltern, idie ich womöglich noch immer mehr schätzen und verehren lerne. Die nimmer erschöpfte Geistesfrische und Herzenswärme der Mutter, das schlichte, offene, wohlwollende Wesen des Vaters heimeln mich sosehr an. Ich fühle mich in Ihrem Hause nicht im ,Salon , sondern in einem Daheim.”
Was ist natürlicher, als daß Kienzl, im Banne Wagners stehend und seine ersten musikdramatischen Gehversuche beginnend, an Rosegger mit der Bitte um ein Textbuch herantritt. Allein Rosegger antwortet:
…Ein lyrisches Gedicht in Versen, eine orientalische Idylle, die in Musik gesetzt werden soll — welch prächtige Idee! Aber ich kann keine Verse machen! Wohl, ich habe deren genug schon gemacht, ich habe über 300 hochdeutsche Gerichte verfaßt, aber sie stehen noch tief unter der Mittelmäßigkeit; und daß ich es trotz der vielen Übung zu keiner Fertigkeit brachte, beweist mir leider, daß ich für die gebundene Sprache verloren bin. Und aufrichtig gestanden, habe ich diese meine Unfähigkeit kaum jemals bedauert … und gesetzt, ich könnte es, so würde ich wahrscheinlich in der Auswahl des Stoffes sehr ungeschickt sein. Wenn ich ans Orientalische denke, so komme ich gleich an die Bibel, so zieht’s mich in den Zauberkreis der Lebensgeschichte Jesus, und hier finde ich Maria Magdalena, aus der sich nach meiner Meinung mehr machen ließe, als bisher von den Poeten gemacht worden ist. Dann wäre dieser Gegenstand nicht lyrisch, sondern episch oder dramatisch zu behandeln. Der erste Teil einer solchen Maria Magdalena könnte idyllenartig sein, aber der letzte ist tragisch …”
Die von Rosegger seiner Ablehnung wegen befürchtete Verstimmung tritt nicht ein. Im Gegenteil: das Freundschaftsverhältnis vertieft sich. Manche Depression, die ihre Wurzeln in der schon frühzeitig angegriffenen Gesundheit des Dichters und im tiefen Bewußtsein seiner ethischen Verantwortung haben mag, findet in den vergilbten. Briefpapieren Gestalt. Unter dem 25. November 1899 findet sich das folgende ergreifende Dokument:
„Weißt Du, lieber Freund, wie das tut, wenn man müde ist, wenn man fühlt, wie die Schaffenskraft zu Ende geht? Du weißt es nicht. Die ruhige, gleichmäßige ernste Stimmung der Arbeit ist dahin, ein imwirtlicher Galgenhumor ist an ihre Stelle getreten und die Purzelbäume, die man macht, vermögen über die Erschöpfung nicht hinwegzutäuschen. Wenn so der Lebensinhalt anfängt zu fehlen, da wird es öde auf der Welt! Da macht man taube Torheiten, und gut noch, wenn die einem nicht verübelt werde. weil mancher zum Teil so taxiert ist, daß er machen und sagen kann, was er will. Ich sollte in keine Gesellschaft gehen, weil das uf eine Lüge, allerdings auf eine unbeabsichtigte, hinauskommt. Man gibt sich gerade als das Gegenteil von dem, was man ist und wie man’s meint. Woher kommt das? Bin ich erst aufgezogen, dann vermag ich nichts mehr an mir zu regeln. Ich sage, was mir einfällt, ohne jegliche Erwägung, wie es aufgenommen und verstanden wird. Da kann man bisweilen von den intimsten Freunden mißdeutet werden.
Mir ist eine gewisse Klugheit eigen, darauf hin, daß ein mäßiges Streben nach Vorteil andern nicht schadet. Anderen nicht schaden ist das Erste, mir selbst zu nützen das Zweite. Diese Klugheit schützt vor dem Schlimmsten. Aber mir mangelt jene Schlauheit, sich gerade so zu zeigen, wie man will, daß man gesehen werde. Ein paar Freunde möchte ich einmal in mein Inneres sehen lassen könneh. Sie würden staunen. Sie würden keinen Besseren dort finden, als sie erwarteten, eher einen noch Untergeordneteren, aber sie würden einen absolut anderen finden. Dreißig Jahre lang habe ich in der Absicht, wahr zu sein, aus mir herausgeschrieben und nun muß ich mir sagen, der Abstand zwischen mir und den Zeitgenossen ist größer als je. Ich bin ganz unzulänglich für das gegenwärtige geistige Leben, ich führe eine ganz andere Existenz, eine, die mir selbst immer dunkler wird. Je mehr Gesellschaftlichkeit, je größer die Vereinsamung. Kannst Du das verstehen? — Das kann noch eine lange Zeit des Un, befriedigtseins geben, bis das sättigende Alter kommt. Und diese öde Popularität, wenn man empfindet, wie unzulänglich, wie nichtig alles ist, was man „geschaffen”. Du sagst gerne, ich genösse so viel Liebe. Ich glaube das sogar, ich bin innig dankbar dafür, daß die Leute mir dankbar sind. Aber das ist nicht genug, die Hauptsache ist, daß man selbst mit sich —wenn auch nicht zufrieden— so doch ausgesöhnt ist. Ich bin nicht mit mir ausgesöhnt, weil ich nicht so bin, als ich sein möchte. Ich bin den Menschen gegenüber zwar treu gesinnt, aber nicht liebevoll, nicht opferfähig genug. Wohl war es mir gegönnt, durch meine Vorlesungen, besonders für gemeinnützige Zwecke, etwa dreimal so viel zu leisten, als mir selbst geblieben ist. Aber das ist noch nicht das Rechte. Wenn auch meine Gesundheit darunter gelitten hat, die Mühe war doch noch zu klein. Ein persönliches, empfindliches Hinopfern für andere ist es allein, was uns mit uns versöhnt und uns erlöst. Und dazu, siehst Du, bin ich zu schwach.”
Diesem tiefen Ernste steht der herzliche, manchmal ausgelassene Frohsinn einer Tafel- runde gleichgestimmter Grazer Künstler gegenüber, die, kurz der „Krug” benannt, von Rosegger überaus gerne besucht wurde und zu der er öfter in launigen Versen einlud.
Die Freude dieser von sprühendem Witz und lächelndem Humor gewürzten Abende wird mit fortschreitender Zeit immer öfter getrübt. Roseggers Gesundheitszustand verbietet es ihm, die heitere Gesellschaft aufzusuchen, und wie dann der große Krieg hereinbricht, da zerstiebt die „Feuchtfröhlichkeit” und zurückbleibt ein erschütternder Brief, in dem die Zensur nichts leserlich ließ, als die Worte:
„…Aber anderes ist schlimmer. Das schauderhafte Menschenabschladiten und kein Absehen! Selbst im Falle des Sieges leidet der Glaube an die Menschheit.”
Und ein Jahr später, im Oktober 1916, finden sich die folgenden, in ihrer tiefsten Bedeutung erst heute erkennbaren Zeilen, hingeschrieben von einer zitternden, vom Leid der Kreatur gebeugten Hand:
… Jetzt sieht es schlecht aus. Ich meine nicht das Politische und Strategische. Ich sehe den Haß zwischen den Völkern, der offiziell und inoffiziell so wie noch nie geschürt wird und der täglich wächst und es wirklich aui die Austilgung. Vernichtung der gegne rischen Völker abgesehen zu haben scheint Die Technik, auf die man sich so viel einbildet, zerstört die Kulturwerte und wirft die Menschheit zurück in die Barbarei. Audi gut. Ich habe nie viel von ihr gehalten. Sie soll nur schauen, daß sie — das Leiden kürzend — bald fertig wird mit uns allen, auch mit uns, die wir zu Barbaren uns doch nicht gut eignen, aber auch für echte Gesittung nicht das rechte Zeug haben. Vernichtet und wieder gekommen wollen wtr dann von neuem anfangen, im Sack arm wie Hirten, im Herzen reich wie Kinder, ein würdigeres Leben zu führen. Die zuversidit- liche Freude an dierer Zukunft läßt mich in Gottes Namen ruhig ertragen, was jetzt ist und sich weiterentwickelt. Nichts zu fürchten nichts zu hoffen macht uns frei,”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!