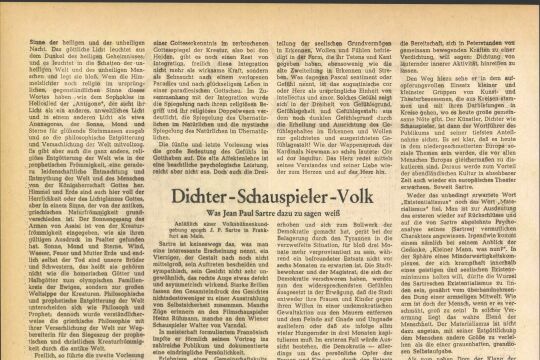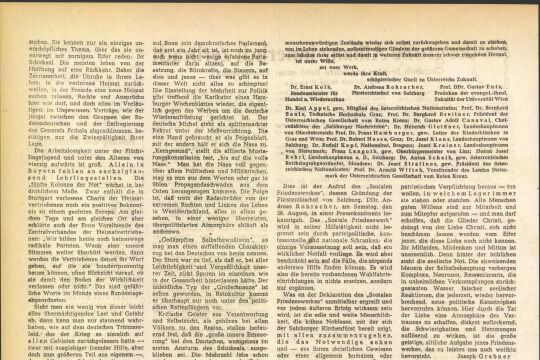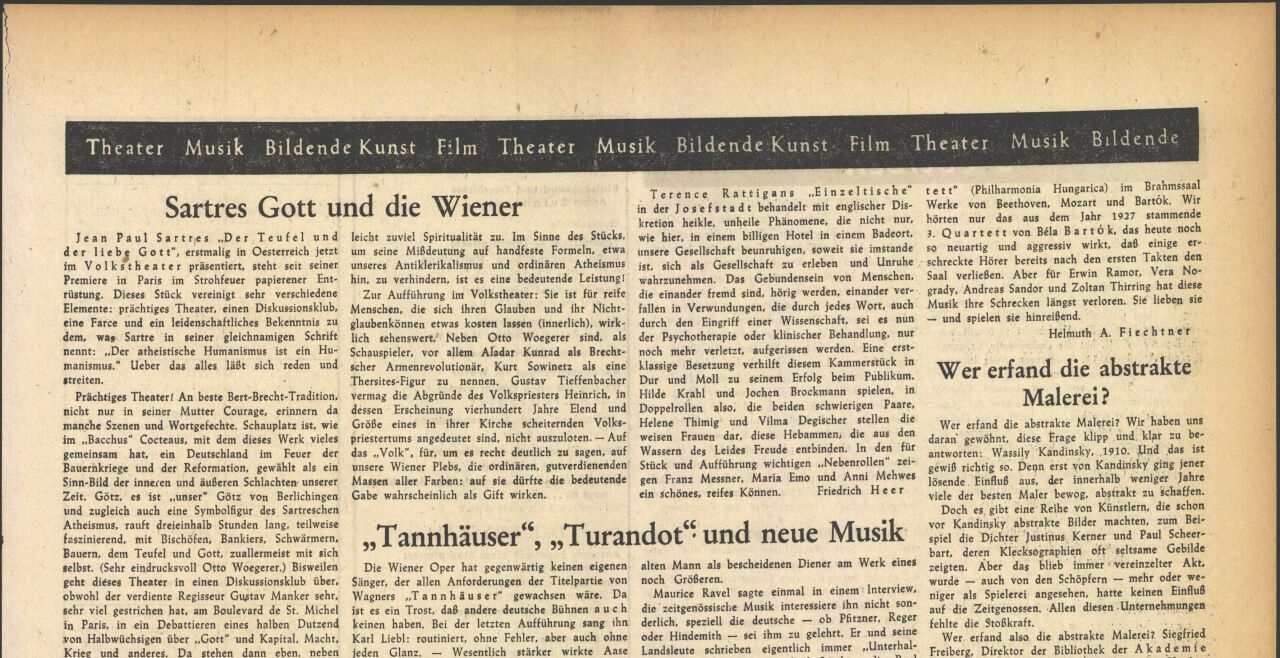
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Sartres Gott und die Wiener
Jean Paul Sartres „Der Teufel und der lieb| Gott“, erstmalig in Oesterreich jetzt im Volkstheater präsentiert, steht seit seiner Premiere in Paris im Strohfeuer papierener Entrüstung. Dieses Stück vereinigt sehr verschiedene Elemente: prächtiges Theater, einen Diskussionsklub, eine Farce und ein leidenschaftliches Bekenntnis zu dem, was Sartre in seiner gleichnamigen Schrift nennt: „Der atheistische Humanismus ist ein Humanismus.“ lieber das alles läßt sich reden und streiten.
Prächtiges Theater/ An beste Bert-Brecht-Tradition, nicht nur in seiner Mutter Courage, erinnern da manche Szenen und Wortgefechte. Schauplatz ist, wie im „Bacchus“ Cocteaus, mit dem dieses Werk vieles gemeinsam hat, ein Deutschland im Feuer der Bauernkriege und der Reformation, gewählt als ein Sinn-Bild der inneren und äußeren Schlachten unserer Zeit. Götz, es ist „unser“ Götz von Berlichingen und zugleich auch eine Symbolfigur des Sartreschen Atheismus, rauft dreieinhalb Stunden lang, teilweise faszinierend, mit Bischöfen, Bankiers, Schwärmern, Bauern, dem Teufel und Gott, zuallermeist mit sich selbst. (Sehr eindrucksvoll Otto Woegerer.) Bisweilen geht dieses Theater in einen Diskussionsklub über, obwohl der verdiente Regisseur Gustav Manker sehr, sehr viel gestrichen hat, am Boulevard de St. Michel in Paris, in ein Debattieren eines halben Dutzend von Halbwüchsigen über „Gott“ und Kapital, Macht, Krieg und anderes. Da stehen dann eben, neben scharfgeschliffenen Sätzen, montierte Halbwahrheiten und erstaunliche Plattituden. Eine Farce: wie viele andere Stücke Sartres ist auch dieses ein Experiment, eine Montage, ein Erproben, wie Thesen, Rollen, Reflexe „ankommen“. Wobei die Farce den Charakter des Pamphlets, des Angriffes auf den „lieben Gott“ der Bürger, der Bien-pensants, der „Wohlmeinenden“, wählt. Und dabei weit übers Ziel schießt.
Sartre stellt nicht nur den „lieben Gott“ der Bourgeoisi in Frage, diesen „lieben Gott“, der mit Krieg, Elend, Aberglaube, Angst des Menschen, mit viel Phrasen und humanitärem Gerede zu tun hat, sondern, wie er meint, Gott überhaupt. In Sartres „atheistischem Humanismus“ sind verschiedene Elemente zu unterscheiden. Das edelste Element in ihm ist das, das Simone Weil (ohne Bezug auf Sartre) als jenen Atheismus angesprochen hat, der notwendig ist, als Salz, um den Glauben zu stärken und zu erneuern; und der von Karl Rahner, vielleicht dem bedeutendsten lebenden katholischen Theologen, als „bekümmerter Atheismus“ angesprochen wird: ein Erschrecken über die „Abwesenheit Gottes“ in der Welt (Sartre-Götzens Hymnus über diese „Nacht der Gottheit“, des Nichts, klingt wie direkt übernommen“ aus der .'.dunklen Nacht“ des Johannes vom Kreuz).
Nun verbinden sich aber bereits bei Sartre mit Elementen des „bekümmerten Atheismus“ und eines nonkonformistischen, außerkirchlichen Christentums andere unreinere Elemente eines vulgären und ordinären „Atheismus“, der vielleicht gar nicht diesen Namen verdient, landab landauf aber heute vielvertreten dargelebt wird. Es kann dem Volkstheater der Vorwurf nicht erspart bleiben, unwissentlich und wohl ungewollt, diesem ordinären Atheismus, der kein Salz zu sein vermag weder für Christen noch für Nichtchristen, in der Aufführung etliche Avancen geschaffen zu haben. Am meisten vielleicht durch die „unschuldigen“, völlig fehl am Platze, verführerischen Kostüme. Da Erzbischof und Bischof hier in sehr „echten“ Ornaten katholischer Kirchenfürsten unserer Zeit erscheinen, wird das Publikum gezwungen (und, wie die Reaktion mancher bei der Premiere zeigte, folgt es nur zu gern dieser Verführung!), hier „Pfaffen“, reiche Pfaffen zu sehen, wie sie die antiklerikale Propaganda diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs als Proletenschreck mit schrecklichen Erfolgen an die Wand malt, an die Laternen hängt, aufs Schafott schickt. Schade, sehr schade. Eine umsichtige Regie und ein wohlberatenes Kostüm hätte hier viel bessern können: wenn hier, wie in guten Aufführungen von Honegger-Claudels „Jeanne d'Arc“, die Prälaten stilisiert, als ewig gültige Symbole gewisser Versuchungen und Positionen herrscherlicher Mächte und Figuren, erscheinen, wird das Publikum gezwungen, nicht seinen leicht weckbaren Lüsten und Ressentiments sich hinzugeben, sondern nachzudenken. Sich zu öffnen für die Gründe und Abgründe, die Fragen, die hier an jeden gestellt sind. Georg Schmid hat in eben diesem Sinne seine Bühnenbilder gestaltet. Im Sinn bester Brecht-Ijadi-tion, sind sie Einladungen an das Publikum, die Räume, Tiefen und Untiefen, die Leerräume vor allem, die bewußt und gewollt in diesem Drama Sartres zugegen sind, wahrzunehmen und spontan auf sie zu reagieren. Völlig fehl am Platze ist ja ein' Verständnis dieses Sartr.eschen Stückes als eines historischen Stückes (dazu, unter anderem, verführen die Kostüme!), aber auch als eines geschlossenen Stückes, das. wie ein Einsiedeglas, Formen und Formeln liefert. Etwa so: nun wissen wir es wieder, der liebe Gott ist tot, gehen wir nach Hause, schmausen und schlafen wir weiter. Nein, so billig will sich Sartre nicht „nehmen“ lassen, er fordert heraus, reizt auf, und hat ein Recht darauf, daß seine Herausforderung angenommen wird. Schmids Bühnenbilder unterstreichen diese Herausforderung, sie muten einem Wiener Publikum, das gern alles auf dem Teller haben will, auch das Drama als Sachertorte, viel-
leicht zuviel Spiritualität zu. Im Sinne des Stücks, um seine Mißdeutung auf handfeste Formeln, etwa unseres Antiklerikalismus und ordinären Atheismus hin, zu verhindern, ist es eine bedeutende Leistung!
Zur Aufführung im Volkstheater: Sie ist für reife Menschen, die sich ihren Glauben und ihr Nichtglaubenkönnen etwas kosten lassen (innerlich), wirklich sehenswert. Neben Otto Woegerer sind, als Schauspieler, vor allem Aladar Kunrad als Brechtscher Armenrevolutionär, Kurt Sowinetz als eine Thersites-Figur zu nennen. Gustav Tieffenbacher vermag die Abgründe des Volkspriesters Heinrich, in dessen Erscheinung vierhundert Jahre Elend und Größe eines in ihrer Kirche scheiternden Volks-priestertums angedeutet sind, nicht auszuloten. — Auf das „Volk“, für, um es recht deutlich zu sagen, auf unsere Wiener Plebs, die ordinären, gutverdienenden Massen aller Farben: auf sie dürfte die bedeutende Gabe wahrscheinlich als Gift wirken.
Terence Rattigans „Einzeltische“ in der Josefstadt behandelt mit englischer Diskretion heikle, unheile Phänomene, die nicht nur, wie hier, in einem billigen Hotel in einem Badeort, unsere Gesellschaft beunruhigen, soweit sie imstande ist, sich als Gesellschaft zu erleben und Unruhe wahrzunehmen. Das Gebundensein von Menschen, die einander fremd sind, hörig werden, einander verfallen in Verwundungen, die durch jedes Wort, auch durch den Eingriff einer Wissenschaft, sei es nun der Psychotherapie oder klinischer Behandlung, nur noch mehr verletzt, aufgerissen werden. Eine erstklassige Besetzung verhilft diesem Kammerstück in Dur und Moll zu seinem Erfolg beim Publikum. Hilde Krahl und Jochen Brockmann spielen, in Doppelrollen also, die beiden schwierigen Paare, Helene Thimig und Vilma Degischer stellen die weisen Frauen dar, diese Hebammen, die aus den Wassern des Leides Freude entbinden. In den für Stück und Aufführung wichtigen „Nebenrollen“ zeigen Franz Messner, Maria Emo und Anni Mehwes ein schönes, reifes Können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!