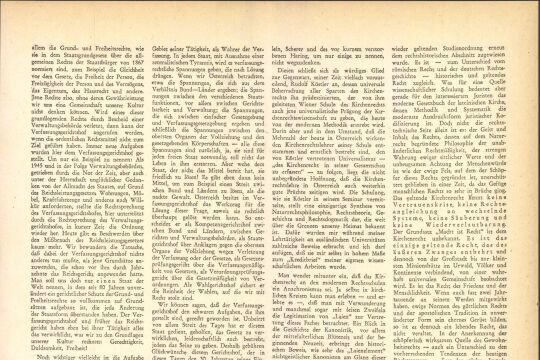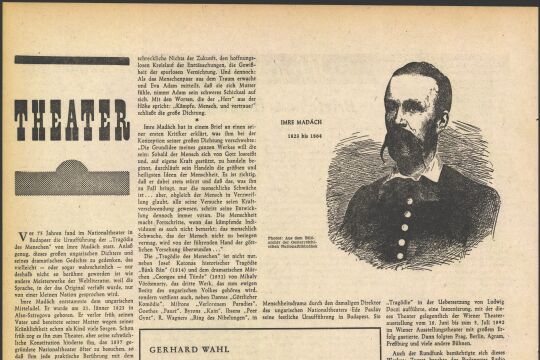Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schwedischer Frühling
Der wirkliche Dichter steht immer in der Zeit, mag er Gegenwart oder Vergangenheit, Völker- oder Einzelschicksale schildern. Selbst ein 60 abseitiges Geschehen, wie es uns Selma Lagerlöf in der Geschichte des alten Jan Andersons, des .Kaisers von Portugal 1 i e n“, erzählt, wächst ins Übermenschlich-Bestimmende durch die Kraft seiner Kunst. Jan Anderson liebt seine Tochter über alles, und da sie in der Stadt in schlechte Gesellschaft gerät und sich nicht mehr heimwagt, 6chlägt ihn der Herr aus Gnade mit Wahnsinn: Anderson hält sich für den Vater einer Prinzessin. Verlacht von seinen Dorfgenossen läßt er sich diesen Irrglauben nicht rauben, bis er in den Armen der spät und zur „feinen Dame“ verwandelt Heimkehrenden sterben darf, in seinem Herzen triumphierend, die .Prinzessin“ vor bösen Verfolgern gerettet zu haben. Der Triumph des Wahnsinnigen erweist sich als höhere Wahrheit: an der Leiche des Vaterö löst die Tochter ihre Bindungen an eine Welt des Übels. Die'Aufführung des von Poul Knudsen gut dramatisierten Romans wurde unter der Regie Gustav Dieffenbachers, die fern jeder vielleicht nahelijg^nden Effekthascherei in aschlichter, geschlossener Form, aber dabei hintergründig-großartig das erschütternde Schicksal Leuen werden ließ, und durch die Darstellung Herbert Herbes zum besten Abend des Grazer Schauspielhauses in den letzten Jahren.
Läßt uns Lagerlöf die Transzendenz unmittelbar als zweite Wirklichkeit erleben, so greift diese aus fremder Sphäre in das Schicksal der Menschen in Strindbergs Passionsspiel „Ostern“, das die Kammer6piele in einer eigenartigen Dämmerinszenierung herausbrachten. Die Darsteller spielten sie kaum, sie sprachen ihre Rollen aus dem Dunkel der Bühne, Leid und Pein lasteten über der Szene, selbst die ergreifenden Auftritte der Kinder brachten kaum Licht. Erst im letzten Akt wurden die Monologe zu Dialogen und steigerte sich die Handlung zum befreienden Augenblick, da endlich Lindquist, nachdem er Elis zur Demut bekehrt hatte, das riesige schwarze Kr.-^uz, das bisher den Hintergrund überlastete, als Tor aufstieß und der Frühlingshimmel hereinjubelte. Die Stilisierung des Spieles in den ersten Akten schadete zweifellos dem Erfolg des Stückes-, das Strindberg-sche Leid wird ohne lebendiges Spiel unerträglich. Wir sind heute einmal zu der Erkenntnis gelangt, daß Menschendarstellung reajistisch sein muß, auch und gerade dort, wo Schicksal und Handlung im Zwielicht der Welten vor 6ich gehen. Will man aber — wie es vielfach geschieht — Strindberg als einen Künder des Gestern bezeichnen und die Sorgen seiner Menschen als kleinlich und überholt hinstellen, so vergißt man, daß der Ärger des Tages ein zeitloser und oft gefährlicherer Wider6pieler ethischen Handelns ist als großer Schmerz und Weltleid. Auch die Überwindung des Ichs in den kleinen Streitfällen des Tages, dieses wahrhaftig Die-andere-Backe-Hinhalten, so man den Schlag auf die eine erhalten hat, ist manches Mal vielleicht schwerer als der große heroische Verzicht in den gewaltigen Leidenschaften und Erschütterungen der Menschen.
Neben diesen Dramen der Gnade und der Demut war es noch eine Komödie Anouilbs,„Das Lügenrendezvous“, die auf künstlerischer Ebene wesentliche Probleme aufzeigte In geschickt theatralischer Form — ohne an innerer Kraft an die Tragödien des Dichters heranzukommen — erleben wir die Flucht eines modernen Menschen aus dem Hexenkessel familiärer Haßatmo6phäre in das selbstgesponnene Lügengewebe von einem ehrsamen Elternhaus und treuen Freunden. Der Held will hiedurch ein schuldloses Mädchen für sich gewinnen. Als das Gespinst reißt, hält 6ie ihm dennoch die Treue. Er glaubt sich befreit — freilich fragt sich der Zuseher, für wie lange? Aber der Komödie gesteht man auch ein problematisches Happy-End zu.
Dem Wiener Vorbild gemäß stritten 6ich auch in Graz etwas verspätet alliierte Chauffeure um die hübsche Simone. Aber wer weiß, wäre Rolands Spiel „Simone und der Friede“ ohne 6einerzeitiges Verbot so berühmt geworden, daß man es nach Wien auch in Graz gespielt hätte?
Als Uraufführung eines heimischen Autors brachten endlich die Kammerspiele Raimund Bergers .Die Helden von Albeville“, eine Komödie, die man hierorts problematisch „Zeitgenossen“ betitelte. Aber der derbsaftige Humor des Tiroler Autors kümmert sich wenig um schwierige Probleme. Die Schildbürgergeschichte der Albeviller von 1851, die bald gute Republikaner, bald ebensolche Bonapar-tisten sind und hiedurch in die ärgste Schla-mastik geraten, ist ein handfestes Lustspiel alten Stils; Situationskomik und ganz wenig Sentimentaliät erfreuen ein Publikum, das 6ich vom Lärm des Tages erholen will.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!