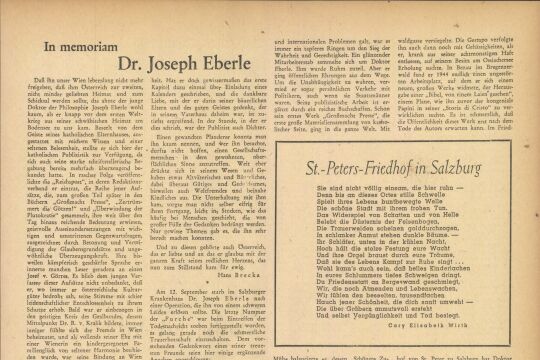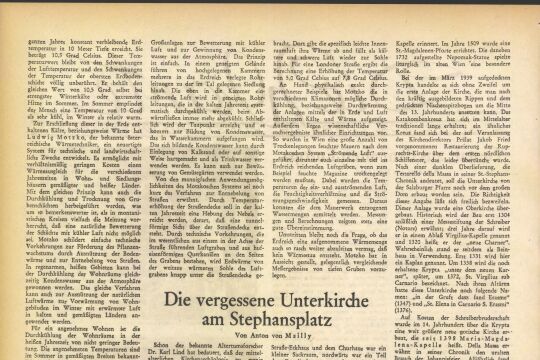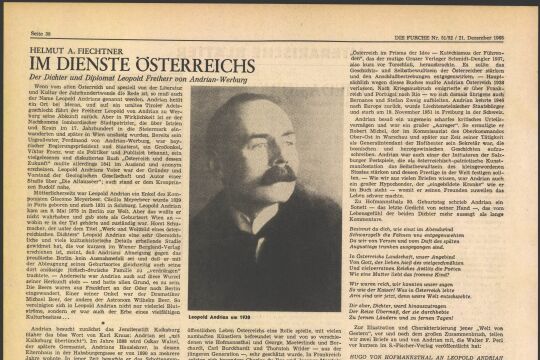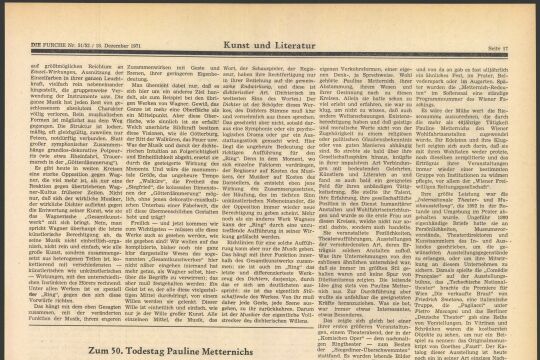Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der bittere Geschmack
„Der fesche Clemens Krauss“, sang damals Hermann Leopoldi, „der paßt fürs Opernhaus. I Die Damen rufen: Nehmen S' I doch rasch den schönen Clemens! I Die Locke hängt ihm tief, I der Künstlerhut sitzt schief, was immer er auch leistet, I er wirkt dekorativ.“
Hier irrte Leopoldi. Clemens Krauss als Staatsoperndirektor war nicht nur dekorativ, er verkörperte Glück und Verhängnis in einer Person. Glück, weil er ein Ensemble aufbaute, wie das Haus es wahrscheinlich seit Gustav Mahlers Zeiten nicht mehr besessen hatte, und weil er Richard Strauss (man konnte ja noch Vergleiche ziehen) authentischer dirigierte als der Meister selbst. Und wer dächte nicht an die Anfänge der Neu Jahrskonzerte? Auch in der technisch mangehaften Aufzeichnung grandioser musikalischer Gestaltungen, von denen uns die Gedenksendung in FS 2 einzelne Fragmente vermittelte, ließ sich der unerhörte Schwung, ließ sich die Suggestivkraft des großen Dirigenten Clemens Krauss wiederzuerkennen. Soviel zum Glück der dreißiger Jahre.
Das Verhängnis bestand darin, daß Clemens Krauss sich, im Vollgefühl seiner verkehrten Überzeugungen, einem der laufend verübten Bosheitsakte des nationalsozialistischen Deutschland zur Verfügung stellte, Wien ohne Vorwarnung verließ und mit den vier Sängern, auf denen sein Ensemble aufgebaut war, seiner Gattin Ur-suleac, der Altistin Rünger, dem Tenor Völker und dem Bassisten Manowarda nach München ging. In der Berliner Reichskanzlei und auf dem Obersalzberg rieb man sich die Hände. Man glaubte, das hartnäckig widerstehende Österreich in der Seele, in seinem Musikleben getroffen zu haben.
Aber man irrte sich gewaltig. Ein Nationalheiligtum wie die Wiener Oper kann niedergebrannt, kann von Hunnen verwüstet werden, aber es schließt niemals die Pforten. Die hervorragendsten Sänger und Dirigenten aus aller Welt machten es sich zur Ehre, im Ständestaat Österreich (was heute abgeleugnet wird) zu arbeiten. Zur Weltwirtschaftskrise kamen damals in Österreich auch noch die Folgen der kalten Kriegsführung eines übermächtigen, bis an die Zähne bewaffneten Nachbarn, aber die Kulturwelt pilgerte nach Salzburg, das seinesgleichen noch nicht hatte, und in der Wiener Oper kamen Vorstellungen zustande, wie in jenen sagenhaften Tagen, in denen der Kaiser das Defizit aus seinem Privatvermögen zu bezahlen hatte. Im Stehparterre sorgte ein junger, sehr schlanker Marcel Prawy für Begeisterung in den richtigen Augenblicken. Noch einmal, vor dem vorübergehenden Erlöschen, zeigte Österreich, was es war, was es sein könnte.
Um das Verhängnis, das für kurze Zeit zum Glück ausschlug, redete die Gedenksendung herum, redete, um nichts saaen zu müssen. Dem Wissenden, sich Erinnernden, der zusah und zuhörte, blieb, wie der Prinzessin Salome, ein bitterer Geschmack auf den Lippen. Bitternis und Dankbarkeit mischten sich untrennbar im Gedenken an einen großen Künstler, und dazu die Erkenntnis, daß er, wie kaum ein zweiter, jenen hochbegabten österreichischen Typus verkörperte, der sich neben der Welt eine Scheinwelt aufbaut, der auch über Trümmer hinwegschreitet, wenn es darum geht, sein Träume als Kunstwerk in ein imaginäres All zu projizieren. Dieser Typus kehrt, gottlob, leider, immer wieder.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!