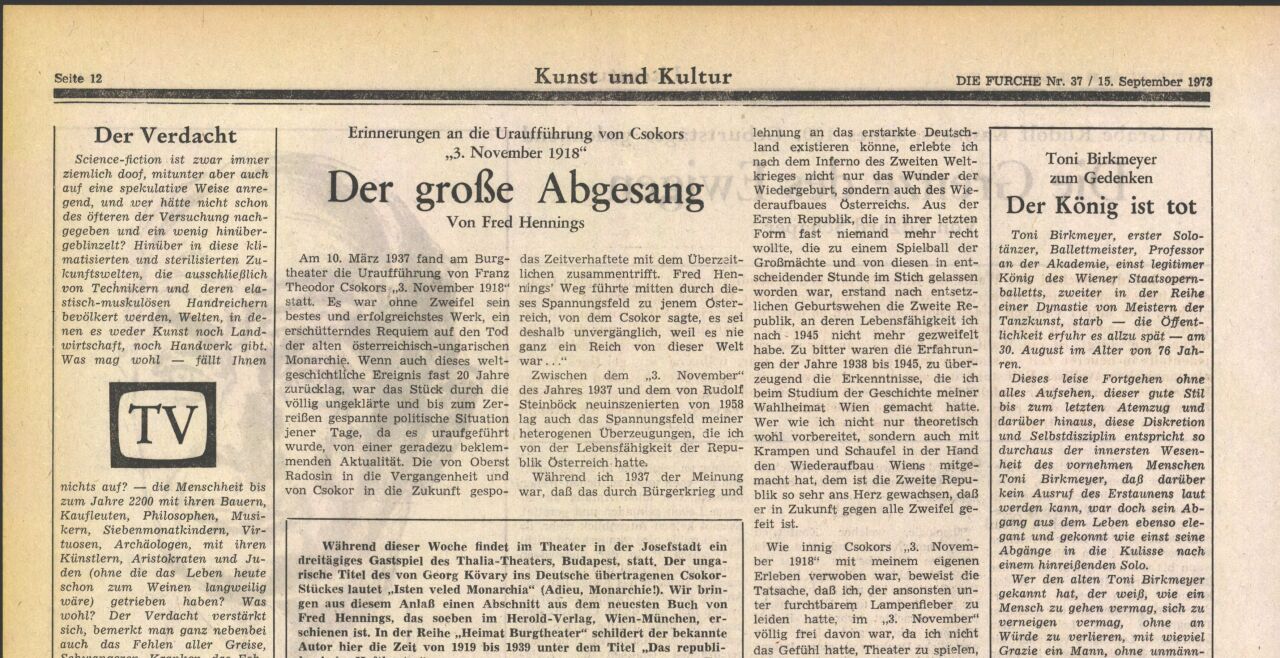
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der große Abgesang
Am 10. März 1937 fand am Burgtheater die Uraufführung von Franz Theodor Csokors „3. November 1918'' statt. Es war ohne Zweifel sein bestes und erfolgreichstes Werk, ein erschütterndes Requiem auf den Tod der alten österreichisch-ungarischen Monarchie. Wenn auch dieses weltgeschichtliche Ereignis fast 20 Jahre zurücklag, war das Stück durch die völlig ungeklärte und bis zum Zerreißen gespannte politische Situation jener Tage, da es uraufgeführt wurde, von einer geradezu beklemmenden Aktualität. Die von Oberst Radosin in die Vergangenheit und von Csokor in die Zukunft gespochene Warnung, „Wenn dieses Österreich einmal aufhört zu sein — dann kommt in die Welt niemals Friede“, wurde verstanden und demonstrativ akklamiert.
Für mich persönlich war der „3. November 1918“ ein Stück eigenen Erlebens. Das „Ich habe die Ehre“ des Obersten Radison gemahnte mich an meine Begegnung mit Feldmarschall Boroevic in Vel-den, die Figur des Oberleutnants Ludoltz an mich selbst und meine Tätigkeit zu Ende des Ersten Weltkrieges.
In der von Herbert Waniek inszenierten und von Stefan Hlawa ausgestatteten Uraufführung spielte ich den jungen Kärntner Ludoltz, mit dem Csokor bereits den Typ eines Nationalsozialisten vorweggenommen hat. Zwischen dem Glauben an eine Rettung bringende eigenstaatliche Neuordnung in enger Anlehnung an das mächtig aufblühende Deutsche Reich und der Erinnerung an die k. u. k. Monarchie fühlte ich mich während der Proben zum „3. November 1918“ ständig hin-und hergerissen.
Jeder von uns, der noch des Kaisers Rock getragen hatte, war während der Probenarbeit dem „Zauber der Montur“ erlegen. Nicht nur, wie sonst üblich, während der Kostümproben, sondern von allem Anfang an trugen wir mit Begeisterung die altösterreichischen Uniformen, die in uns allen Jugenderinnerungen wachriefen. Daß diese vorzüglich Kriegserinnerungen waren, vermochte unsere Freude am hechtgrauen Ehrenkleid nicht zu schmälern. Denn bekanntlich vergißt der Mensch nur allzu schnell die Schrecken eines Krieges, während er die freundlichen Erinnerungen daran, vor allem die an das nachhaltige und starke Erlebnis der Frontkameradschaft, sorgsam hegt und pflegt.
Csokors „3. November“ gehört neben Molnärs „Schwan“ zu jenen Stücken, die ich in drei verschiedenen Inszenierungen gespielt habe und in denen ich von einer Generation in die andere aufsteigen durfte. Beide Male löste ich den jeweiligen Doyen unseres Hauses ab. Von Georg Reimers, den ich im „Schwan“ lange Zeit hindurch als Thronfolger begleitet hatte, übernahm ich den Pater Hyazint, von Otto Tressler, dem ich als Ludoltz soviel Bitteres zu sagen hatte, den Oberst Radosin. Dieses organische Hineinwachsen in ein Stück war nur in der Kontiniutät eines festgefügten Ensembles möglich. In der heimatlichen Geborgenheit des Burgtheaters durchlief man auf diese Weise künstlerisch und menschlich ein gutes Stück seines Lebens, und nicht mit Unrecht schrieb anläßlich meines 40jährigen Burgtheaterjubiläums jemand: „Ludoltz und Radosin — diese beiden Gestalten stehen an den Grenzpunkten eines Spannungsfeldes, in dem das Zeitverhaftete mit dem Überzeitlichen zusammentrifft. Fred Hennings' Weg führte mitten durch dieses Spannungsfeld zu jenem Österreich, von dem Csokor sagte, es sei deshalb unvergänglich, weil es nie ganz ein Reich von dieser Welt war...“
Zwischen dem „3. November“ des Jahres 1937 und dem von Rudolf Steinbock neuinszenierten von 1958 lag auch das Spannungsfeld meiner heterogenen Überzeugungen, die ich von der Lebensfähigkeit der Republik Österreich hatteä
Während ich 1937 der Meinung war, daß das durch Bürgerkrieg und rerror völlig zerrüttete Überbleibsel aus der Konkursmasse der alten Monarchie auf sich allein gestellt nicht lebensfähig sei und nur in Anlehnung an das erstarkte Deutschland existieren könne, erlebte ich nach dem Inferno des Zweiten Weltkrieges nicht nur das Wunder der Wiedergeburt, sondern auch des Wiederaufbaues Österreichs. Aus der Ersten Republik, die in ihrer letzten Form fast niemand mehr recht wollte, die zu einem Spielball der Großmächte und von diesen in entscheidender Stunde im Stich gelassen worden war, erstand nach entsetzlichen Geburtswehen die Zweite Republik, an deren Lebensfähigkeit ich nach 1945 nicht mehr gezweifelt habe. Zu bitter waren die Erfahrungen der Jahre 1938 bis 1945, zu überzeugend die Erkenntnisse, die ich beim Studium der Geschichte meiner Wahlheimat Wien gemacht hatte. Wer wie ich nicht nur theoretisch wohl vorbereitet, sondern auch mit Krampen und Schaufel in der Hand den Wiederaufbau Wiens mitgemacht hat, dem ist die Zweite Republik so sehr ans Herz gewachsen, daß er in Zukunft gegen alle Zweifel gefeit ist.
Wie innig Csokors „3. November 1918“ mit meinem eigenen Erleben verwoben war, beweist die Tatsache, daß ich, der ansonsten unter furchtbarem Lampenfieber zu leiden hatte, im „3. November“ völlig frei davon war, da ich nicht das Gefühl hatte, Theater zu spielen, sondern ganz einfach aus meinem Leben zu erzählen. So sehr hatte ich mich in beide Rollen dieses Werkes im vollsten Sinne des Wortes hineingelebt. Es war dies der einzige Fall dieser Art, der mir in meiner Bühnenlaufbahn widerfahren ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































