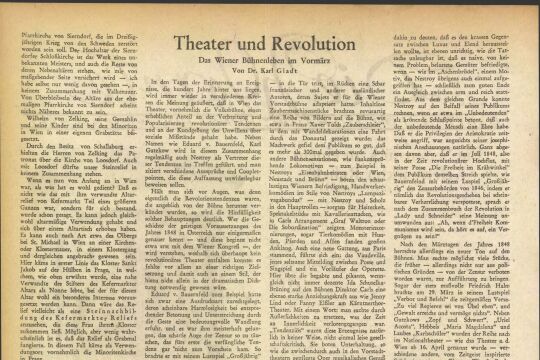Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Rache der Kunst
Wenn der Start einer Theatersaison als Omen gewertet werden könnte, stünde es um die nun in Wien beginnende schlecht. Nur „Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie“ von Max Frisch im Volkstheater hinterließ keinen bitteren Nachgeschmack. „Wassa Schelesnowa“ von Gorki im Volkstheater und „Leutnant Gustl“ nach Schnitzler in der Josefstadt: Zweimal Opportunismus, einmal links und einmal rechts.
Wenn der Start einer Theatersaison als Omen gewertet werden könnte, stünde es um die nun in Wien beginnende schlecht. Nur „Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie“ von Max Frisch im Volkstheater hinterließ keinen bitteren Nachgeschmack. „Wassa Schelesnowa“ von Gorki im Volkstheater und „Leutnant Gustl“ nach Schnitzler in der Josefstadt: Zweimal Opportunismus, einmal links und einmal rechts.
Im Vorjahr mußte sich Traugott Krischke beuteln lassen, weil er aus nachgelassenen Horväth-Notizen eine „Wiesenbraut“ - „von ödön von Hor-vath“ - montiert hatte. Ernst Lothar war vorsichtiger und bezeichnete seinen „Leutnant Gustl“ als „Komödie in zehn Bildern unter Verwendung von Motiven der gleichnamigen Novelle von Arthur Schnitzler“, mit dem sie aber so wenig zu tun hat, daß daneben die „Wiesenbraut“ geradezu als Origi-nal-Horväth erscheint.
Im Gegensatz zu Lothars „Fräu-lein-Else“-Bearbeitung wurde
Schnitzler diesmal nicht dramatisiert, sondern trivialisiert. Daß sich die Novelle, in der, erstmals in der deutschen Literatur, der innere Monolog zum tragenden Stilprinzip eines Werkes wird, gegen die Bühnenbearbeitung sperrt, ist dabei noch der kleinere Einwand. Aber die von Lothar dazuerfundene Anna, die ihren Gustl durch eine handfeste Verleumdung zu retten sucht, macht aus Schnitzlers scharfer Kritik am k. u. k. Milieu (die ihn seinen militärischen Rang kostete) eine tränendrüsige Illustriertengeschichte, und Schnitzlers bitterer Succus, Gustls Unbelehrbarkeit, wird zum Schlußgag der Regie reduziert.
Unter Walter Davy wird auf hohem schauspielerischem Niveau genäselt. Eindrucksvolle Leistungen (Kitty Speiser, Alexander Waechter), aber wirklichen Gewinn von dieser Speku-
lation auf die Liebe zur guaten alten Zeit hat nur der Kostümverleiher Lambert Hofer, der einen ganzen Regimentsstab adjustieren durfte.
Gorkis „Wassa Schelesnowa“ ist in der Urfassung aus dem Jahre 1910 nicht nur ein revolutionäres, sondern auch ein gutes Stück. Das Volkstheater spielt Gorkis Neufassung aus dem Jahre 1935, und die ist weder das eine noch das andere, hat aber eine großartige Titelrolle zu bieten, und wegen der Leistung von Hortense Raky ist die Aufführung absolut sehenswert. Während die Kapitalistin und Matriarchin ursprünglich an der Verkommenheit ihrer Klasse und ihrer in einer unmenschlichen Umwelt zur Brutalität pervertierten Mütterlichkeit zerbricht, hat Gorki 1935 ihren Charakter noch etwas mehr eingeschwärzt und ihr dafür die Revolutionärin Rachel als positive Kontrastfigur gegenübergestellt. Und die redet Papier, Papier, Papier -bis zur Peinlichkeit und weit darüber hinaus. Renate Olarova steht da auf verlorenem Posten.
Es wurde an diesem Stück viel herumgerätselt und immer wieder versucht, Gorkis Kritik am Stalinismus herauszulesen. Der einzige Satz, der in diesem Sinn verstanden werden kann, ist Wassas Prophezeiung: So, wie ihr sie euch vorstellt, eure Revolution, wird sie nicht sein. Es gibt sogar die Ansicht, Gorki habe mit voller Absicht die Wassa stark gezeichnet und alles andere als herzlos und die Revolutionärin schwach, kaum überzeugend und voller Widersprüche: Erst kommt sie, um ihr Kind abzuholen, das aber von Wassa Schelesnowa nicht herausgegeben wird - dann bietet ihr Chra-pow an, es zu entführen, aber plötzlich ist sie gar nicht mehr so erpicht auf den Knaben, weil sie ja als Revolutionärin im Untergrund leben muß und „die Sache“ wichtiger ist.
Ob Stalin mit der Neufassung zufrieden war, wird man nie erfahren: Wenige Monate nach der Fertigstellung war Gorki tot. Als Stalin weniger als zwei Jahre später seinen Geheimpolizeichef Jagoda erschießen ließ, wurde diesem auch der Mord an Gorki angelastet - wovon aber später niemand mehr etwas wissen wollte. Umstände, die die Bedingungen beleuchten, unter denen Künstler in Moskau damals überlebten.
Gorki#var seit vier Jahren wieder in der Sowjetunion und der stalinistische Terror kulminierte, als er das Stück
umschrieb. Er war Vorsitzender des Schriftstellerverbandes, galt als kulturpolitische Autorität, hatte auch die Arbeitslager öffentlich verteidigt, und niemand weiß, was er freiwillig tat und was nicht. Genauso geht es uns,mit der
„Wassa-Schelesnowa “-Neufassung. Was Pflichtübung war und was verzweifelter Versuch, sich einen Rest von Glauben an die Revolution und an die Menschen (vor allem jene, welche jetzt die Revolution verkörperten) zu erhalten, ist nicht zu unterscheiden.
Einst hatte Gorki die Meinungsfreiheit als höchstes Gut verteidigt, jetzt war er, gezwungen oder nicht, ein Verteidiger des Terrors. Daß ihm die Rachel und damit die ganze Neufassung unglaubwürdig und unwahr geriet, hat innere Logik. Es gibt in der Weltliteratur kein gutes und zugleich verlogenes Stück. Auch Gorki brachte es nicht zustande. Die Revolutionärin als Gegenpol alles in Wassa verkörperten Schlechten - daran ließ sich so undifferenziert im Moskau der Schauprozesse nicht mehr glauben, und Differenzierung war tödlich. Der Versuch, Opportunismus in Kunst umzusetzen, demaskiert sich aber selbst - das ist die Rache der Kunst.
Karl Paryla inszenierte altmodisch und behäbig, alles andere als analytisch, offenbar vertraut er dem Text. Wassa | Schelesnowa wird am Ende vom Teufel geholt, pardon, natürlich vom Weltgeist, und die Hölle, in die die Kapitalistin kommt, ist sicher Trotzkis Misthaufen der Weltgeschichte. Auch in solcher Sicht eines solchen Stückes steckt eine gehörige Portion Opportunismus.
Bleibt als Positivum des Saisonauftaktes das Don-Juan-Stück von Max Frisch. Unglaublich, wenn es wahr ist, daß das bisher kein Wiener Theater gespielt hat. Eigentlich liegt gar nicht so viel Staub auf diesem Text, in dem Frisch versucht, den Weiberhelden als verhinderten Weiberfeind zu interpretieren, dessen Flucht vor der Ehe in ebenderen behaglichem Hafen endet. Ein Stück,,das zu lachen gibt - und noch immer zu denken. Ernst Cohen gibt dem Don Juan Saloppheit und Intelligenz. Peter Gruber inszenierte mit Schwung und nützte klug die (bekanntlich nicht unbegrenzten) Möglichkeiten des übrigen Ensembles. Nur die Eheszene am Schluß hat mir zuviel Tristesse und zuwenig Ambivalenz.
Auch über einige andere Einzelheiten der Inszenierung kann man verschiedener Meinung sein. Manches geriet etwas hölzern, manches sieht nach zur Tugend gemachter Not aus (vor allem die Fechtszenen), doch der Gesamteindruck ist positiv. Viele gute Leistungen wären zu nennen (Helmi Mareich als Donna Elvira!), den bisher wenig hervorgetretenen Regisseur muß man sich merken.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!