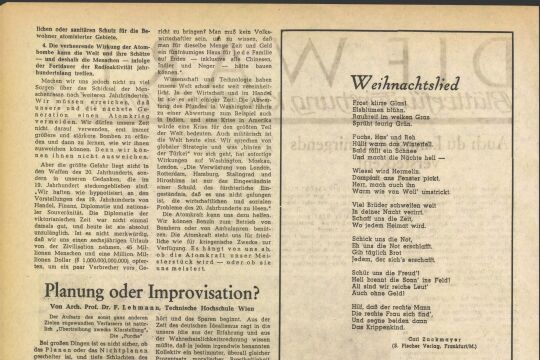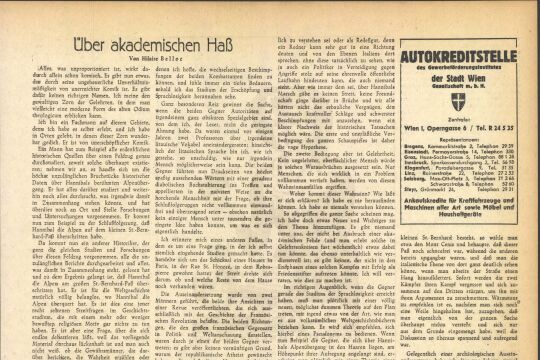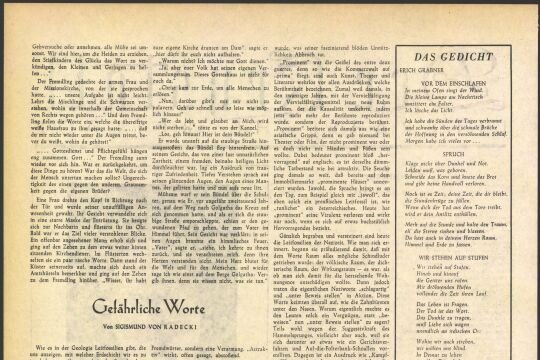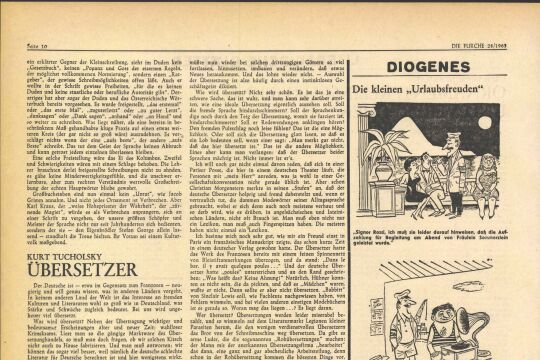Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Grablegung des Dichters?
Es hat in den letzten Jahrzehnten nicht an Stimmen gefehlt, die dafür plädierten, das Wort „Dichter“ abzuschaffen. Immer wieder hieß es da, dieses Wort sei zu feierlich, verstiegen, typisch deutsch.
Aber so leicht ist es offenbar nicht auszumerzen. Daß es jedenfalls noch munter am Leben ist, kann man aus den neuerlichen Bemühungen ersehen, die es jetzt endgültig zur Strecke bringen möchten. Junge progressive Germanisten, einige Kritiker und Liberaturproduzenten blasen Halali.
Wir werden uns hüten zu definieren, was ein Dichter ist. Auch die Geschichte des Wortes „Dichter“ wollen wir beiseite lassen.
Aber fragen müssen wir uns, warum man partout nicht aufhört, vom „Dichter“ zu sprechen. Warum schert es so wenige, daß sie sich den Ruf von Hinterwäldlern und Reaktionären zuziehen durch ungenierten Gebrauch dieser Vokabel? Ist es Gedankenlosigkeit? Atavismus? Eine Trotzreaktion? Vielleicht, all das ist mit im Spiel. Doch darüber hinaus scheint sich hier etwas zu manifestieren, das man nicht schlankweg beschuldigen und verurteilen kann.
Wenn man heute vom Tod des Dichters spricht und ihn zu Grabe tragen will, so hat man seine Gründe. Man kann ihn offenbar nicht mehr brauchen. Er steht so aufreizend faul herum, während alle ihren politisch-moralischen Leistungsnachweis erbringen, steht nur im Weg. Mit seinem Namen sind Vorstellungen und Ansprüche verknüpft, die sich mit den gegenwärtigen Auffassungen von einer „relevanten“ und zum Konsum, d. h. zum alsbaldigen Verschleiß ausersehenen Literatur nicht koordinieren lassen, ja sie in Frage stellen. Also weg mit ihm! So versucht man, einen Scheintoten unter die Erde zu bringen.
Der Dichter, der das Wort verdient, ist immer eine Randerscheinung gewesen: Lehen- und Almosen-empfänger, oft zwielichtig, unzurechnungsfähig. Die paar „Dichterfürsten“, die es auch gegeben hat, fallen nicht ins Gewicht. Noch aus den bürgerlich beschönigenden Epitheta, wie „kauzig“, „exzentrisch“' oder „weltentrückt“, geht hervor, daß man im Dichter nie einen gesellschaftlich Angepaßten gesehen hat, aber immer einen Eigenbrötler und Einzelgänger. Jedenfalls war es ein Mißverständnis zu glauben, daß man mit dem Wort „Dichter“ einen Begriff von höherer literarischer Qualität offerieren könne.
Dichter sind keine besseren Schriftsteller. Das Geschrei „Hie Dichter — hie Schriftsteller“ ist Gott sei Dank historisch. Soviel aber ist nun endgültig klar geworden, daß es sich bei den beiden Bezeichnungen nicht um kongruente Synonyme handelt.
Warum also — noch einmal — hält die Mehrzahl an dem Wort fest und wird auch die neuerlich beschlossene Grablegung des Dichters nicht tragisch nehmen? Weil dieses Wort einen Bewußtseinsinhalt spiegelt, der etwas Seltenes, Unbedingtes, Sich-Treubleibendes umfaßt. Denn wenn ich vom nichtkonformistischen Element in der Literatur sprechen, von jenen aufreizend auf sich selbst bauenden, über Moden und Maschen unverfroren erhabenen Alleingängern sprechen soll, kann ich mit dem Wort „Schriftsteller“ nicht arbeiten, auch dann nicht, wenn ich damit etwa kritisch opponierende Autoren meine. Denn dieser ans Wort gebundene Widerstand einiger weniger, der nicht ideologisch verpfähl't ist, nicht auf schärferem gesellschaftlichem Bewußtsein beruht, sondern aus einer Abweichung stammt, einer Abweichung vom Üblichen, Eingefleischten, Zeitbedingten, einer grundsätzlich anderen Art des „Sehens“, läßt sich nicht hinreichender kennzeichnen als eben mit „dichterisch“.
Da haben wir es. Ein Abweichler. Einer, der gern „anders“ sein möchte. Der sich wohl gar für auserwählt hält. So philiströs kann man es natürlich auch nehmen. Über den Nutzen von Dichtern läßt sich streiten — über ihr Vorkommen nicht. Und wenn die neue Kontroverse weiter nichts ergeben sollte als den Hinweis, daß Dichter nach wie vor ein Stein des Anstoßes sind, etwas, an dem sich die Geister scheiden, schon seit Piaton: mehr ist eigentlich gar nicht nötig. Somit wird das verpönte Wort „Dichter“ weithin sichtbar wieder virulent, zeigt, daß es nicht totzukriegen ist. Je schärfer die Verneinung, desto präziser wird es.
Keine Auszeichnung mehr für „zeitlose“ literarische Leistungen, nein, einfach ein Wort für den extrem individuellen und doch merkwürdig paradigmatischen Umgang einzelner mit der Sprache. Ein Begriff mit Schwächen und Stärken. Und — hoffentlich — nie ganz geheuer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!