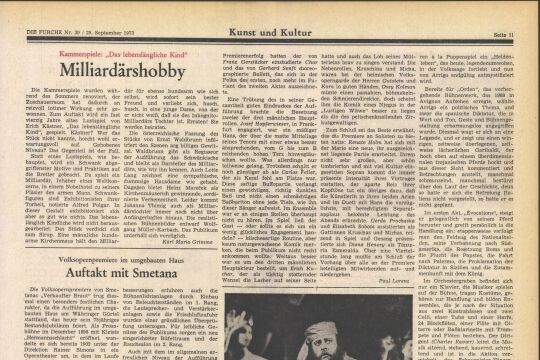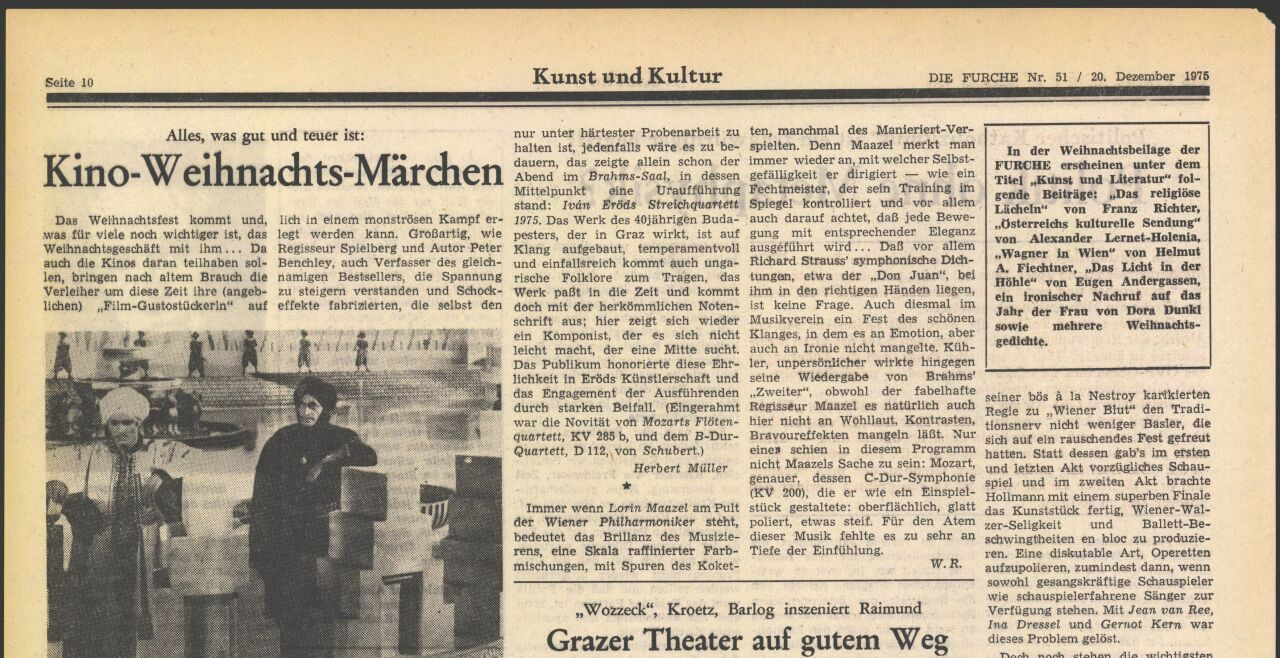
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Grazer Theater auf gutem Weg
Alban Bergs „Wozzeck“ ist auf der Bühne ein halbes Jahrhundert alt geworden. Die Grazer Oper nahm dieses Jubiläum zum Anlaß, das Werk nach fast zwanzig Jahren wieder ihrem Publikum zu zeigen. Das Resultat ist beachtlich und erfreulich: die Premiere schlug ein wie eine glanzvolle Verdi- oder Puccini-Auf-führung. Harry Kupfer, der Dresdner Intendant, betonte — gemeinsam mit seinem Bühnenbildner Wilfried Werz — den expressionistischen, fiebrigen, ja keuchenden Charakter dieser Szenenfolge. In einer ruinenhaften Welt agieren groteske, drohende Lemuren, Gespenstisches zieht sich als Leitmotiv durch alle Bilder. Der Abend hat keine Pause. Dadurch wird zumindest eine äußerliche Geschlossenheit der Aufführung erzwungen, obwohl die Geschlossenheit des allgemein verbindlichen Falles Wozzeck durch die so außerordentlich artistisch inszenierten Einzelelemente weniger deutlich wurde. Der Höhepunkt der Regieleistung ist die Wirtshausszene, die, bis ins kleinste Detail vom Regisseur durchkomponiert, in ihrem Nachtlokalcharakter und den maskenhaften Korpsstudenten eine stilisierte Orgie der Spießbürgerlichkeit ergibt; es ist nur folgerichtig, daß der Narr in diesem Treiben einen Totenschädel unter seiner Schellenkappe trägt. Gustav Czerny, einer der verläßlichsten und kenntnisreichsten Dirigenten für diese Musik, sorgte bei aller Lautstärke für Präzision; die Titelgestalt gab Gottfried Hornik sehr verinner-licht und musikalisch hervorragend, während Gertraud Eckert stimmlich überfordert war, darstellerisch jedoch die Plagen einer wilden Sinnlichkeit glaubhaft machte.
Mit „Oberösterreieh“ hat Franz Xaver Kroetz begonnen, sich von den Extremen abzuwenden und dem „guten Durchschnitt“ unserer Gesellschaft zuzuwenden. Die „traute Zwei-samkeit“ des absoluten Durch-schnittspaares ist typisch für eine breite Schicht von Menschen: ein Leben, das sich höhepunktlos zwischen Essen, Fernsehen, Schlafen und beidseitiger Berufstätigkeit hinzieht und in dem sorgfältig auf ökonomische Ausgeglichenheit und säuberliche Abschließung von der Außenwelt geachtet wird: Heinz und Anni leben geradezu im luftleeren Raum einer neuen Kleinbürgerlichkeit, für die ein Kind einen Angriff gegen den mit ängstlichem Egoismus gehüteten Ist-Stand bedeuten würde. Daß es dann trotzdem kommt, weil Anni ein freudiges mütterliches Ja dazu sagt und allen Abtreibungswünschen ihres Heinz mutig widersteht, sieht ja sehr hübsch nach heiler Welt aus (die dem engagierten Kommunisten Kroetz in seiner „positiven“ Phase zuzutrauen wäre); Aber die vielen Wandbehangsprüche und Phrasen, mit der in dieser Ehe die Suche nach Persönlichkeit beantwortet wird, tragen insgesamt doch zum Bild pessimistischer Resignation bei: das Ja zum Kind schmeckt allzusehr nach billigem Konformismus. Ingeburg Amodi und Toni Böhm spielten diese Folge kurzer Szenen sehr verhalten in der Kargheit des erfrorenen Gefühls.
Mit Boleslaw Barlog hat das Schauspiel einen prominenten Regisseur für Raimunds „Verschwender“ engagiert. Seine Interpretation geht aus auf Schlichtheit und Sauberkeit. Die Darsteller (besonders Gerhard Balluch als Flottwell und Fritz Holzer als Valentin) werden liebevoll und mit erfahrener Hand geführt. Alles hat Kultur und Stil. Dennoch will einem scheinen, daß in der ganzen Aufführung trotz der wunderschönen modernisierten Biedermeierei der Dekorationen (Frieder Klein) etwas zu kurz kam, was bei Raimund eben nicht fehlen darf: das Gemüt. Die naive Kunst des Volkstheaters läßt sich durch Exaktheit und Solidität alleine eben doch nicht beschwören.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!