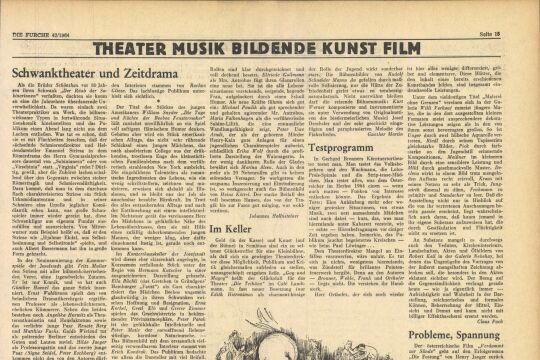Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zwiespältig
Befanden sich die Grazer Sommerspiele der letzten Jahre in einer zeitweise gefährlichen Krise, so lagen die des Jahres 1965 sozusagen in Agonie. Der letale Ausgang scheint unvermeidlich — wenn nicht ein Wunder geschieht. Das Wunder könnte darin bestehen, daß sich eine völlig neue Form unter Ausnützung sämtlicher musischer Ge-gegebenheiten der Stadt finden ließe — denn auf eine wirklich tragfähige Idee ist nach so langem Suchen kaum mehr zu hoffen.
Die Veranstalter der Sommerspiele hatten schließlich doch noch ein Motto für ihr Programm gefunden. Es hieß „Österreich“, was in diesem Gedenkjahr nun auch wieder nicht allzu originell ist. Zu diesem Motto paßten die meisten Sprechstücke des laufenden Repertoires im Schauspielhaus. Wie schon im Vorjahr, versah man also auch heuer wieder Repertoirestücke flugs mit der Etikette „Sommerspiele“ und hielt das Fest solcherart für gerettet. Zu den schon ziemlich abgespielten Inszenierungen (von Nestroys „Unbedeutendem“ über Grillparzers „Medea“ bis zu Anzen-grubers „Viertem Gebot“) kam ein Gastspiel des Wiener Volkstheaters mit Nestroys „Liebespeschichten und Heiratssachen“ — das recht enttäuschend verlief — und eine neue Grazer Produktion, nämlich Hofmannthals „Schuueric/er“. Kaum zu glauben, daß diese herrliche Komödie erst jetzt ihre Grazer Erstaufführung erlebte! Die an sich großen Bemühungen des Ensembles ließen keinen Zweifel darüber, wie schwer es ist, Atmosphäre und Stil gerade dieses Werkes auf einer Bühne außerhalb Wiens halbwegs authentisch zu treffen. Vieles stimmte da nicht, war zu grob, zu schwerfällig, zu wenig nuanciert oder bewegte sich — wie im zweiten Akt — im Fahrwasser der Operette. Immerhin bedeutete Hanns Kraßnitzer eine akzeptable Möglichkeit für die Titelrolle; sein Kari war mit Abstand das Beste in dieser, von einem jungen, auf diesem Gebiet viel zuwenig erfahrenen Regisseur (Klaus Gmeiner) geleiteten Aufführung.
Vorschußlorbeeren wurden noch vor der Aufführung freigebig dem Drama „Die Glembays“ zuteil. Bei diesem Werk des kroatischen Dichters Miroslav Krleza handelt es sich um ein abgeschlossenes Teilstück eines Zyklus, der die Geschichte einer fingierten Familie aus Kroatien zum Thema hat. Zwei andere Dramen aus diesem Zyklus sollen in der nächsten Saison in Wien gegeben werden. In den „Glembays“, die in Graz ihre deutschsprachige Erstaufführung — 37 Jahre nach ihrem Entstehen — erlebten, schildert der jetzt 72jährige Autor an Hand von Modellgestalten aus dem Großbürgertum der Monarchie den Zusammenbruch einer Agramer Bankiersfamilie knapp vor Ausbruch des ersten Weltkrieges. Auf kürzeste Zeit drängt Krleza hier seine Abrechnung mit den angeblich so ehrenwerten Bürgern zusammen. Bei aller Spannung und Dynamik — die mehr im Dialog als im Geschehen liegt — geht es in diesem Werk eines Epigonen jedoch nicht ohne Krampf ab, nicht ohne billige Kolportage. Ibsen und Sudermann sind die Vorbilder — aber das Ganze steht einem doch wieder nahe, weil es aus dem Land unserer Väter kommt, aus dem „großen halbslawischen Österreich“, weil die Figuren dieses kroatischen Ibsen sozusagen unsere Sprache sprechen. Die Aufführung unter Rolf Hasselbrink war recht gut, eine vorzügliche Leistung bot Robert Casa-piccola in der männlichen Hauptrolle.
Der Beitrag der Oper bestand in zwei Reprisen (erwähnenswert ist nur die schon bekannte zauberhafte „Ariadne“), einem sehr beifällig aufgenommenen Gastspiel der Wiener Volksoper mit Haydns Marionettenoper „Das brennende Haus“ und der Grazer Erstaufführung von Alban Bergs „Lulu“. Mit der Inszenierung dieser so überaus schwierigen Oper hat Andre Diehl sich nach zehnjähriger Intendantentätigkeit vom Grazer Publikum verabschiedet. Es war ein glanzvoller Abend, ein unbestreitbarer Erfolg für das Werk und seine Interpreten. Diehls Regie ist packend, aber nicht aufdringlich, Skalickis Dekorationen bauen sich auf dem Orgelpunkt der Zirkusmanege auf, und Gustav Czernys musikalische Führung ist ordnend, kraftvoll und auf Dramatik bedacht. Das Grazer Ensemble hat eine Bewährungsprobe ohnegleichen bestanden, wenngleich die besondere Attraktion der Aufführung von der Trägerin der Titelrolle herkam: Joan Carroll Ist eine großartige, routinierte Lulu, ein fast marionet-tenhaftes, zuweilen beinahe kindhaftes Wesen, stimmlich wie darstellerisch gleichermaßen hervorragend.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!