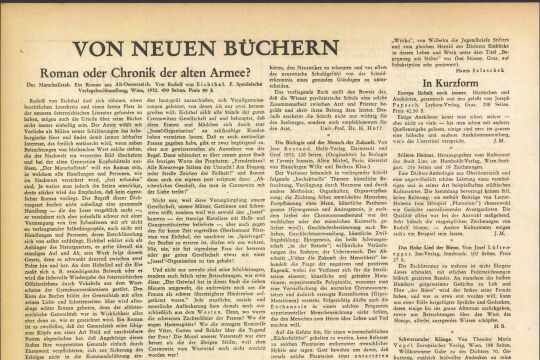Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Osterreich-Ungarn als Psycho-Thriller
Es beginnt spannend und erweckt Neugier. Der Klappentext verheißt: „Noch einmal leuchtet in diesem Buch der ganze hinfällige Glanz der Donaumonarchie mit ihrer sorglos der Liebe und dem Genuß lebenden Gesellschaft auf… Doch schon kündigt sich in der rätselhaften Tat eines Einzelgängers die große Katastrophe an, die all das hinwegfegen wird. Gemeint ist die Giftmordaffäre Hofrichter, eines aktiven Oberleutnants aus Linz, der in der zweiten Novemberhälfte 1909 zehn mit Zyankali gefüllte Oblatenkapselri, diskret als Aphrodisiakum empfohlen, an zehn ledige junge Hauptleute des Generalstabs verschickt hatte. Einer der Empfänger starb sofort nach Einnahme der Kapsel. Die anderen entgingen durch Zufall dem gleichen Schicksal.
Warum nicht, denkt man: da wird ein ebenso sensationeller wie obskurer Kriminalfall erzählt, um zugleich die Brüchigkeit des Systems und der Gesellschaft von Anno dazumal dazulegen. So vermischt sich beim Leser das Vergnügen über den Spannungseffekt mit der Selbstzufriedenheit über die vollzogene Einsicht in die Notwendigkeit gesellschaftskritischer Entlarvung. Ein wenig stutzig werden läßt einen zunächst das Urteil der „New York Times“, die das Buch einen „psychologischen Thriller der Spitzenklasse“ nennt, weil es „so raffiniert gebaut, so flüssig und lesbar“ sei, daß man es nicht wieder aus der Hand legen könne. Aber der seriöse Verlag macht das dadurch wieder wett, daß er dem Leseexemplar 14 Seiten photokopiertes Dokumentationsmaterial beigibt, darunter nicht weniger als 13 Seiten „Neue Freie Presse“ aus der Zeit zwischen 20. November und 29. Mai 1909/10. So lange dauerte nämlich das Sammeln von Indizien, das „Katz-und-Maus-Spiel" zwischen dem Hauptmannauditor Kunz (in Roman Emil Kunze) und dem Angeklagten Adolf Hofrichter (im Roman Peter Dorfrichter), ehe der Verdächtige, physisch und seelisch zusammengebrochen, ein Geständnis ablegte, nachdem sich seine Frau von ihm losgesagt hatte (im Roman betrügt sie ihn).
Der Anfang des Buches gibt sich seriös und beginnt mit einer Widmung der Autorin: „Dem Andenken meines Vaters, Oberleutnant Géza Fagyas, bei der österreich-ungarischen Armee. Gefallen am 9. Oktober 1914.“ Dann folgt eine authentische „Avancementliste“ mit 15 Namen von Oberleutnants, die, außer
tourlich zu Hauptleuten beziehungsweise Rittmeistern ernannt, in den Generalstab übernommen wurden. Von da an entfaltet sich auf 364 Seiten die Romanphantasie der Autorin, wobei Gassen, Plätze, Häuser Wiens und eine Unmenge kulturhistorischer Details minuziös geschildert werden. Der Leser soll so den Eindruck gewinnen, als stimmte alles: nicht nur der äußere Rahmen und die realen Vorgänge, sondern auch die psychologischen Einzelheiten, die inneren Beweggründe. Bald jedoch merkt man, wie alles flach an der Oberfläche bleibt, die Figuren keine Dimension annehmen, wie es der Erzählerin vor allem um die effektvolle Darbietung eines spannungsgeladenen Kriminalfalles zu tun ist, ausgiebig garniert mit erotischen Szenen. Am meisten vermißt man die Tiefendimension bei den beiden Hauptfiguren: dem Leutnant (wieso eigentlich Leutnant, wenn es ein Oberleutnant ist?) und dem Rich
ter. Der junge Hofrichter galt als ein überaus intelligenter und fähiger Offizier, beliebt bei seinen Kameraden und Untergebenen, allerdings auch als verschlossen und krankhaft ehrgeizig. Er, dem ein besonderes taktisches Geschick nachgerühmt wurde, vollführte den ungeheuerlichen Anschlag so unvorsichtig und stümperhaft ungeschickt, daß seine Entdeckung unausbleiblich war. Die Sinnlosigkeit seines Tuns grenzte ans Unheimliche und Abnorme. Hier hätte ein ernsthafter Romancier, der sich dieses Stoffes bemächtigte, eine
Grunde unbegreiflichen Menschen und seiner Tat zumindest versuchen müssen. Im Roman erscheint er dagegen als geradezu naiv sorglos, bis knapp vor dem Ende nicht aus seiner Ruhe zu bringen und mit stereotyp ironischem Lächeln oder Grinsen seine „Unschuld“ beteuernd. Auch die Figur des Hauptmannauditors Kunze, der auf Grund eines völlig überalterten, rückständigen Militärstrafverfahrens den Ankläger, Verteidiger und Richter in einer Person verkörperte, bleibt konturlos. Er wirkt eher wie ein Spießer, der immerzu dagegen ankämpfen muß, um nicht dem „Charme“ seines Angeklagten zu erliegen. Er gibt keinen ebenbürtigen Partner ab, obgleich doch das Hauptgewicht des Romans auf das geistige Duell der beiden Gegner gelegt wird (wie schon der deutsche Titel des Buches „Der Leutnant und der Richter“ zeigt).
Und die Verknüpfung der Kriminalgeschichte mit dem Zauber und der zugleich im Untergrund rumorenden Katastrophe der Monarchie? Das geschieht eher in der Manier aufgesetzter Lichter, um den Zusammenhang dieses doch merkwürdig ausgefallenen Ereignisses mit dem Gesamtgeschick von Staat und Gesellschaft herzustellen. Dabei kommt es durch die saloppe Art der Darstellung zu einem dauernden Schwanken zwischen Auf- und Abwertung. Um einige Beispiele zu geben: Wenn einem der Generalstäbler die Armee mehr bedeutete „als eine Institution, eine Religion, eine Rasse oder eine Brüderschaft“, weil sie „ein fremdes, dem Körper der Monarchie eingepflanztes Organ, genährt von den Lebenssäften der Nation und dennoch völlig unabhängig funktionierend“ war, wobei der Generalstab „das Herzstück dieses Organs“ darstellte, so wird einige Zeilen später versichert, „daß der Generalstab natürlich nichts dagegen hatte, daß seine Offiziere mit Ingrid Fiala schliefen — vorausgesetzt, daß diese Liason nicht zum Skandal ausartete“. Oder wenn sich der die Untersuchung gegen Hofrichter führende General glücklich schätzt, zusammen mit seiner Generation „eine friedliche, blühende, gedeihende Monarchie“ geschaffen zu haben, so verdüsterten sich gleich darauf seine Vorstellungen von der Wirklichkeit, denn „die unteren Schichten beteiligten sich an sinnlosen und geräuschvollen Straßendemonstrationen und an von der Sozialistischen Partei angezettelten Streiks, und die oberen Schichten vertaten ihre Zeit mit absurden Kinkerlitzchen, mit Duellen, Ausschweifungen und ständig wechselnden Liebschaften“. Da er, wie die meisten Militärs, glaubte, daß der Erhellung der psychologischen Wirr
nisse und letzten Motive dieses im Krieg unvermeidlich sei, sehnte er sich geradezu danach „und betrehtete ihn als das einzige Mittel, das die Monarchie von Schmutz und Schande befreien und die alte Ordnung moralischer Lauterkeit wiederherstellen würde“.
Beispiele für die „Charakterisierungskunst“ der Autorin: „die ganze
Kriegsclique war vertreten, angeführt von Franz Conrad von Höt- zendorf, einem schlanken, schmächtigen Mann mit der nervösen Energie eines Foxterriers und dem festen Zubiß einer Buldogge“. Kunze sitzt auf Schloß Konopischt Franz Ferdinand gegenüber: „An diesem Gesicht war nichts Majestätisches, und keine juwelenbesetzte Krone würde das jemals zuwege bringen. Die Mütze eines Küchenchefs oder die Kappe eines Hotelportiers würde besser auf diesen Kopf passen.“ Dagegen sieht Kunze Hofrichter (alias Dorfrichter) so: „Vor ihm saß ein außergewöhnlich schöner junger Mann mit der zarten blassen Haut eines Tiepolo- Engels, den warmen seelenvollen Augen eines Jagdhundes und der lasziven Unterlippe der spanischen Bourbonen.“
Der Originaltitel des aus dem Amerikanischen übersetzten Romans lautet: „The Devil’s Lieutnant“ (Des Teufels Leutnant); seine Autorin, die Gattin des bekannten ungarischen Boulevardschriftstellers Bush- Fekete, hat eine Menge Filmdrehbücher für Hollywood geschrieben. Ihre Routine zeigt auch der jetzt vorliegende, sensationell angekündigte Roman, der aber doch nicht mehr als gutes Illustriertenniveau hält und gewiß seine Leser finden wird. Ob jemals noch das Epos vom österreichischen „Krieg und Frieden“ geschrieben werden wird?
DER LEUTNANT UND SEIN RICHTER. Von Maria Fagyas. Deutsch von Isabella Nadolny. Rowohlt-Verlag, Reinbeck bei Hamburg. 376 Seiten. DM 26.—•.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!