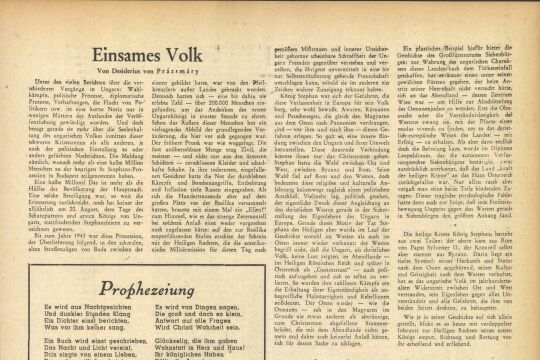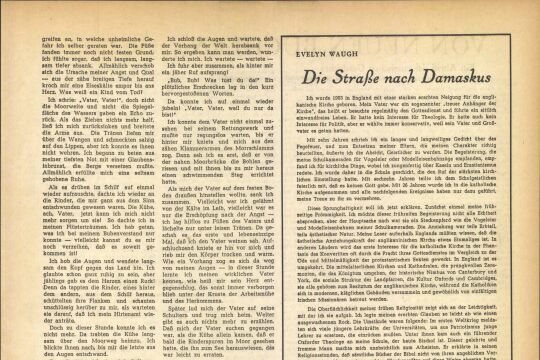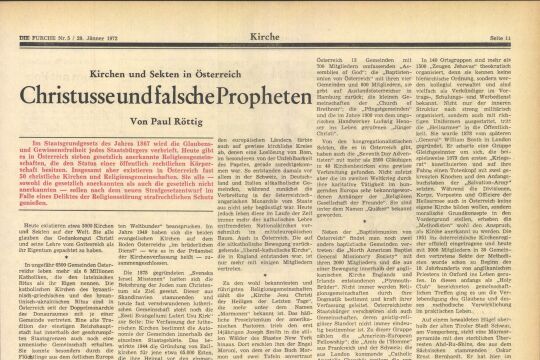Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Politik ist nicht nur Sache der Downing Street
Der hartnäckige Streik der britischen Bergleute, mittlerweile älter als sieben Monate und regelmäßig zu Ausbrüchen der Gewalt vor den Werkstoren ausartend, teilt Großbritannien. So sehr sich die Regierung auch den Anschein gibt, sich aus dem Disput herauszuhalten, er ist doch Premierministerin Margaret Thatchers zweite große Prüfung nach dem Falklandkrieg.
Zuletzt erwuchs den streitbaren Kohlearbeitern ein Bundesgenosse, dessen moralisches Urteil trotz schwindenden Einflusses und Rückgang von Mitgliedern immer noch größtes Gewicht besitzt: die etablierte englische Staatskirche.
Sie, die Hochkirche, versteht sich als das „Gewissen der Nation". Und als solches wurde die Stellungnahme zu einem politischen und sozialen Elementarereignis, wie es der Streik nun einmal darstellt, erwartet. Weniger programmgemäß war die Tatsache, daß sich die Kirche in kritischem Gegensatz zu einer konservativen Regierung postierte, die seit eh und je Unterstützung und Wohlwollen der Staats-Religitin gepachtet zu haben schien.
Nicht von ungefähr wurde das Schweigen der Kirche zum Ausstand dort gebrochen, wo dieser die größte Intensität erreicht hat. Als erster fordert der neue Bischof von Durham, Professor David Jenkins, „die Bergleute dürfen nicht besiegt werden".
Es ist derselbe Theologe, der mit dogmatischen Eigeninterpretationen hervortritt, die in anderen christlichen Gemeinschaften geahndet würden, in der breiten anglikanischen Kirche aber Platz haben: Der Oberhirte hegt Zweifel an Mariens jungfräulicher Empfängnis und erblickt in der Auferstehung Christi weniger Wirklichkeit als Mythos.
Nebst despektierlichen Ausfällen gegen den Chef der Kohlebehörde, MacGregor, klassifiziert Jenkins seinen offenen Briefwechsel mit dem zuständigen Energieminister Walker als einen „Dialog mit einem Tauben". Letzten Endes distanzierte sich der Bischof aber doch von Bergarbeiterführer Arthur Scargill — nicht wegen dessen Handhabung des Streiks, sondern vielmehr wegen Scargills marxistischer, prosowjetischer Grundeinstellung.
Der Primas der anglikanischen Kirche, Erzbischof Runcie, stellte sich zögernd auf die Seite des umstrittenen Bischofs von Durham. In einem Interview mit der „Times" hegte der Erzbischof von Canterbury Zweifel an einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, die „Arbeitslosigkeit in nie dagewesenem Ausmaß, Armut, Bürokratie, Verzweiflung mancher Gemeinschaften über ihre Zukunft" schaffe.
Kein Zweifel bleibt, von welcher Kommunität die Rede war: Die Dörfer der Köhler, die in ihrer Gesamtheit des einzigen Broterwerbs beraubt werden, wenn sich die Grubentore für immer schließen. Runcie lehnte die Gewalt an den Streikpostenlinien ab, schob die Schuld daran jedoch keinesfalls allein den militanten Grubenarbeitern zu.
Andere kirchliche Würdenträger konnten sich dem brennenden und aktuellen Thema nicht verschließen. Der Bischof von Birmingham, Montefiori, zieh die Regierung des Konfrontations- ' kurses im Bergarbeiterstreik und legte die Angst vor der Zukunft als das beherrschende Element der Unruhe bloß.
Graham Leonard, seines Zeichens Bischof von London, sprach von der Pflicht einer christlichen Kirche, sich mit jeder Sphäre menschlicher Aktivität zu beschäftigen. Die Kirche müsse sagen, daß Haß, so wie er als Gewalt im Disput Ausdruck findet, immer falsch sei. Leonard sah den Ausstand von der gesamtwirtschaftlichen Warte aus und folgerte: „Es kann für die Würde des individuellen Bergmannes nicht recht und billig sein, wenn dieser ständig in der Situation eines Subventionsempfängers verbleibt."
Es war die pastorale Aufgabe des Dieners der Kirche, die anglikanische Würdenträger veran-laßte, das Gebiet der Politik zu betreten. Die Regierung war darüber nicht sonderlich glücklich und erteilte der Kirche auf der Konferenz der Tories in Brighton den Rat, sich mehr um Dogmatik, weniger um Politik zu kümmern, auf daß sich rdie leeren Kirchen wieder füllten.
Nein, die anglikanische Kirche ist schon lange nicht mehr so etwas wie die „betende Sektion der Konservativen". Schon lange fordert sie die moralische Glaubwürdigkeit der Regierungspartei heraus. Aus der Sorge um die Armen und Bedürftigen, die Arbeitslosen und die aus rassischen Gründen Verfolgten, aus Unruhe über eine ökonomische Revolution, die soziale Unterschiede vertieft und unbeabsichtigt dazu beiträgt, daß die Kriminalität steigt, nimmt die Kirche Stellung.
Der Liverpooler Bischof David Sheppard etwa, ein vormaliger Cricketstar, zerpflückte in einer öffentlichen Vorlesung die wirtschaftlichen Grundlagen des Mo-netarismus Thatcherscher Prägung.
Der Gegensatz zu den Tories ist augenscheinlich: angefangen vom Dankgottesdienst am Ende des Falklandkrieges, statt einer Siegesfeier, wie es Whitehall gewollt hätte; dann in der Diskussion um die Atombombe, Zentralthema auf den Generalsynoden, wo Uni-lateralisten nur knapp unterlagen; schließlich die Positionen in sozial- und industriellen Unruhen. Die Losung gilt nicht mehr: „Politik ist Sache der Downing Street, nicht von Canterbury."
Die Kirche ist dem Mittelgrund verhaftet in einer Gesellschaft, die sich — nicht zuletzt unter Frau Thatchers Einfluß — in die Extreme weitet. An Stelle unpersönlicher Daten in der wirtschaftsmathematischen Kalkulation schiebt die Kirche das menschliche Wesen in den Vordergrund. Sie will „vereinen, nicht teilen" (Runcie), sucht Konsens statt Kompromiß, Mitgefühl statt Effizienz, Versöhnung statt notgedrungenem Friedensschluß.
Bischof Leonard definierte das kirchliche Engagement in der Politik: „Alles, was wir tun können, ist die Darlegung der breitesten christlichen Prinzipien, von denen sich die Regierung in der Ausübung ihrer Verantwortung leiten lassen sollte!"
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!