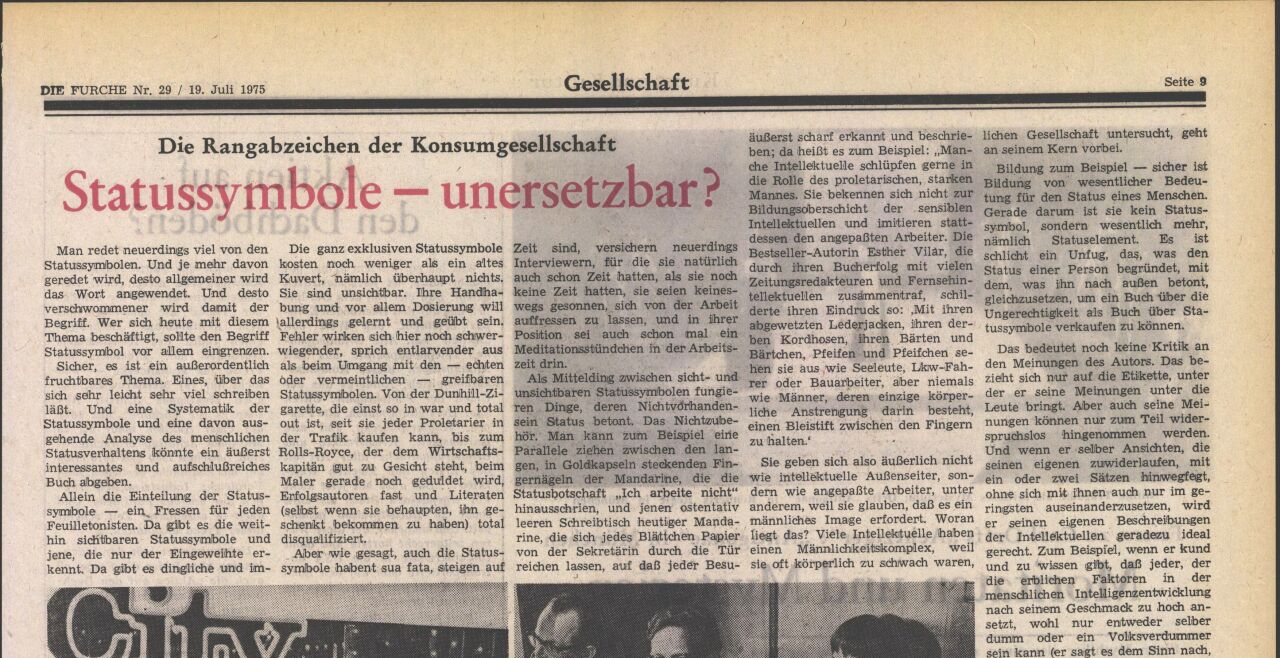
Man redet neuerdings viel von den Statussymibolen. Und je mehr davon geredet wird, desto allgemeiner wird das Wort angewendet. Und desto verschwommener wird damit der Begriff. Wer sich heute mit diesem Thema beschäftigt, sollte den Begriff Statuissymibol vor allem eingrenzen.
Sicher, es ist ein außerordentlich fruchtbares Thema. Eines, über das sich sehr leicht sehr viel schreiben läßt. Und eine Systematik der Statussymbole und eine davon ausgehende Analyse des menschlichen Statusverhaltens könnte ein äußerst interessantes und aufschlußreiches Buch abgeben.
Allein die Einteilung der Statussymbole — ein, Fressen für jeden Feuilletonisten. Da gibt es die weithin sichtbaren Statussimbole und jene, die nur der Eingeweihte erkennt. Da gibt es dingliche und immaterielle Statussymibole. Und natürlich hat jede Gesellschaftsschichte ihre eigenen Statussymbole. Oder solle man vielleicht eher sagen: Jede Kategorie, in der sich ein gesellschaftlicher Status ausdrücken kann, hat eigene Statussymbole?
Zu den weithin sichtbaren Statussymibolen könnte man zum Beispiel den Rolls-Royce rechnen, zu den versteckten, nur für den Eingeweihten erkennbaren (und nur für ihn bestimmten) die von den deutschen Prominenterischneidern für Tausende von Mark aus zertrennten und zerschnittenen alten Jeans zusammengenähten Jeans-Anzüge einer verklemmten deutschen Schickeria, die Hähnen gleicht, die am liebsten so laut wie möglich und zugleich unhörbar krähen möchte: Ihr Prestigebedürfnis ist so groß wie ihre Angst vor dem Neid der Mitmenschen. Ein auswegloser Konflikt.
Zur Schau getragenen oder versteckten dinglichen Statussymbolen wären die immateriellen Statussymbole gegenüberzustellen. Zum Beispiel: Zeit zu haben oder keine Zeit zu haben. Magengeschwüre zu haben oder sich dem Herzinfarkt entgegenzuarbeiten.
Die unsichtbaren Statussymbole stehen im Rang natürlich höher, weil sie der Usurpation durch statusbeflissene Statusiose nicht in so großem Maß aufgesetzt sind. Nichts ist schwerer, als ein Statussimbol, das jeder Hergelaufene kaufen kann, wenn er nur Geld genug hat, vor der Profanierung zu schützen.
Das Aktenfcofferl zum Beispiel, vor ein paar Jahren noch bei den obersten Zehntausend in Politik und Management hoch im Schwange, ist seit Jahren selbst schon in der Straßenbahn zu sehen und damit als Statussimbol so unmöglich geworden, daß Leute mit Instinkt ihre Unterlagen lieber in ein zerfetztes Kuvert stecken, solcherart einen gewissen intellektuellen Touch zur Schau tragend.
Die ganz exklusiven Statussymbole kosten noch weniger als ein altes Kuvert, nämlich überhaupt nichts. Sie sind unsichtbar. Ihre Handhabung und vor allem Dosierung will 'allerdings gelernt und geübt sein. Fehler wirken sich hier noch schwerwiegender, sprich entlarvender aus als beim Umgang mit den — echten öder vermeintlichen — greifbaren Statussymibolen. Von der Dunhill-Zigarette, die einst so in war und total out ist, seit sie jeder Proletarier in der Trafik kaufen kann, bis zum Rolls-Royce, der dem Wirtschaftskapitän gut zu Gesicht steht, beim Maler gerade noch geduldet wird, Erfolgsautoren fast und Literaten (selbst wenn sie behaupten, ihn geschenkt bekommen zu haben) total disqualifiziert.
Aber wie gesagt, auch die Status-symfoole hafoent sua fata, steigen auf und versinken wieder, ändern gar ihr Image. Das des Rolls-Royce etwa gilt seit der Pleite der Herstellerfirma als leicht vermenschlicht, doch wurde das Gerücht, der Rolls-Royce-Konkurs sei eine Erfindung der p.-r.-Abteilung des Werkes zwecks Herstellung echter Exklusivität gewesen, energisch dementiert.
Ein klassisches unsichtbares Statussymbol ist das richtige Verhältnis zur Zeit an sich. Es ist unverkennbar: Jene Schichten, deren Statussymbol es einst war, Zeit zu haben, konnten sich bis heute nicht davon erholen, daß jetzt jedermann reichlich Freizeit hat. Was für sie stets selbstverständlich war und als Chance zur Selbstverwirklichung erkannt und genützt wurde, kann, das ist ihre tiefste Uberzeugung, den Proleten nur auf dumme Gedanken bringen. Zumal ja einst die einen Zeit hatten und die anderen nicht, wohingegen es sich heute genau umgekehrt verhält. Das gehobene Management aller Bereiche, ab man es nun zur Ober- oder zur oberen Mittelschicht rechnen will, betrachtet heute den Fünfzehnstundentag, unter dem einst die Unterschicht stöhnte, geradezu als Statussymbol.
Oder besser: Tat es bis vor kurzem. Denn auch dieses Statussimbol hat sein Image gewandelt. Natürlich gilt noch immer, vergleichbar dem Satz, eine Dame, die ja sagt, sei keine Dame, daß ein Manager, der für einen in der Hackordnung unter ihm stehenden Termin-Bittsteller schon am nächsten Tag Zeit hat, kein Manager sein kann. Auch das sofortige Vorlassen eines angemeldeten Besuchers wird eher als Fauxpas gewertet — fünf Warteminuten gelten als angemessen.
Dabei ist aber die totale Gehetzt-heit, die noch vor wenigen Jahren als so vornehm galt, mittlerweise proletarisiert worden wie der Blazer auf seinem Weg von den besseren Stränden Floridas nach Floridsdorf. Spitzenmänner, die auf der Höhe der
Zeit sind, versichern neuerdings Interviewern, für die sie natürlich auch schon Zeit hatten, als sie noch keine Zeit hatten, sie seien keineswegs gesonnen, sich von der Arbeit auffressen zu lassen, und in ihrer Position sei auch schon mal ein Meditationsstündchen in der Arbeitszeit drin.
Als Mittelding zwischen sieht- und unsichtbaren Statussimbolen fungieren Dinge, deren Nichtvorhandensein Status betont. Das Nichtzufoe-hör. Man kann zum Beispiel eine Parallele ziehen zwischen den langen, in Goldkapseln steckenden Fingernägeln der Mandarine, die die Statusbotschaft „Ich arbeite nicht“ hinausschrien, und jenen ostentativ leeren Schreibtisch heutiger Mandarine, die sich jedes Blättchen Papier von der Sekretärin durch die Tür reichen lassen, auf daß jeder Besueher wisse: „Ich bin oben. Ich schreibe nicht. Ich entscheide.“
Trotz aller Schwierigkeiten mit dem Definieren des Wortes Statussymbol, dürfte schwer zu leugnen sein, daß es sich bei all den hier aufgezählten Dingen um Statussimbole handelt. Aber geht es an, die Bildung rundweg als Statussimbol zu bezeichnen? Oder das Haus, in dem ein Mensch mit Status wohnt? Die — bessere oder schlechtere — Adresse? Sicher hat ein Haus oder ein Wohnviertel, in dem es liegt, auch die Funktion, Status zu betonen, kann sie haben. Aber doch wob! nur unter anderem. Aber auch die Sprache einer soziologischen Schichte wird neuerdings gerne für die Liste der Statussymibole reklamiert — oft ohne Einschränkung Was schlicht ein Unfug ist. Denn wenn Sprache schon ein Statussymbol ist, dann wohli vor allem jenen gegenüber, und vor allem gesellschaftlich „Minderen“ gegenüber, die eine andere Sprache sprechen. Innerhalb einer Schicht ist deren Sprache vielleicht auch Abzeichen, Erkennungsmerk-mal, vor allem aber Kommunikationsmittel.
Wie schon erwähnt — eine Phänomenologie der Statussymbole wäre eine anregende, nützliche Sache. Leider gibt es das noch nicht Das Büchlein „Statussymibole“ des deutschen Psychologen Peter Lauster, das seit kurzem in den Buchhandlungen liegt und bereits von sich reden macht (Deutsche Verlags-Anstalt), ist leider eher geeignet, Verwirrung zu stiften. Noch besser: Verwirrungen. Einen ganzen Haufen von Verwirrungen.
Mit einem anderen Thema wäre es ein ganz gutes Buch mit ein paar ärgerlichen Stellen. Nämlich ein Buch über die Ungerechtigkeit in der gegenwärtigen Industriegesellschaft. Einige Statussymbole, zum Beispiel die sichtbaren und unsichtbaren Statussymbole der Intellektuellen, hat der deutsche Psychologe
äußerst scharf erkannt und beschrieben; da heißt es zum Beispiel: „Manche Intellektuelle schlüpfen gerne in die Rolle des proletarischen, starken Mannes. Sie bekennen sich nicht zur Bildungsdberschicht der sensiblen Intellektuellen und imitieren stattdessen den angepaßten Arbeiter. Die Bestseller-Autorin Esther Vilar, die durch ihren Bucherfolg mit vielen Zeitungsredakteuren und Fernsehintellektuellen zusammentraf, schilderte ihren Eindruck so: ,Mit ihren abgewetzten Lederjacken, ihren derben Kordhosen, ihren Barten und Bärtchen, Pfeifen und Pfeifchen sehen sie aus wie Seeleute, Lkw-Fah-rer oder Bauarbeiter, aber niemals wie Männer, deren einzige körperliche Anstrengung darin besteht, einen Bleistift zwischen den Fingern zu halten.'
Sie geben sich also äußerlich nicht wie intellektuelle Außenseiter, sondern wie angepaßte Arbeiter, unter anderem, weil sie glauben, daß es ein männliches Image erfordert. Woran liegt das? Viele Intellektuelle haben einen Männlichkeitskomplex, weil sie oft körperlich zu schwach waren, um einen Klassen- oder Studienkameraden, der sie beleidigte, richtig zu verprügeln. Das Training ihrer Intelligenz ist eine Kompensation, die später oft verheerende Folgen hat. Sie kämpfen als Redakteure, Wissenschaftler und Lehrer mit schonungsloser Brutalität und raffiniertem verbalem Sadismus. Sie attackieren verbal so sublim, daß sich ein Arbeiter schämen würde — wenn er die intelligenten Spitzfindigkeiten überhaupt verstehen könnte.“
Und an anderer Stelle: „Neue Codewörter sind die Statussymbole der Intellektuellen. Mehr Klugheit und Wissen zu zeigen als der andere, soll beeindrucken und Respekt verschaffen. Der Kampf unter der geistigen Oberschicht der Intellektuellen wird besonders hart geführt. Sie sind gnadenlos in ihrer Kritik gegenüber anderen Intellektuellen. So sensibel sie auch erscheinen, so sind sie im Intelligenzgefecht eiskalt und rücksichtslos. Wenn eine andere Meinung, Hypothese oder Theorie zerrissen werden soll, greifen sie zu den vernichtendsten Argumentationen. Solidarität, Verständnisbereitschaft und emotionale Wärme sind überaus selten. Kaum einer kann sich zur Bescheidenheit bekennen, weil er durch den Intelligenzkomplex ständig zur Demonstration seiner Intelligenz getrieben wird.“
So etwa das ganze Buch über die Statussymbole: Eindrucksvolle Formulierungen, manche überzeugende Analyse, aber leider ein unentwirrbares Durcheinander von Dingen, die zum Thema gehören, und solchen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Denn Statussymbole haben sicher mit der Herrschaft einer Gruppe über die andere zu tun, können sicher mißbraucht werden, um Menschen noch besser ausbeuten und unterdrücken zu können, aber wer das Thema der Statussymbole ausschließlich unter dem Blickwinkel der Ungerechtigkeit in der menschlichen Gesellschaft untersucht, geht an seinem Kern vorbei.
Bildung zum Beispiel — sicher ist Bildung von wesentlicher Bedeutung für den Status eines Menschen. Gerade darum ist sie kein Statussymbol, sondern wesentlich mehr, nämlich Statuselement. Es ist schlicht ein Unfug, das, was den Status einer Person begründet, mit dem, was ihn nach außen betont, gleichzusetzen, um ein Buch über die Ungerechtigkeit als Buch über Statussymibole verkaufen zu können.
Das bedeutet noch keine Kritik an den Meinungen des Autors. Das bezieht sich nur auf die Etikette, unter der er seine Meinungen unter die Leute bringt. Aber auch seine Meinungen können nur zum Teil widerspruchslos hingenommen werden. Und wenn er selber Ansichten, die seinen eigenen zuwiderlaufen, mit ein oder zwei Sätzen hinwegfegt, ohne sich mit ihnen auch nur im geringsten auseinanderzusetzen, wird er seinen eigenen Beschreibungen der Intellektuellen geradezu ideal gerecht. Zum Beispiel, wenn er kund und zu wissen gibt, daß jeder, der die erblichen Faktoren in der menschlichen Intelligenzentwicklung nach seinem Geschmack zu hoch ansetzt, wohl nur entweder selber dumm oder ein Volksverdummer sein kann (er sagt es dem Sinn nach, wenn auch etwas eleganter). Er mokiert sich über die .Arroganz der Herrschenden“, seine eigenen Meinungen belegt er nicht besser. Ein Arroganter, der Arrogante arrogant nennt.
Klar, daß auch eine Zeitung wie etwa die „Frankfurter Allgemeine“ kein Nachrichtenmedium, sondern primär ein Statussymbol ist, das „wegen dieses Images“ gekauft wird und nicht der Informationen wegen, die drinstehen. Es sei, schreibt der Psychologe, „momentan nicht realisierbar, daß ,FAZ'-Journalisten ihre Themen in klaren, einfachen Sätzen abhandeln, denn das würde das geistige Anspruchsniveau der geistigen Elite und derer, die dazu gehören wollen, unterfordern.“ Was ja stimmt. Aber ist ein „geistiges Anspruchsniveau“ nur ein Statussym-
Die Betrachtungsweise, mit der Lauster an das Thema der Statussymbole herangeht, ist jedenfalls selber eines. Statussyimfooi einer Schicht in dieser hochdifferenzierten Gesellschaft, in der jede Gruppe ihre eigenen Statussymbole hat. Statussymibol jener Schichte, in der man heute nicht mehr Analyse, sondern Offenbarung trägt. Und eine gewisse, der Pseudo-Arbeiterkluft der von Lauster so eiskalt demaskierten Intellektuellen vergleichbare Primitivität
Die kommt gleich am Anfang zur Geltung; da heißt es: „Während seiner Entwicklungszeit auf dem Erdball rang der Mensch mit der Natur um seine Überlegenheit In diesem Kampf ums Dasein siegte das stärkere, brutalere und intelligentere Lebewesen. Die Zeit des gnadenlosen Lebenskampfes in freier Wildbahn ist längst vorbei. Der Mensch hat die Natur fast besiegt. Er war letztendlich das stärkere, brutalere und intelligentere Lebewesen.“
Wer eine Phänomenologie der Statussymibole schreiben will, hätte weniger Science-fiction und mehr Darwin lesen sollen. Brutalität als Motor der Entwicklung ist die Ultima ratio der Science-fiction ,des Sozialdarwinismus, Hitlers (freier Phänomene, die nicht wenig miteinander zu tun haben). Bei Darwin selbst und überall dort, wo er in der modernen Forschung angewendet, nicht aber deformiert wurde, ist mehr von der Anpassung die Rede.
Vielleicht klingt einem Mann wie Lauster Anpassung zu sehr nach Evolution. Mag sein, daß er es mehr mit der Revolution hält. Mit der mag es jeder halten, der an die Evolution nicht mehr glauben kann — sie zu leugnen, wo sie im Gang ist, weil einem die Revolution besser gefällt, ist nicht revolutionär, sondern intellektuelles Revoluzzertum.
Aber natürlich glaubt gar nicht jeder an die Revolution, der sie im Knopfloch trägt. Auch das ist nämlich ein Statussymibol. Eines der neuesten, und eines der interessantesten.




































































































