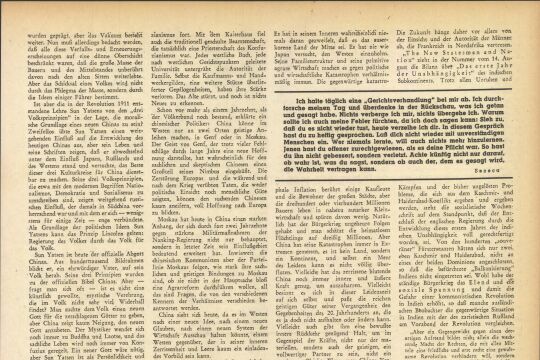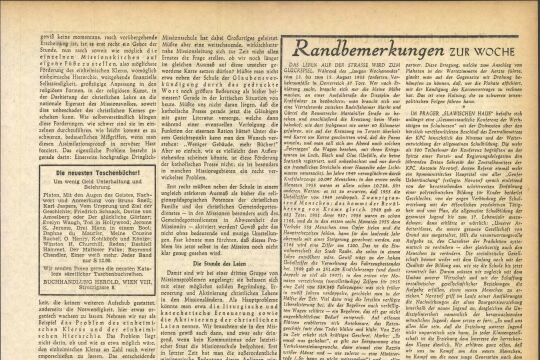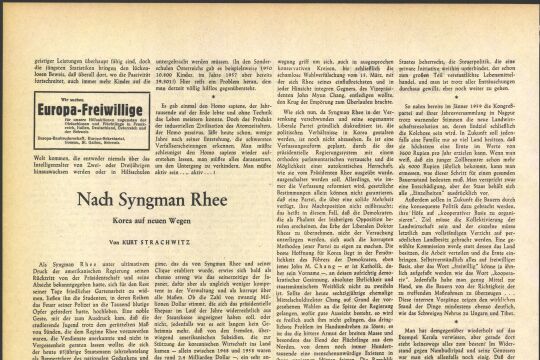Es bedurfte nur acht Monate nach der Einführung der Diktatur, und der Widerstandswille Indiens war vertrocknet wie die Erde auf dem Hochland Dekkan. Indien hat sich im permanenten Ausnahmezustand der Ministerpräsidentin Indira Gandhi niedergelassen wie ein Koloß in einem engen Gehege. Der wohltemperierte Zwang des Regimes, die lückenlose Erfolgspropaganda der Zeitungen, zusammen mit einer beispiellosen Ernte, vernebeln schon die Erinnerung.
Noch vor einem Monat gab es im autoritären Meer der Indischen Union zwei Inseln der Demokratie: Tamil Nadu und Gujarat. Und damals hieß es, Indira werde es nicht wagen, die beiden Unbotmäßigen im föderativen Gefüge der 21 Staaten zu kassieren. Tamil Nadu und Gujarat hatten Landesregierungen gewählt, die in Opposition zur Kongreßregierung in Delhi standen. Die Wahlen hatten noch vor dem Ausnahmezustand stattgefunden.
Jetzt hat Indira es gewagt. Die oppositionellen Landesregierungen sind durch Erlässe aus Delhi auseinandergetrieben worden. Was blieb, ist der Gestank vom großen Markt der käuflichen Oppositionspolitiker, die als Überläufer den Sieg des Regimes, den Ausnahmezustand, den Untergang der Demokratie in Gujarat einleiteten.
Wie schwach war doch die Lebenskraft dieser Demokratie! Wie überwältigend die Übermacht der Autorität, wurzelnd in Indiens Geschichte und Religion. Nur einige Jahrzehnte alt, von einem fremden Erdteil eingeschleppt und dann in den Händen von Adoptiveltern zurückgelassen, erlag die Demokratie, als die Generation, die sie adoptiert hatte, gestorben war. Sie mußte der jahrtausendealten Tradition der Gleichsetzung von Macht und Recht unterliegen. Als ob die Natur sich mit ihren Feinden verschworen hätte, belasteten Flut und Dürre die letzten Jahre der Demokratie, folgten ein ergiebiger Monsun und eine beispiellose Ernte der Proklamation des Ausnahmezustandes. Schutzhaft und Zensur haben das Regime gefestigt, doch die Natur brachte die Entscheidung: Glück ist die Legitimation der begnadeten Herrscherin. Wer will sich gegen eine Herrschaft auflehnen, die so offensichtlich die Gunst der Götter genießt?
In Europa gilt die politische Überzeugung. In Indien gelten der Glaube und die Loyalität gegenüber der Gruppe. Politische Überzeugung ist ein importiertes Gewand. Politisches Uberlaufen gilt in Indien als wenig ehrenrührig. Vergehen gegen die Gesetze der Religion aber sind unverzeihlich. So besiegelte Kharif, die gute Herbsternte, und Rabi, die noch bessere Frühjahrsernte, Indira Ghandis „Neue Ordnung“ und führte zum Triumph der Überläufer und zum Ende der Demokratie auch in ihrem allerletzten Rückzugsgebiet, Gujarat.
Wo die Opposition ausgelöscht worden ist, gedeiht die Konspiration. Wo die Zensur das Lautwerden von Klagen und Forderungen verhindert, spricht auf der Kehrseite der totalen Macht die lokale Verzweiflung in der Sprache des Roten Hahns. Indiens Zensur und Indiras Pressepolitik unterbinden die freie Information von Stadt zu Stadt, von Land zu Land; der Bürger darf nur erfahren, was ihm die Behörde zu wissen erlaubt. Diese Politik schirmt, was an der Spitze vorgeht, erfolgreich vor der Masse ab. Und sie verhindert, daß Störungen der glatten Oberfläche des autoritären Staates sich über die lokalen Grenzen fortpflanzen. Und doch, dieses Indien der Machtkämpfe hoch oben und der Not tief unten hat sich kaum verändert.
Oben, dem Blick der Masse nun völlig entzogen, kämpfen die Klüngel ihren ununterbrochenen Kampf um die Macht. Die Löwen, die Indira um sich gesammelt hat, sind in der autoritären Landschaft zu Wölfen geworden. Sie selbst, die Nehru-Tochter, wie jede Matriarchin einer
indischen Großfamilie in den Tru-beln des Lebens- und Machtkampfes, vertraut einzig und allein ihrem Sohn. Die Verantwortung für die Kontinuität von Macht und Einheit legt sie immer offener in die Hände ihres Sohnes, Sanjai Gandhi, Stellvertreter, vielleicht Kronprinz. Ausgehend vom „Kronprinzenproblem“ kündigen sich aber schon Usurpatorenkämpfe an. Sie waren immer das bewegende Element in der Geschichte der Höfe des vorkolonialen Indien.
Zwischen hoch oben und tief unten schwebend, ist die gar nicht so dünne und trotz allem rapid wachsende Mittelschicht Indiens zutiefst gespalten. Die neuen Mittelschichten des Entwicklungslandes, politischer Troß, Bürokratie, Funktionäre, Manager und deren Anhang, sind sehr schnell die Stützen der neuen Ordnung geworden. Sie haben den Wert von Autorität und Ordnung auf dem eigenen und auf dem Weg der Nation nach oben erkannt. Die alte Mittelschicht, vom Kolonialismus westlich, vom Kampf gegen den Kolonialismus demokratisch geprägt und in den Augen der neuen Herren „verseucht“, produziert noch Beispiele der Unbestechlichkeit des Gewissens, verliert sich aber in der fremden neuen Landschaft, aus der, zusammen mit der Demokratie, auch der Gandhismus ausgejätet worden ist.
Tief unten aber, wo auch die beste Ernte das Leben wenig verändert, weil Landlose, Geldlose und Rechtlose in den Jahren der Dürre zugrundegehen, doch auch von den guten Ernten sich nicht sattessen, können, bilden sich Herde der dörfischen Empörung, wo sich Überlebende und den Gefängnissen entsprungene Naxaliten einigeln: Rebelieh, die aus dem Dorfproletariat kommen, und Studenten unter dem Bild Maos, doch im Geist des Bundschuh, des Symbols der deutschen Bauernrebellioneri am Vorabend der Bauernkriege.
In einem Land der totalen Pressekontrolle bleibt dem Korrespondenten, der den offiziellen Nachrichten ebenso wie den allgegenwärtigen wilden Gerüchten mißtraut, nur der
Lokalaugenschein. Auf der Fahrt von Delhi nach Ahmedabad, der Hauptstadt von Sujarat, fühlte ich, daß es einer Insel der Demokratie zuging. Bis zur Staatsgrenze, einen Tag und eine Nacht lang, dösten die Menschen im Zug vor sich hin. Aber hinter der Grenze des Provinzstaates Gujarat, die bis dahin auch die Grenze des Schutzhaftsystems war, schüttelten die Menschen mit dem Staub aus ihren Decken auch ihre Anonymität ab. Und es zeigte sich: Viele hatten das gleiche Ziel, die Konferenz für Bürgerrechte, die in jedem anderen Provinzstaat die Teilnehmer hinter Schloß und Riegel gebracht hätte.
Dann aber, in der frommen Landeshauptstadt Ahmedabad und im sterilen Gartenzentrum der Landesregierung, Gandhinagar, erkannte ich, daß es um diese Insel schon geschehen war. Die Oppositionspolitiker feilschten bereits mit den Regimeagenten um den Preis ihres Uberlaufens.
In Ahmedabad fühlte man noch die Begeisterung. „Hier wird die Diktatur nicht eindringen“, sagten sie zu mir, Dozenten und Studenten auf der Universität. Und „Babudhai Zindabad“ riefen Tausende in der Nacht, als auf allen Straßen von Ahmedabad Divali, der Gott Rama, gefeiert wurde — hoch lebe Babubhai, der Chefminister der Oppositionsregierung des Landes, gegen das Zentrum in Delhi. Doch ich sprach auch mit Führern von Jana Sangh, der Zelotenpartei, die einen Hindustaat will. Sie sagten: „Indira zwang uns in die Janata — zusammen mit den Feinden der Religion!“ Janata ist die vereinigte Opposition gegen das Regime, aus der Babubhai seine Regierung gebildet hatte. Wie stark mußte die Spannung in der Janata gewesen sein, wo Jana Sangh und deren Geheimorganisation RSS, deren Fanatismus einst zum Mord an Mahatma Gandhi geführt hatte, mit den Gandhianern zusammenarbeiten mußten.
Und ich sprach mit Chimambhai Patel, wegen Korruption gestürzter Chefminister einer in Wirren untergegangenen Kongreßregierung, Finanzier beider Seiten im bürgerkriegsartigen Interregnum vor der Wahl der Janata-Regierung, und, als ich in Ahmedabad war, der massiven Stütze der neuen Macht, Janata.
Hinter seiner feisten Festigkeit stehen die Brutalität und die Käuflichkeit des orientalischen Provinzpotentaten. Seine Züge zeigen die Heuchelei des Frömmlers aus der Händlerkaste: „Ich verwalte hier nur das Erbe des Mahatma!“ Tatsächlich ist er in Khadi gehüllt, das handgewebte Tuch des Befreier-Asketen, längst aber die Uniform der Heuchelei. „Ich diene“, sagt er, „dem Geist des Mahatma, indem ich Babubhai, dem ehrlichen Gandhia-ner, helfe. Ich verfüge hier über ein kleines bißchen Macht. Und die hält ihn aufrecht.“ Dieser Chimambai würde sein Vegetariertum um keinen Preis verkaufen, aber sich selbst hat er ein Leben lang auf allen politischen Märkten feilgeboten.
Nach Gandhi Nagar, der absurden Gartenstadt, die, wie Neu-Delhi, als
Regierungssitz die Armut des Landes weglügen soll, fuhr ich mit dem Chefredakteur der Western Times. Er stoppte einige Meter vom Haus des Chefministers entfernt: „Ich warte hier, bis Sie wiederkommen. Man soll nicht glauben, daß ich einer der Seinen bin. Die Zeiten können sich ändern.“
Chefminister Babubhai Patel, ernst, in sich geschlossen, doch eher versonnen und väterlich als charismatisch, verabschiedete mich mit der Voraussage des Endes seiner Regierung: „Wir sind Indiras demokratisches Alibi. Sie wird uns ungeschoren lassen, solange sie ein demokratisches Alibi braucht. Das ist die Galgenfrist, die wir nützen müssen, um zu zeigen, was Demokratie ist, bevor sie, vielleicht für lange Zeit, untergeht.“
In Neu-Delhi las ich dann einige Tage vor der Auflösung der Landesregierung des Babubhai: Chimambai Patel hat der Janata-Regierung seine Unterstützung entzogen. Er
will, daß „Recht und Ordnung wieder in Gujarat herrschen“ — er will in den Schoß der Kongreßpartei zurück. Am selben Tag standen die Namen von einem Dutzend Führern von Jana Sangh in der Zeitung. Die brachten, bevor das Schiff sank, ihr Zelotentum und ihre Karriere unter das sichere Dach von Indiras Kongreßpartei — und des Ausnahmezustandes, den sie in Gujarat willkommen hießen.
In Gujarat hat Indien ein Textil-zentrum geschaffen und in Ahmedabad hat Mahatma Gandhi einen Textilarbeiterstreik geführt. Die Menschen in Gujarat kennen die Veränderung, die wirtschaftliche und die politische. In Rajastan, entlang der westlichen Grenze der Union, löst Indien sich in Wüste und Steppe auf, und der Boden und die Menschen kennen nur den Wechsel vom Jahr des ausbleibenden Monsuns zum Jahr des guten Monsuns, und das ist ein Wechsel vom Tod zum Leben. In diesem Frühjahr erkannte ich auf der Fahrt durch Rajastan das Land nicht wieder. Wo es vor zwei Jahren nur verkrusteten Boden, von Rissen gesprengt, gegeben hatte, stand jetzt das Gras und warteten Getreidefelder auf das Schneiden.
In Jaisalmer, der westlichsten Stadt Indiens, wo die Steppe in die Wüste übergeht, hat es neun Jahre keinen Tropfen Regen gegeben. Das Jahr vor dem Ausnahmezustand brachte einen schwachen Monsun. Und in der Stadt gab es wieder Leben. 1975, drei Wochen nach der Proklamation des Ausnahmezustandes, brach die bleierne Wolkendecke am Himmel entzwei, und es kam der große Monsun, der alle Wadis in Ströme verwandelte.
In den neun Jahren der Regen-losigkeit zogen von den 27.000 Menschen in Jaisalmer mehr als 20.000 fort. In den beiden Brunnen im Fort gab es bis in das siebente Jahr noch Wasser. Doch die beiden Brunnen im Fort waren den Unberührbaren verwehrt, und die Zurückgebliebenen, fast alles Shudras und Unberühr-bare, hielten sich an das Kastengesetz auch dann noch, als niemand mehr da war, das Verbot zu erzwingen. Zuletzt versiegten auch die Brunnen im Fort. Meilenweit entfernt gab es in alten Staubecken da und dort noch seichtes, staubschweres Sickerwasser. Ein Tankwagen kam in jeder Woche aus Jodpur. Nur die Immobilität des Hungers und des Durstes verhinderte, daß Jaisalmer eine völlig verlassene StadJ wurde. Die Sprünge, die Hitze und Trockenheit in die Stadtmauer gebrochen hatten, waren noch da, als ich nun in diesem Frühjahr in die Stadt kam, die wieder voll von Menschen war. Wir wurden mit Farbe Übergossen, von Kindern umtanzt, von alten Brahmanen angetrommelt: Sie feierten Holi, den Beginn des Sommers, der Regen bringen sollte. Und es regnete — ein verregnetes Holifest! Was kann da der Sommer mehr bringen als einen guten Monsun und einen guten Kharif! Das Glück vom Himmel hat das Land verändert und Jaisalmer wiedererweckt. Was sollen da die politischen Veränderungen, die in der Stadt beschlossen worden sind?
Der Diener in der Herberge vor der Stadtmauer sagte zu mir, er sei Lehrer gewesen, durch die Schulsperren in der Dürre arbeitslos geworden und in dieser Zeit der Rezession ohne Aussicht auf eine andere
Arbeit. In Jaipur, der Häuptstadt von Rajastan, meinten die Burschen im Basar: „Die gute Ernte ist eine Sache. Die geht nur die Menschen an, die Boden haben. Der Mangel an Absatz für Kugellager ist eine andere Sache. Die geht uns an. Wir haben in der Kugellagerfabrik gearbeitet.“
Die Ausnahmegesetze verbieten Streiks und verbieten Entlassungen. Beide Gebote werden durchbrochen. Darüber zu berichten, ist ein Bruch der Tabus des Ausnahmezustandes.
Nach Delhi zurückgekehrt, erkenne ich die Wirkung der Tabus und der Erfolgspropaganda. Die Zeitungen sind Plantagen der Erfolgsmeldungen geworden. Sie bringen das Tatsachenmaterial für die Riesenplakate entlang der Straßen: Indien eine Nation auf dem Marsch. Und sie setzen die Szene für den Besuch des Politikers aus dem demokratischen Westen: Ein Land der Erfolge, ein benevolentes Regime des großen Einverständnisses. Doch im Volk gut schon die Erfahrungsweisheit; Nichtwissen ist Sicherheit.
Ein Metallarbeiterführer, der aus Kalkutta angekommen ist, weil ihm dort der Boden unter den Füßen zu heiß geworden ist, erzählt, daß Tausende in Westbengalen im Streik stehen. Die streikenden Arbeiter werden aus den Dörfern versorgt, wo man das Letzte für sie zusammenkratzt. Und ein Mann, der aus Bihar gekommen ist, dem rückständigsten und dunkelsten Staat der Union, versteht nicht die Unbekümmertheit der Stadt, während in Bihar ganze Dörfer, deren sozialistische Führer im Gefängnis oder im Untergrund sind, Naxaliten aufnehmen. Aus dem Gefängnis von Kalkutta sind 48 Naxaliten geflohen. Zehn kamen um. 38 sind in den Dörfern von Westbengalen und Bihar untergebracht worden. Immer mehr sammeln sich dort.
Flucht und Untertauchen verraten, daß Organisationen bestehen, Dörfer die Flüchtlinge schützen. In der Demokratie ist die Organisation, die aus der Bauernrebellion von Naxalbar bestand, trotz Hunger und der großen Ungerechtigkeit versik-kert. Es gab Wege, zu klagen, zu fordern. Die Rechtlosigkeit des Ausnahmezustandes ist für die Naxaliten und ihresgleichen der bessere Boden.
Indira Gandhi scheint es gelungen zu sein, der Bewegung der politischen Opposition und des politischen Widerstandes ein Ende zu bereiten. Die modernen Massenmedien verbreiten nicht die Information, sondern unterbinden jede Kommunikation. Der Ausnahmezustand verstärkt die Kontrolle der Elite in der Politik und der Bürokratie in den Städten über das ganze Land. Es ist ein großes Land, es hat 600.000 Dörfer. In dieser Situation kann jeder Herd der Unzufriedenheit — isoliert von der Nation — nun immer zum Herd einer lokalen Auflehnung werden.
Das Vokabular und einige Begriffsfetzen des Widerstandes sind in die Dörfer des Subkontinents eingedrungen, auf dem es noch nie einen sozialen Aufstand gegeben hat. Mahatma Gandhi und Mao Tse-tung stimmen in einem überein: daß das Geschehen vom Dorf ausgeht und auf die Stadt übergreift. Das Regime des Ausnahmezustandes der Indira Gandhi ist stabil geworden — gefährdet nur von Verschwörungen der Mächtigen an der Spitze und durch die Verzweiflung der Rechtlosen und der Isolierten ganz tief unten.