"Lasst uns sterben, um die Menschen frei zu machen", lautet die Zeile eines Nationalliedes, in dem der US-Freiheitskampf mit Christi Kreuzestod verglichen wird: Religion, religiöse Symbole und Rituale gehören - erst recht seit dem 11. 9. 2001 - zum staatlichen Selbstverständnis der USA.
Der 11. September 2002 war für New York alles andere als ein normaler Arbeitstag, auch wenn die meisten Geschäfte und Behörden geöffnet hatten. Der ganze Tag war geprägt von Gedenkfeiern für die Opfer der Terroranschläge, in denen "Amerika attackiert wurde, weil wir die Heimat der Freiheit und ihr Verteidiger sind ... weder Tod noch Leben, weder Herrscher noch Mächte können uns von der Liebe Gottes trennen. Möge er die Seelen der Verstorbenen segnen ... und immer unser Land begleiten." Solche Worte könnten aus dem Mund eines amerikanischen Fernsehpredigers kommen. Tatsächlich stammen sie aber von Präsident George W. Bush bei der Gedenkfeier, die zwei Tage nach den Terroranschlägen stattfand.
"... den Feinden trotzen"
Auch außerhalb gottesdienstlicher Feiern hat Bush wiederholt im Namen Gottes Gewalt verkündet und den "Krieg gegen den Terror" mit religiösen Phrasen legitimiert. Das bekümmert nur wenige, denn Religion und Politik zu verknüpfen, hat in Amerika eine lange Tradition.
Im 16. Jahrhundert waren die Puritaner aus England nach Amerika gekommen, denn England war damals ein religiös sehr intolerantes Land. Die Kirche von England hatte sich zwar von Rom abgespalten und einige Reformen durchgeführt, für die Puritaner gingen diese aber zu wenig weit. Das Königshaus stellte sie vor vor zwei Möglichkeiten - sich ohne Wenn und Aber Kirche und Krone unterzuordnen, oder das Land zu verlassen. Viele brachen nach Amerika auf.
Die Vision der Emigranten fasste John Winthrop, einer ihrer Anführer, in einer Predigt zusammen. Er verpflichtete seine Gefährten zu gegenseitiger Liebe und Beachtung der Gebote Gottes. Dann werde "der Herr unser Gott sein ... und wir werden Tausenden unserer Feinde trotzen ... denn wir müssen bedenken, dass wir wie eine Stadt auf dem Berg sein sollen und die Augen der Völker auf uns blicken."
Die Puritaner verließen England also nicht, um in Amerika Toleranz zu üben und religiös Verfolgte willkommen zu heißen, sondern um eine Gesellschaftsordnung nach ihren religiösen Vorstellungen aufzubauen. Sie verstanden sich als das neue Volk Gottes, das neue Israel, das mit Gottes Hilfe auszog, um das neue Gelobte Land - Amerika - in Besitz zu nehmen. Diese Vorstellung ist einer der Gründe für das heute noch tief verwurzelte Gefühl, etwas Besonderes zu sein.
Die Unabhängigkeitserklärung, der Vereinigten Staaten von 1776 steht als eines der wichtigsten staatlichen Dokumente Amerikas ebenfalls in einem religiösen Kontext: "Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: Dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind." Dies war nicht nur ein Lippenbekenntnis, um die verschiedensten religiösen Gruppen der damaligen Zeit zufrieden zu stellen, sondern persönliche Überzeugung von Thomas Jefferson, dem Autor der Unabhängigkeitserklärung, und anderer Gründerväter.
Ihren Höhepunkt erlebte die Verwendung religiöser Sprache in der Politik mit Abraham Lincoln während des amerikanischen Bürgerkriegs. Bei der Einweihung des Gettysburger Nationalfriedhofes 1863 sprach er von Tod und Blut der Gefallenen, "die ihr Leben hingaben, damit die Nation lebe". Lincoln betonte in seiner Rede das urchristliche Motiv des sich Hingebens für andere: Die Gefallenen seien den Märtyrertod gestorben und aus ihrem Vermächtnis, ihrem Blut, entspringe neues Leben und eine neue Freiheit.
Aus der Zeit des Bürgerkrieges stammt auch ein Lied, in dem es heißt: "Wie er [Christus] für uns starb, um die Menschen heilig zu machen, lasst uns sterben um die Menschen frei zu machen." Nach dem Bürgerkrieg wurde das Lied, wann immer es zu offiziellen Anlässen gesungen wurde, positiv umformuliert: "... lasst uns leben, um die Menschen frei zu machen". Bei der Gedenkfeier zwei Tage nach dem 11. September 2001, die vom Bush-Team vorbereitet wurde, entschloss man sich, die Originalversion zu verwenden. Zum Glauben, ein auserwähltes Volk zu sein, war damit endgültig die Vorstellung, Märtyrer für die Welt zu sein, hinzugekommen.
Zivilreligiöses Pontifikalamt
Als 1961 mit John F. Kennedy der erste Katholik zum Präsidenten gewählt wurde, nahm der Religionssoziologe Robert N. Bellah Kennedys Antrittsrede zum Anlass, einen Artikel zum Phänomen Religion und Politik in den USA zu verfassen. Er bezeichnete darin dieses Verhältnis als "Zivilreligion" - ein Begriff, der von Jean-Jacques Rousseau stammt. Darunter verstand Bellah ein System von Symbolen, Ritualen und sprachlichen Mustern, das einen religiösen Stellenwert einnimmt, unabhängig von den Kirchen existiere, mit diesen aber nicht in Konkurrenz trete. Zum Ausdruck kommt diese Zivilreligion, so Bellah, in der religiösen Verehrung der amerikanischen Flagge, in Ansprachen der amerikanischen Präsidenten und in den Zeremonien an staatlichen Feiertagen oder bei politischen Veranstaltungen.
Eines dieser zivilreligiösen "Feste" fand Ende Jänner dieses Jahres statt, als sich George W. Bush in der Rede zur Lage der Nation an die amerikanische Bevölkerung wandte. Ohne zu übertreiben könnte man diese Ansprache auch als "zivilreligiöses Pontifikalamt" bezeichnen. Nachdem die Minister und die Berater des Präsidenten in den Kongress eingezogen waren und ihm den Weg bereitet hatten, zog Bush selbst ein, von tosendem Applaus umwogen, hunderte Hände wollten geschüttelt werden. Jeder versuchte, den Präsidenten in die Hände zu bekommen, auch wenn es nur das biblische Zipfelchen seines Gewandes war. Als sich dann das Getöse gelegt hatte, wurde der Präsident vom Sprecher des Repräsentantenhauses begrüßt, und neuerlicher Jubel ließ das Kapitol erzittern. Dann endlich sprach der Präsident die erlösenden Worte: "Wenn wir heute hier zusammenkommen, befindet sich unsere Nation im Krieg, unsere Wirtschaft ist in einer Rezession und die zivilisierte Welt steht vor einer noch nie zuvor dagewesenen Gefahr. Dennoch war die Lage der Nation nie stabiler." Mehr war nicht nötig, um die Kongressmitglieder neuerlich zu zu Standing Ovations zu bewegen. Dies passierte gleich mehrere Male. Der Präsident sagte etwas, die Leute klatschen, standen auf, setzten sich wieder, der Präsident sagte wieder etwas ...
In dieser Rede zur Lage der Nation erregte Bush auch mit seiner "Achse des Bösen" Aufsehen. Schon zuvor hatte Bush verkündet, dass der Krieg gegen den Terror eigentlich ein "monumentaler Kampf des Guten gegen das Böse" sei. In Bushs Gedankenwelt kann nur Amerika diesen Kampf anführen und gewinnen, da die USA "die Heimat der Freiheit und ihr Verteidiger sind". Mit diesen Ansichten steht Bush nicht allein da: Viele Amerikaner konnten sich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, welche sie - die Amerikaner, die selbst doch die ganze Welt lieben - so hassen können wie die Terroristen des 11. September.
Am 11. September 2002 läuteten um 10.29 Uhr, die Zeit, zu der der zweite Turm des World Trade Centers in sich zusammenbrach, im gesamten Bundesstaat New York die Glocken. Während der Gedenkfeier wurde auch die oben bereits erwähnte Ansprache Abraham Lincolns zur Einweihung des Gettysburg Nationalfriedhofes verlesen, um jener zu gedenken, die ihr Leben opferten und opfern mussten, damit, wie Bush es immer wieder formulierte, die Nation lebe und neue Kraft schöpfe.
Der amerikanische Linguist und Kulturkritiker Noam Chomsky sagt in mehreren Interviews, die unter dem Titel "9-11" in Buchform erschienen sind (auf deutsch: "The Attack", Europaverlag, Hamburg 2002) über das religiöse Kriegsgeschrei, dass es viel leichter sei, im Feind die Inkarnation des Bösen zu sehen, als die Ursachen der Gewalt verstehen zu versuchen und sich der eigenen Verantwortung zu stellen. Gerade die US-Außenpolitik habe im vergangenen Jahrhundert, auch durch ihre Israel- und Irakpolitik, einen Beitrag geleistet, dass in den islamischen Ländern der Hass gegen den Westen wuchs.
Chomsky redet keinesfalls einem Fundamentalismus das Wort, der die Geschehnisse als Konsequenz der amerikanischen Politik oder gar als Strafe Gottes interpretiert. Vielmehr warnt er davor, sich in einer Welt komplexer politischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge die Hände in Unschuld zu waschen. Terrorismus müsse bekämpft werden, aber die Kriegserklärung von Präsident Bush, "wer nicht für uns ist, ist gegen uns", helfe wenig. Effektive Terrorbekämpfung kann, so Chomskys Überzeugung, nur auf internationaler Ebene, in Zusammenarbeit mit der UNO und den islamischen Staaten geschehen und muss die Drahtzieher vor einem weltweit anerkannten Gericht zur Verantwortung ziehen.
Der Autor studierte katholische Theologie in Graz und beschäftigte sich in seiner Diplomarbeit mit der amerikanischen Zivilreligion.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!





































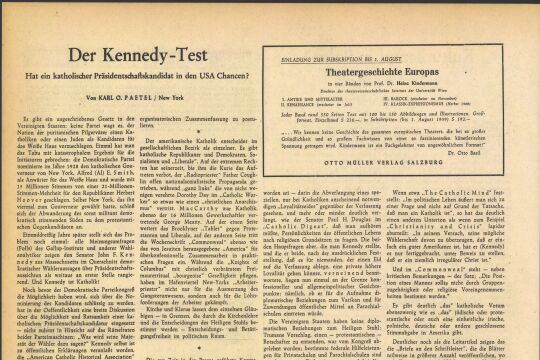
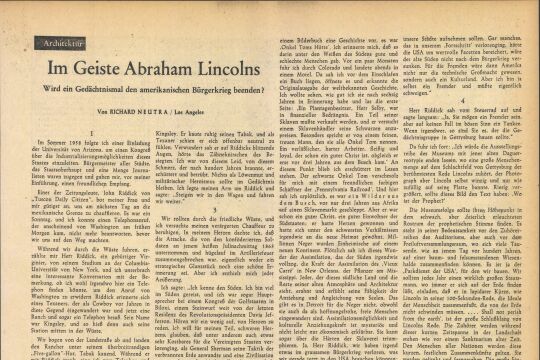











.jpg)












































