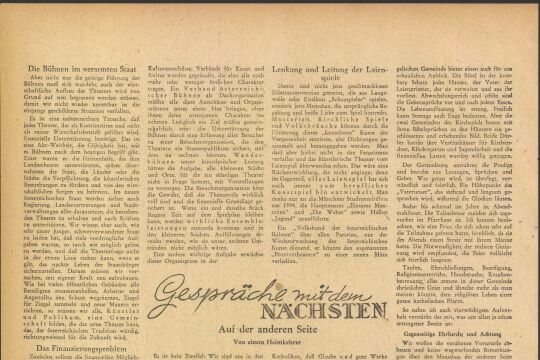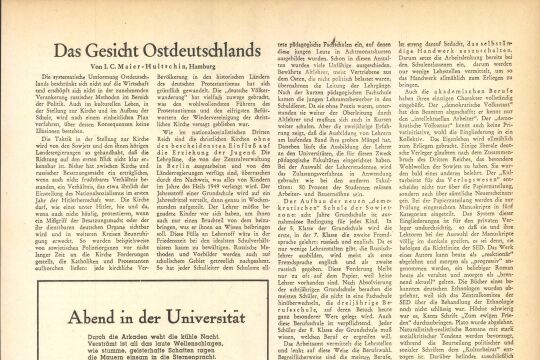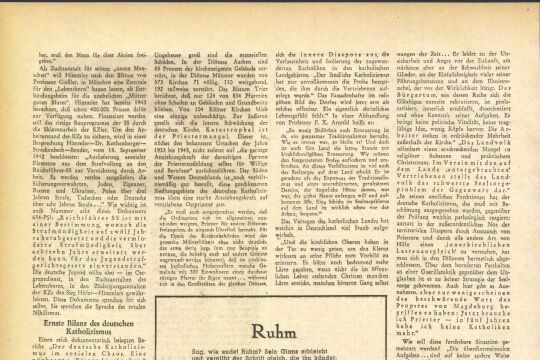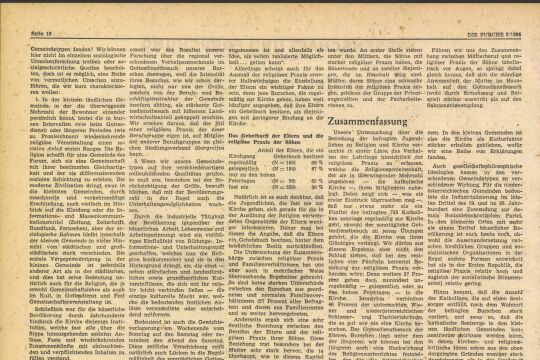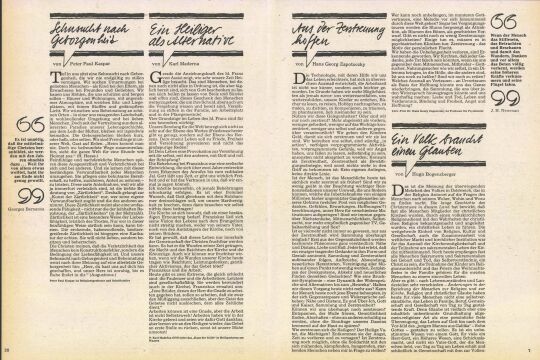Mehrfache Diaspora Berlin
Katholiken waren in Berlin immer in der Minderheit. Christen in der säkularen Stadt sind als Ganzes in der Diaspora. Und der innerdeutsche Ost-West-Konflikt ist auch für die Jugendseelsorge relevant.
Katholiken waren in Berlin immer in der Minderheit. Christen in der säkularen Stadt sind als Ganzes in der Diaspora. Und der innerdeutsche Ost-West-Konflikt ist auch für die Jugendseelsorge relevant.
Im protestantisch geprägten Berlin lebten die Katholiken immer in Diaspora, eher unauffällig und zurückgezogen. Der Bau der Mauer führte zur Entwicklung zweier eigenständiger Traditionen. Die Katholiken im Osten befanden sich in doppelter Diaspora. Zu ihrer Situation als religiöse Minderheit kam noch die politische Ausgrenzung im kommunistischen Staat. Sie mußten im verborgenen agieren und konzentrierten sich auf christliche Bildung und Spiritualität.
Die katholischen Gemeinden im Westen waren dagegen vom sozialen und politischen Leben der Gesellschaft nicht ausgeschlossen. Die unterschiedlichen Lebensumstände entwickelten unterschiedliche Mentalitäten. Neun Jahre nach der "Wende" steht es fest: nur die junge Generation, die von der Zeit der Mauer nicht geprägt ist, könnte in Zukunft die Unterschiede aufheben.
Zwei Studentengemeinden - zwei eigenständige Traditionen "Die beste Art und Weise sich einander zu nähern, ist die gemeinsame Arbeit", sagt Thomas Brose. Er ist seit September 1989 Bildungsreferent der Katholischen Studentengemeinde (KSG) Maria Sedes Sapientiae in Ostberlin. Nach der Wiedervereinigung Berlins blieb die Gemeinde eigenständig, ebenso wie die im westlichen Bezirk Tiergarten ansässige KSG Sankt Thomas Morus. "Oft verstehen die Hauptamtlichen der beiden Gemeinden einander nicht, so Brose weiter. "Ihre Lebenserfahrungen und die Mentalitäten sind zu unterschiedlich." Dennoch sind neun Jahre nach der "Wende" die Kontakte der beiden KSG Berlins häufiger als früher. Die neue Studentengeneration hat keine prägenden Erinnerungen an die Zeit der Mauer. Jeder sucht sich die Gemeinde aus, die ihn anspricht.
In der DDR-Zeit standen sich die Gläubigen und die Bischöfe sehr nah, weil sie in einer feindlich gesinnten Umwelt bestehen mußten", erzählt Brose. "Auch heute wird die Autorität der Hauptamtlichen bei uns nicht in Frage gestellt." Der in einer religiösen Familie aufgewachsene Theologe meint, daß das Wesentliche für die Arbeit seiner Gemeinde, die persönliche Beziehung mit Gott sei, und nicht innerkirchliche Konflikte und Streitfragen.
Für die Mitglieder der KSG im Westen sind auch diese Fragen wichtig. Es ist üblich, daß im Gottesdienst Studenten eine Ansprache halten und das nicht nur dem Priester überlassen. In der Gemeindekirche werden auch Gottesdienste von Frauen für Frauen angeboten. Kontroverse Themen wie Homosexualität kommen zur Sprache. "Es werden nicht nur katholische und christliche Studenten betreut, sondern auch Studenten anderer Religionen", sagt der Ausländerreferent der Thomas-Morus-Gemeinde, Martin Romünder, dessen Ausländerreferat ebenfalls eine Besonderheit der westlichen Gemeinde ist. "Die Ausländer sind aber nicht nur Leute, die Probleme haben, sondern auch solche, die feiern", berichtet Romünder. "Bei uns werden viele Feste gefeiert, bei denen ausländische Studenten ihre Kultur und Tradition präsentieren können."
Zwar sind die beiden Gemeinden mit Informationstischen an den drei großen Berliner Universitäten präsent - die Ost-Gemeinde an der Humboldt-Universität, die West-Gemeinde an der Freien Universität und an der Technischen Universität -, doch ist für die Mitglieder der Maria Sedes Sapientiae dieses Engagement wichtiger. Sie versuchen die Vorurteile mancher Leute aus der ehemaligen DDR, daß Christen dumm und rückständig seien, abzubauen.
Die West-KSG hat sich immer als offene Gemeinde verstanden, zu der jeder kommen und einige Zeit mitmachen kann, ohne große Verpflichtungen einzugehen. In der Ost-Gemeinde waren die Mitglieder vor der "Wende" an allen Unternehmungen beteiligt. Heute ist dies nicht mehr so. Es besteht eine breite Palette von Angeboten in Berlin. Die beiden katholischen Studentengemeinden sind zwei davon.
"Je jünger die Kinder, desto geringer sind die Unterschiede" "Die unterschiedliche Prägung der Kirchen im Osten und im Westen spielt kaum eine Rolle bei Jugendlichen und Kindern", erzähltt Ulrich Bonin, der bis Ende August dieses Jahres Jugendseelsorger des Erzbistums Berlin war. "Je jünger die Kinder, desto geringer sind die Unterschiede zwischen Ost und West. Dennoch sind die Jugendgruppen im Westen wesentlich zahlreicher." Der aus Westberlin stammende Theologe hat eine 17jährige Praxis in der Jugendpastoral hinter sich. "Die meisten Jugendlichen, die zu uns kommen, sind aus katholischen Familien", erzählt Bonin weiter. "Es gibt über 30 katholische Jugendverbände in Berlin, in denen die Jugendlichen nach Alter und Interessen organisiert sind. Neben Ministrantenkursen, an denen Mädchen und Jungen teilnehmen, veranstalten wir Partys und Reisen, zum Beispiel nach Taize und Israel. Die Wochenendseminare, die wir anbieten, behandeln Themen wie Sexualität, Sinn des Lebens, Arbeitslosigkeit ... Manche Kinder und Jugendliche sehen die Frustration ihrer Eltern, die arbeitslos sind, und stellen sich ernsthaft die Frage: Welchen Beruf soll ich wählen, um später Arbeit zu haben?"
Die Kameradschaft sei das, was Kinder und Jugendliche in Gruppen und Verbänden suchen. Man solle jede dieser Gruppen und Verbände ihre Eigenart entwickeln lassen. Es gebe kein Patentrezept für Jugendpastoral. "Der geistliche Leiter ist ohne Zweifel ein wichtiger Faktor für die gute Zusammenarbeit in einer Gruppe", sagt Bonin. "Wichtig ist deswegen, den Leitern die Möglichkeit zu bieten, sich in Kursen und Seminaren weiterzubilden und untereinander Erfahrungen auszutauschen."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!