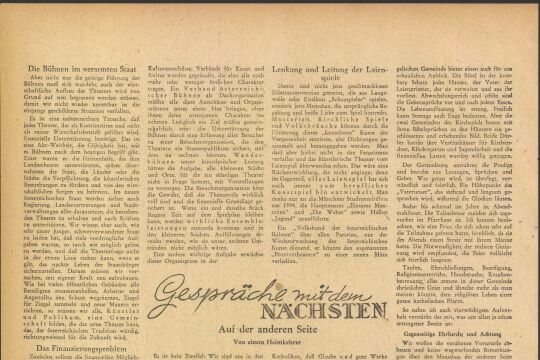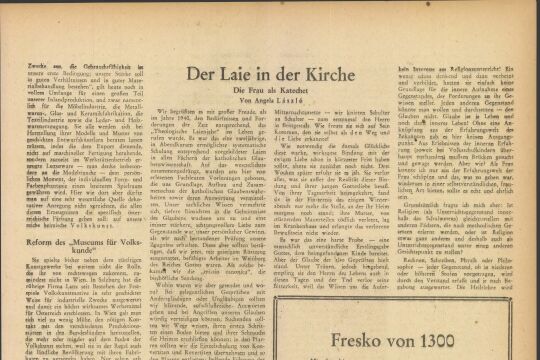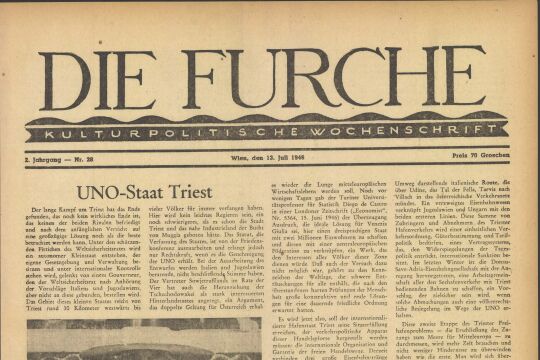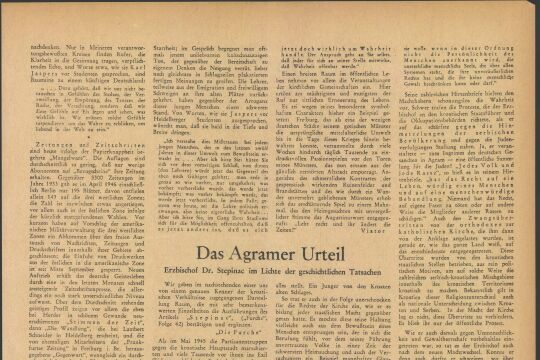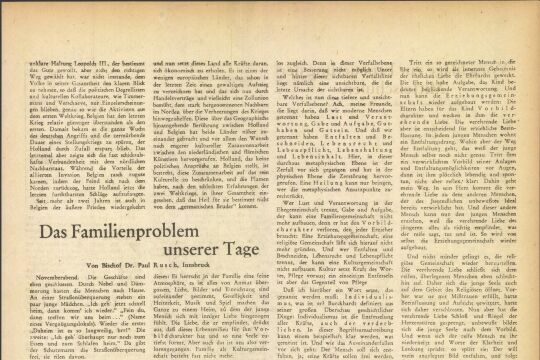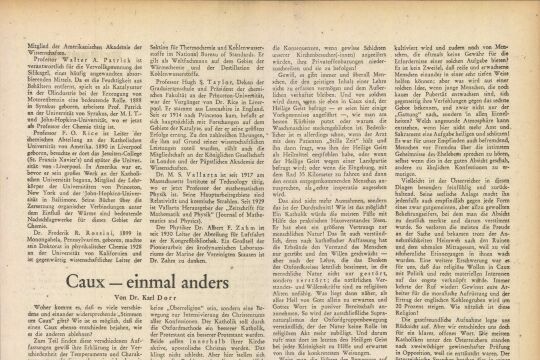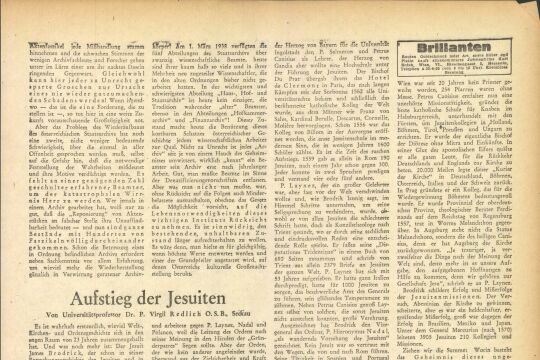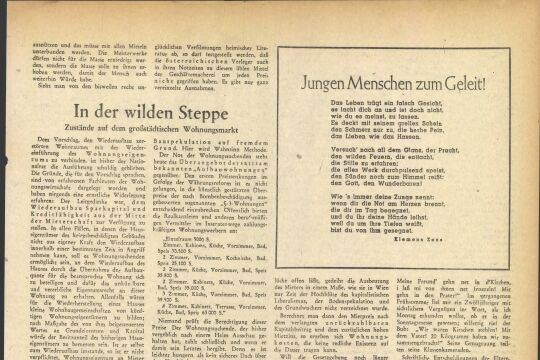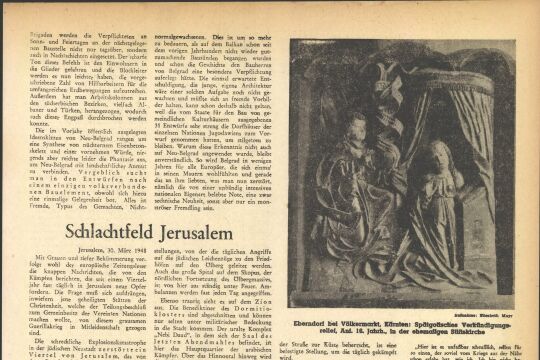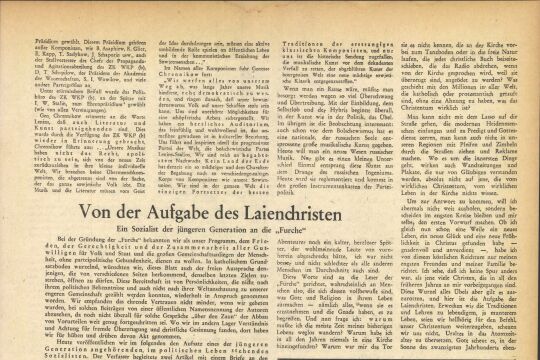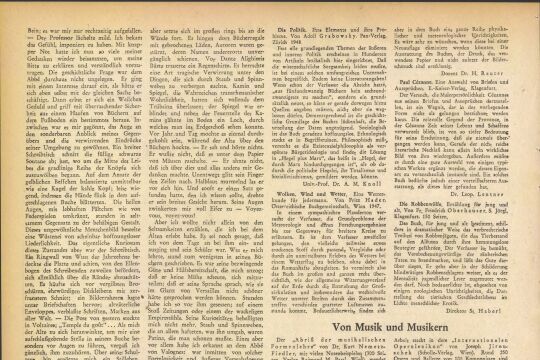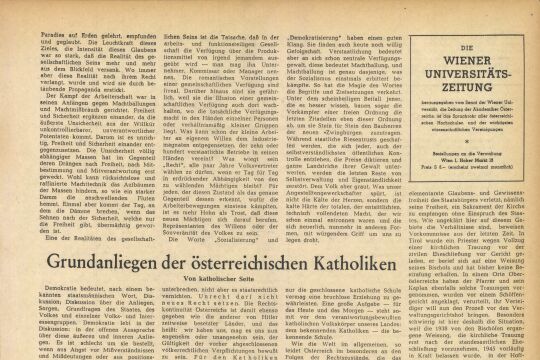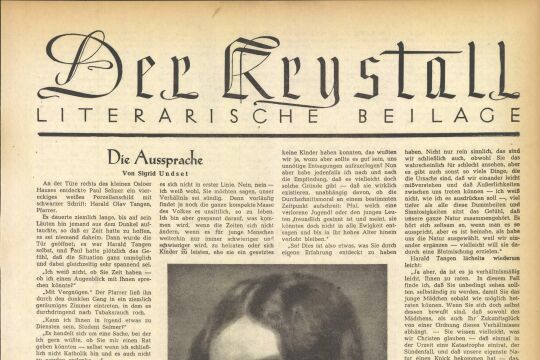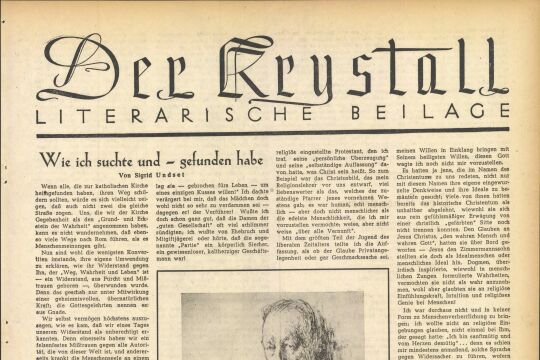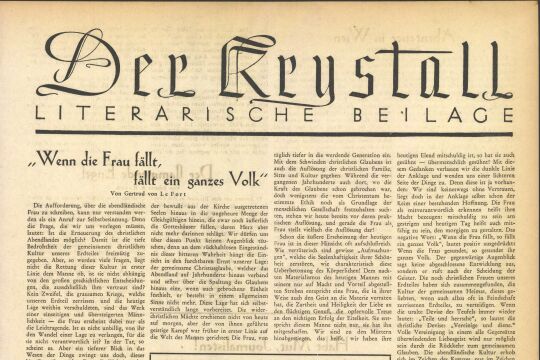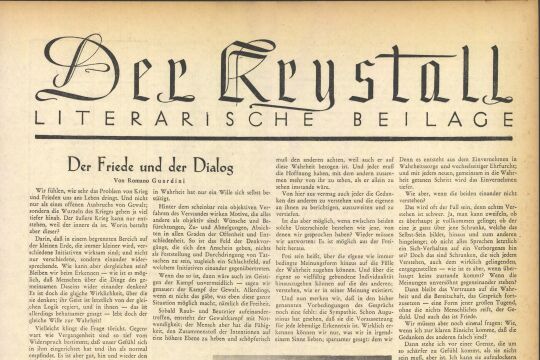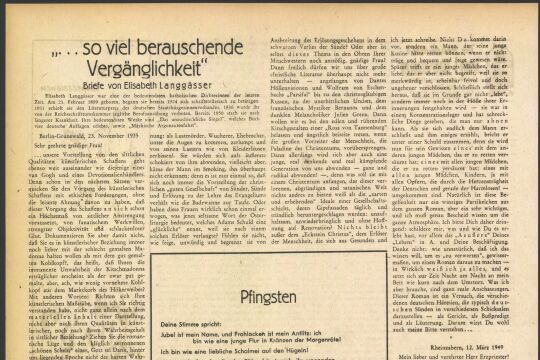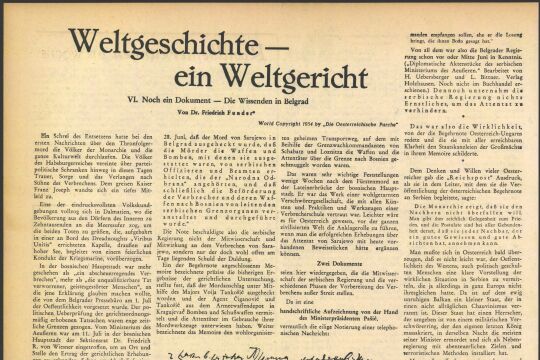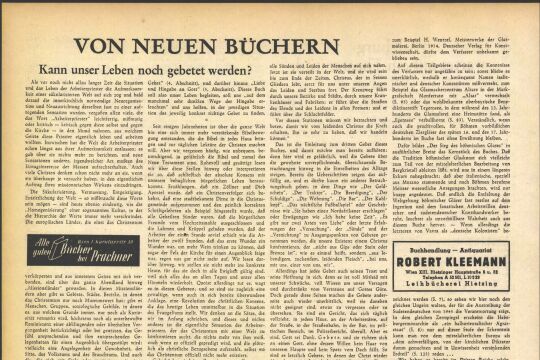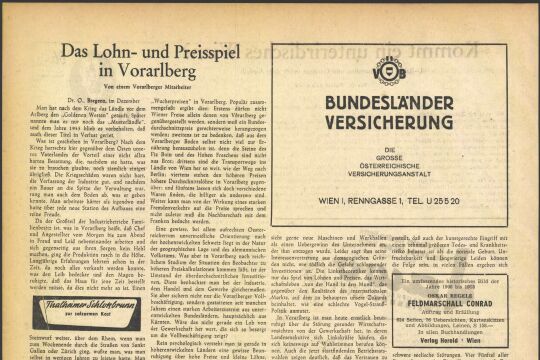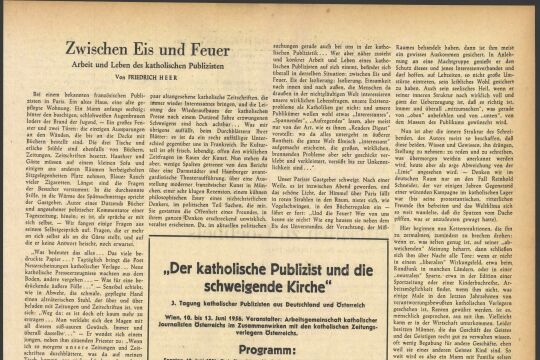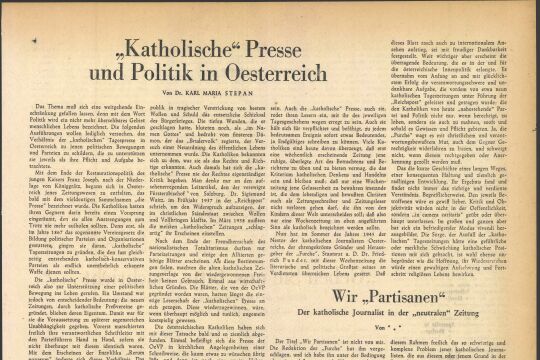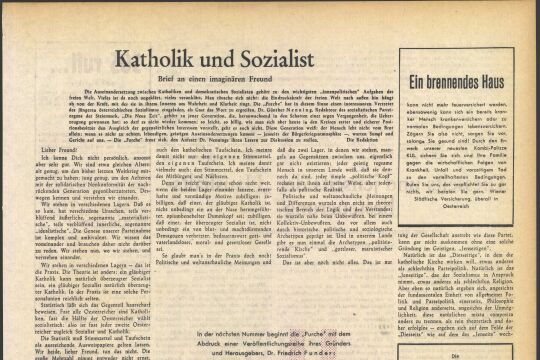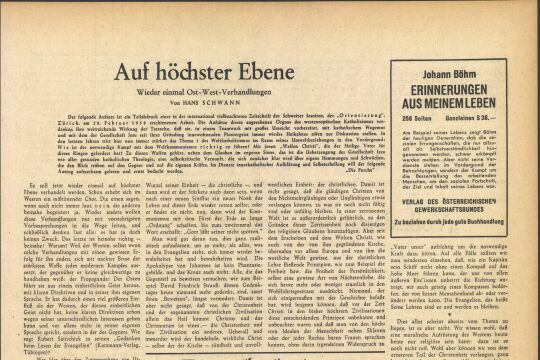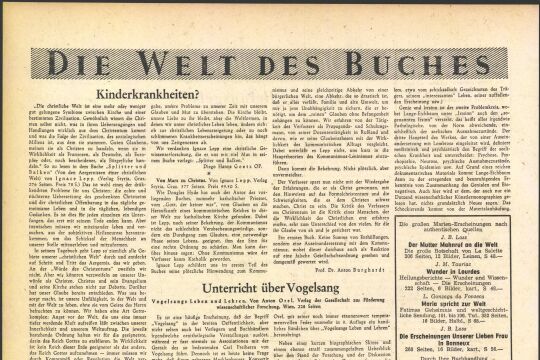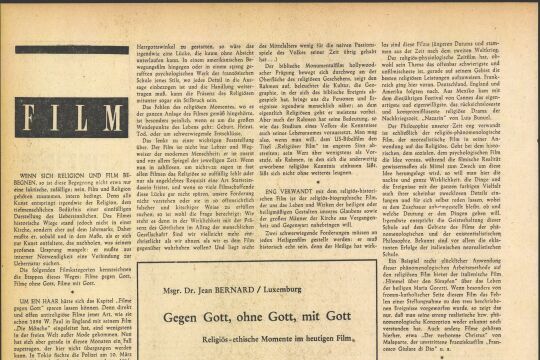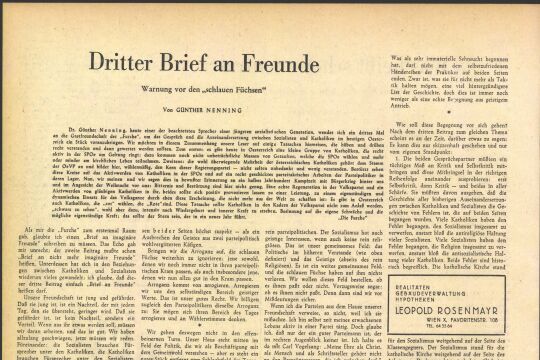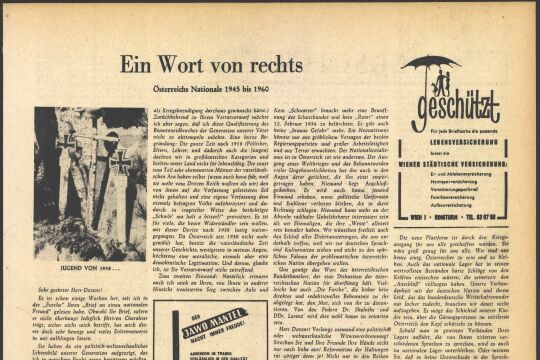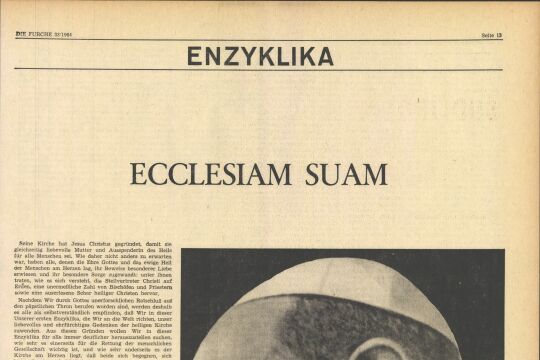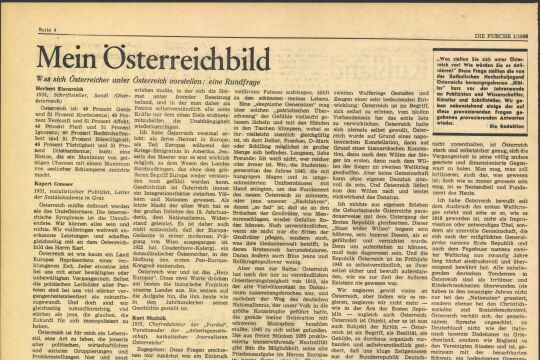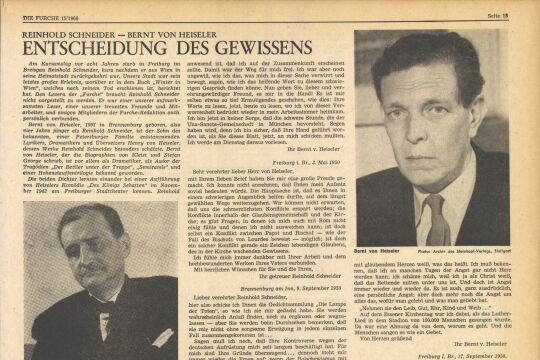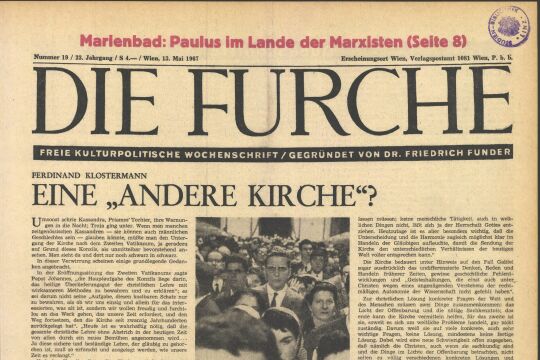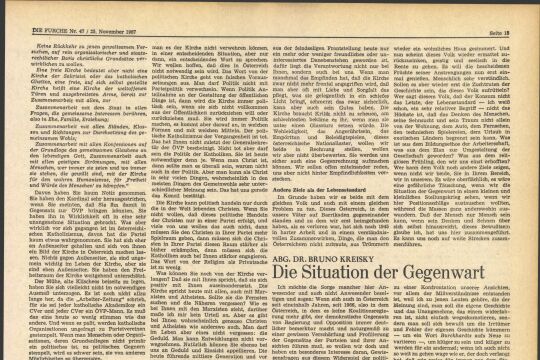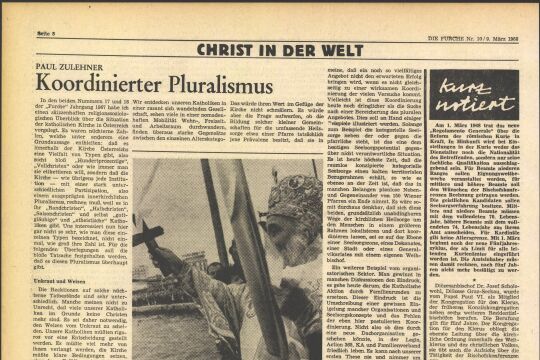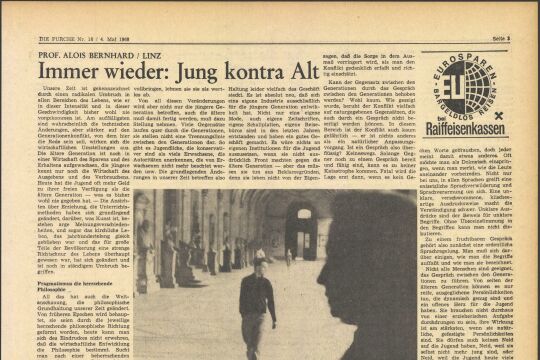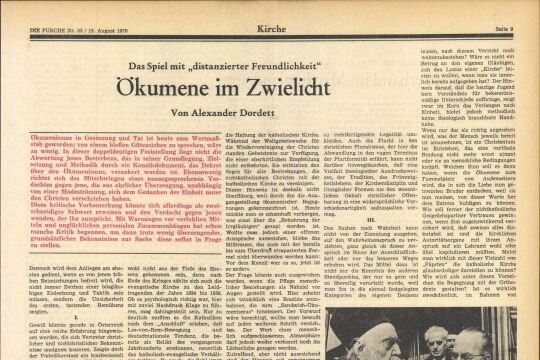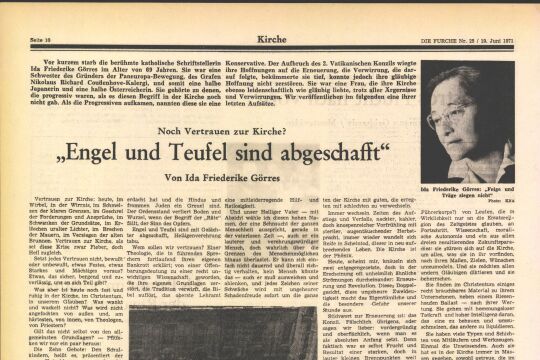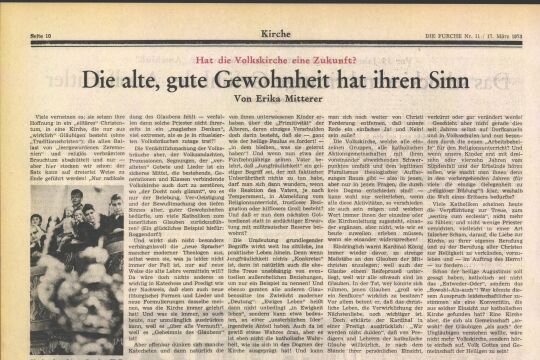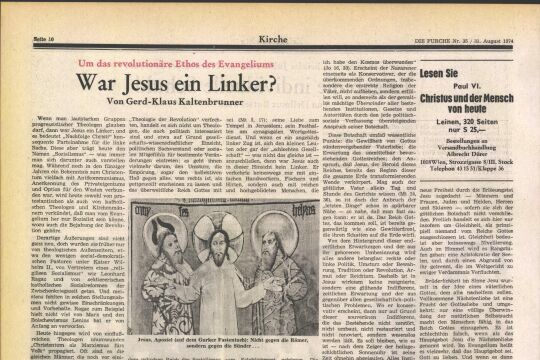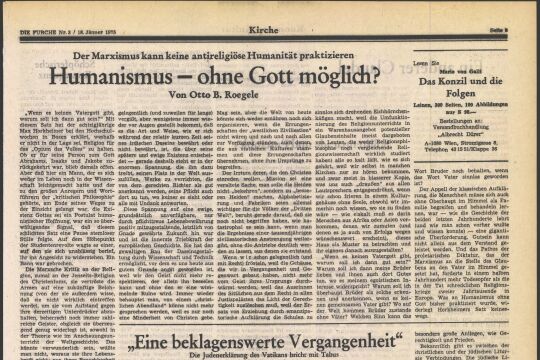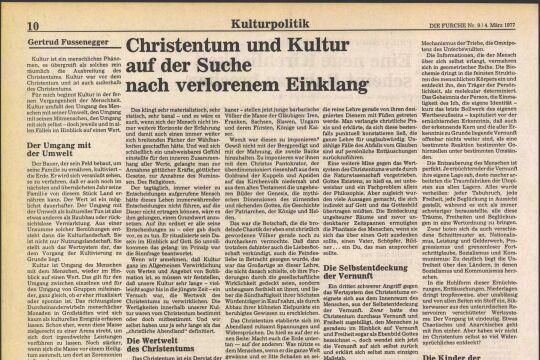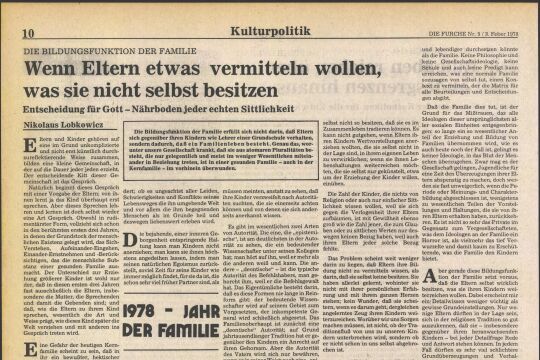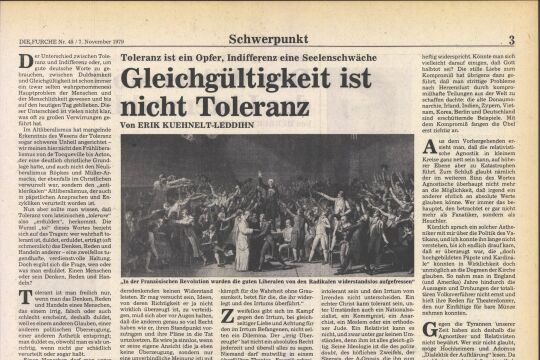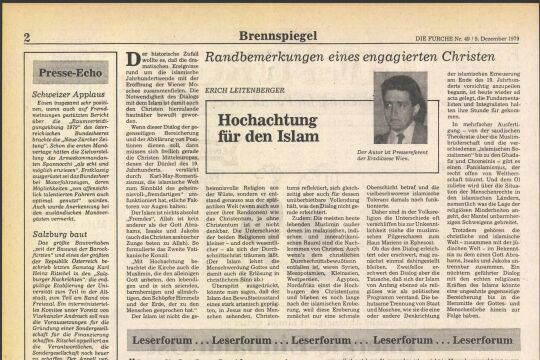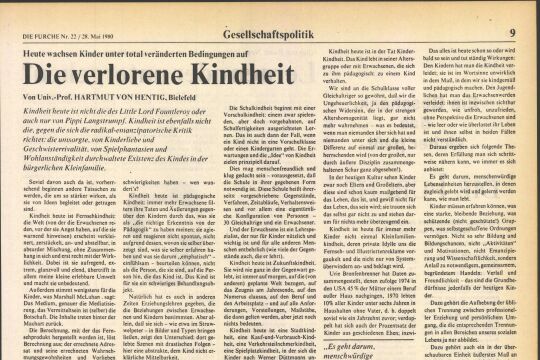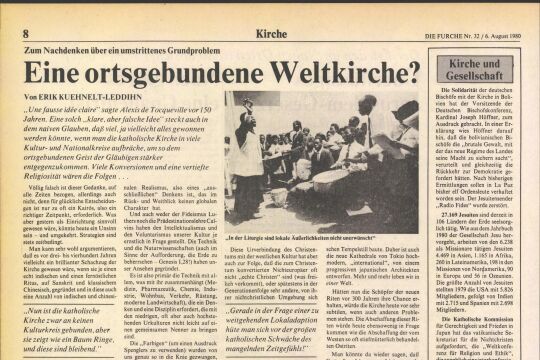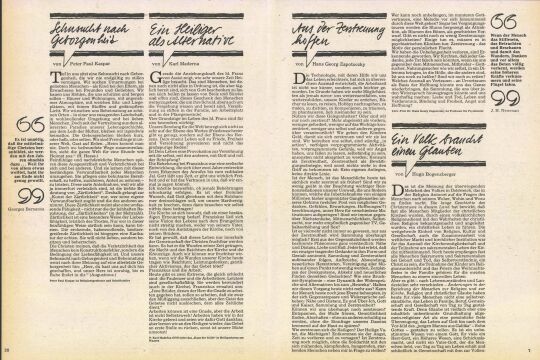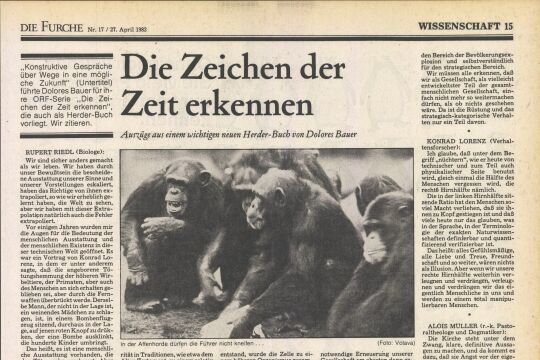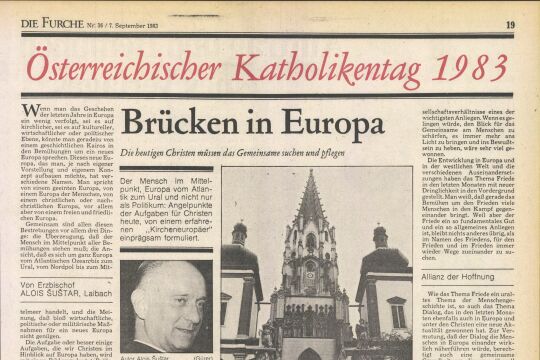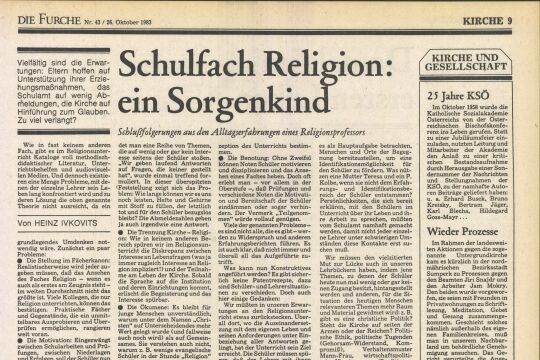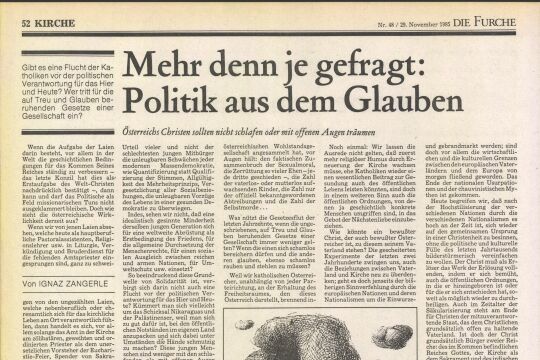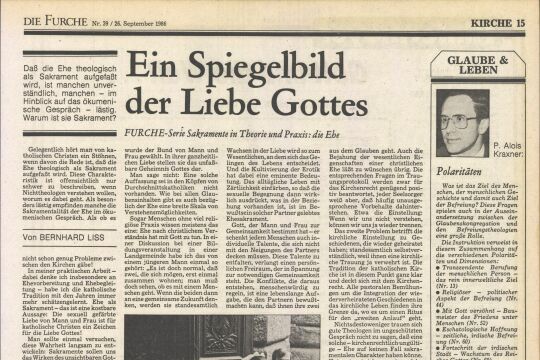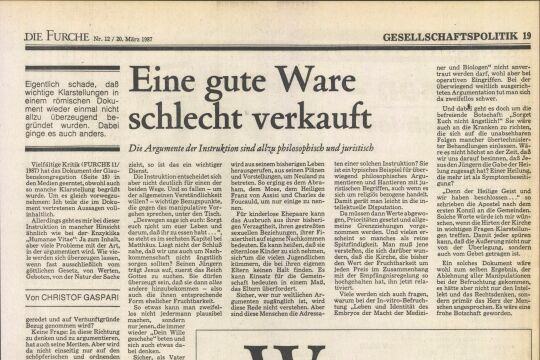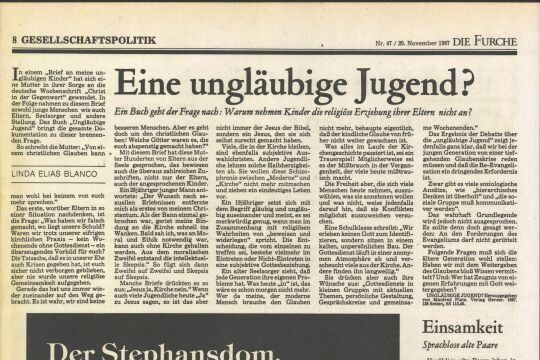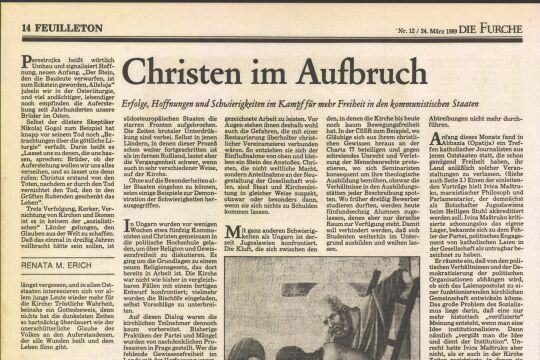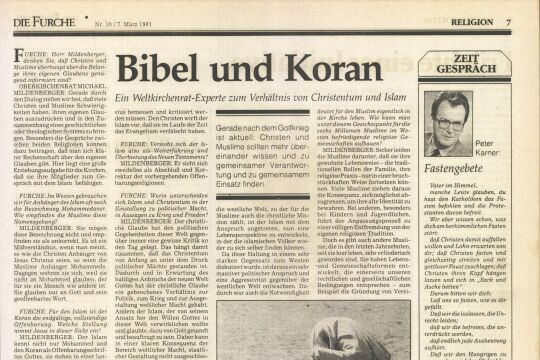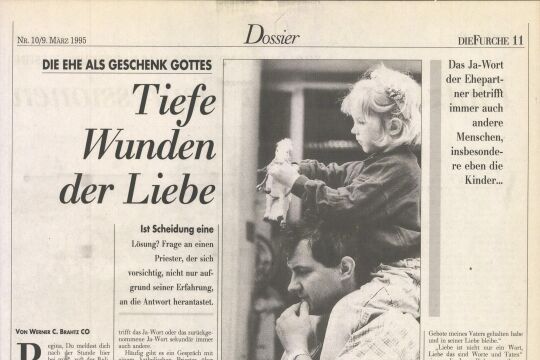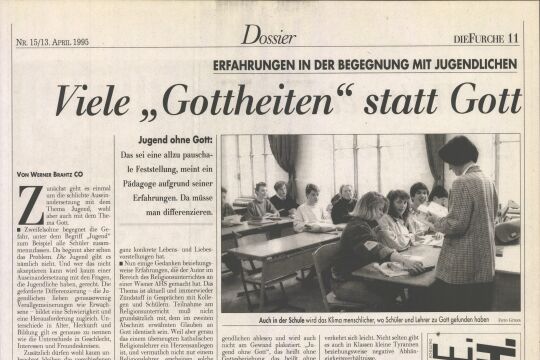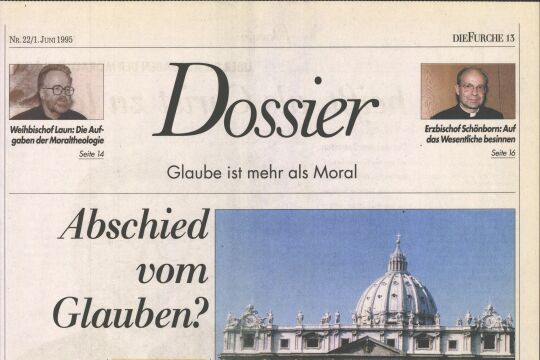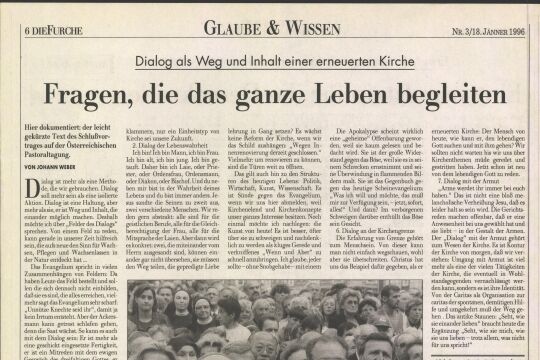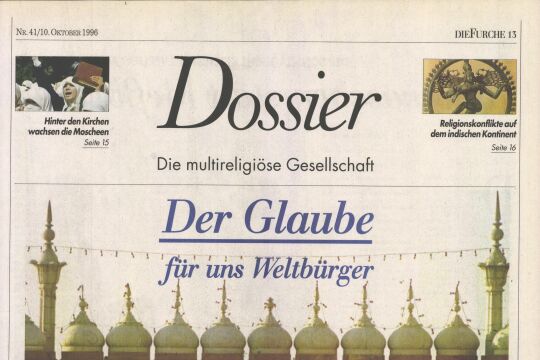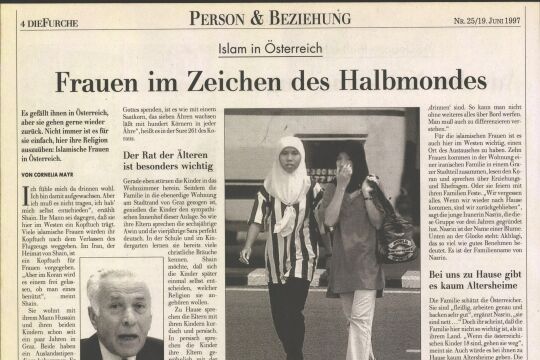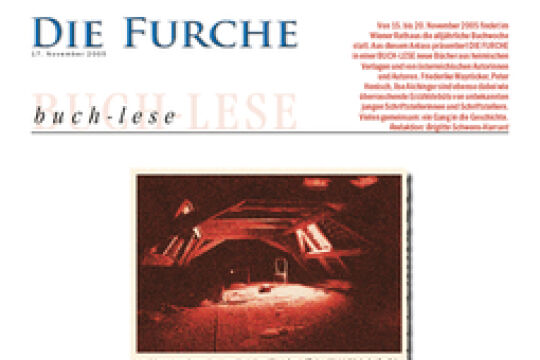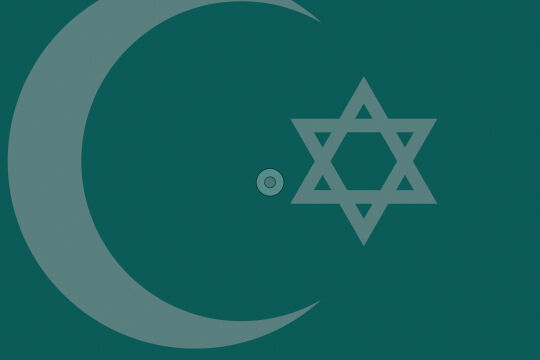Lieben, trotzdem
FOKUS
Wie interreligiöse Beziehungen die Glaubensgrenzen sprengen
Michael Blume ist Forscher und evangelischer Christ – seine Frau Zehra Muslima. Christentum, Islam und Wissenschaft unter einem Dach – kann das gut gehen? Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis.
Michael Blume ist Forscher und evangelischer Christ – seine Frau Zehra Muslima. Christentum, Islam und Wissenschaft unter einem Dach – kann das gut gehen? Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis.
Viele Jahre habe ich als Religionswissenschaftler versucht, zwischen meiner öffentlichen, aufklärenden Funktion und meinem Privatleben klar zu unterscheiden. Doch kaum noch jemand kommt zu einem Vortrag oder bestellt ein Buch, ohne vorher einen digitalen Blick auf die Person geworfen zu haben. Und so wissen die meisten Menschen schon, bevor ich das erste Wort gesprochen habe: Hier ist also ein evangelischer Christ aus einer ursprünglich konfessionslosen, aus der DDR geflohenen Familie, verheiratet mit einer Muslimin türkischer Herkunft. Die Fragen liegen also auf der Hand: Wie vereinbaren Sie Wissenschaft und Glauben? Und wie gehen Christentum und Islam miteinander?
Meine Doktorarbeit schrieb ich – selbst – zu Religion und Hirnforschung. Und es zeigte sich schon damals, was der studierte Theologe Charles Darwin (1809 – 1882) im Rahmen seiner Evolutionstheorie vermutet hatte: Wir Homo sapiens haben nicht nur auf Sprachfähigkeit, Musikalität und Mustererkennung vorgeprägte Gehirne evolviert, sondern eben auch individuell unterschiedliche Veranlagungen zu Religiosität und Spiritualität. Der gemeinsame Glaube an höhere Wesenheiten wie Ahnengeister oder Gottheiten verbindet Menschen zu Gemeinschaften, die untereinander vertrauensvoller kooperieren und im Durchschnitt auch mehr Kinder großziehen. Allerdings sind religiöse Menschen dadurch nicht moralisch bessere Menschen: Gemeinschafts- und Sinnstiftung nach innen kann mit Abgrenzung und sogar Aggressivität nach außen einhergehen – etwa gegenüber Anders- und Nichtglaubenden oder gegenüber Homosexuellen. Ihnen wird bisweilen vorgeworfen, das erste aller biblischen Gebote „Seid fruchtbar und mehret euch!“ zu missachten.
Liebe, ja - und dann?
Aber auch wir interreligiösen Paare stellen die Gemeinschaftsgrenzen auf die Probe. Liebe, gut und schön. Aber wohin werden die Kinder gehören? Das rabbinische Judentum erkennt bislang nur die Kinder einer jüdischen Mutter als jüdisch an, unabhängig von der Religionszugehörigkeit des Vaters. Im Islam gilt dagegen die Religionszugehörigkeit des Vaters als entscheidend – was ein Argument von Traditionalisten ist, muslimischen Männern die Ehe mit Christinnen zu gestatten, aber den umgekehrten Fall (christlicher Ehemann, muslimische Ehefrau) auszuschließen. Im Ezidentum sind dagegen – bisher – nur Ehen innerhalb der eigenen, ezidischen Kaste vorgesehen, wogegen jedoch immer mehr in Europa Aufgewachsene aufbegehren. Auch christliche Kirchen taten sich mit sogenannten „Mischehen“ lange schwer und meine Frau und ich lösen immer wieder Erinnerungen älterer Menschen an evangelisch-katholische Familiendramen noch des letzten Jahrhunderts aus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!