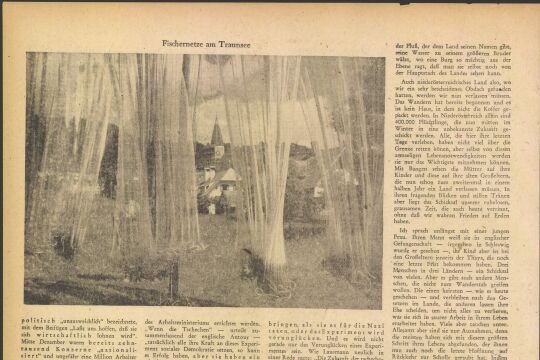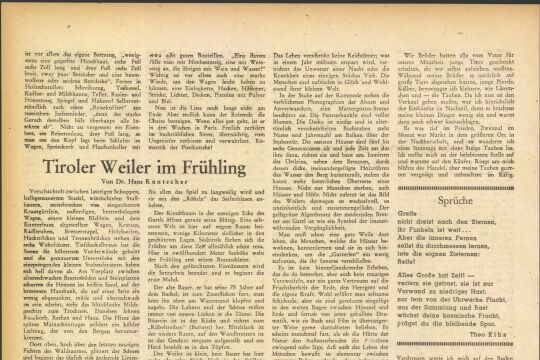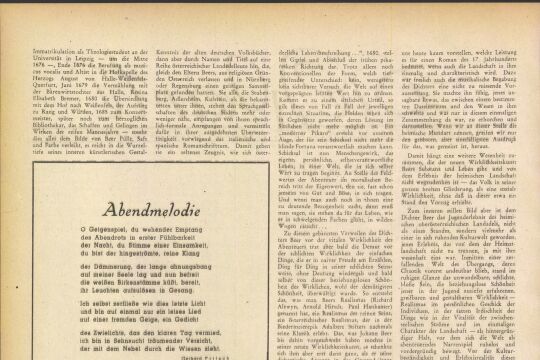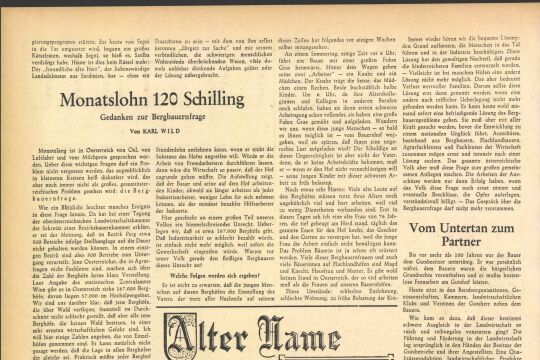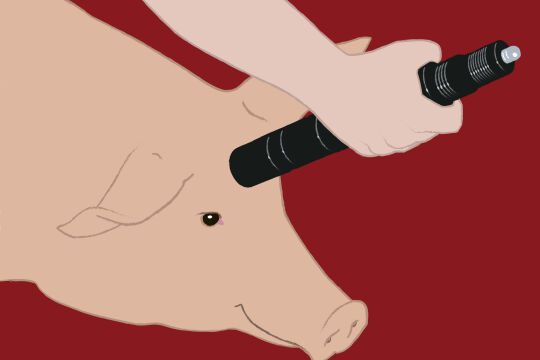Auf wenigen Hektar ziehen die Menschen Gemüse, Kohl, Tomaten und Rote Rüben, in Handarbeit melken sie die Kühe.
Die Ernte des Landes landet nicht unter Plastikhüllen und Barcodes in den Supermarktregalen, sondern auf den Märkten, waghalsig zu Bergen aufgetürmt.
Verschnaufen, das geht eigentlich nur beim Heiligen Nikolaus. Wie jeden Sonntagvormittag sitzt der Bauer Cornel Lascu im Kirchenschiff vorne auf einem Holzstuhl mit geschwungener Rückenlehne. Während im Altarraum vor ihm der Priester mit sonorer Stimme betet, haben die zahlreichen Gottesdienstbesucher das "Herr, Erbarme Dich unser" angestimmt. Cornel Lascu aber, die Wollmütze in den Schoß gelegt, atmet tief durch. Seit drei Stunden ist er schon da, noch eine Stunde wird die orthodoxe Messe dauern. Dann wird der bullige Mann mit dem ergrauten Haar das Kirchenschiff verlassen. Er wird den Kirchenhügel hinunter gehen, über die Brücke entlang der Schotterstraße nach Hause. Immer dieselbe Strecke, rund einen Kilometer lang, ohne Ampel, ohne Zebrastreifen, ohne Trottoir bis zum Haus, das anstatt einer Adresse nur eine Nummer trägt: 239. In dem zweistöckigen Gebäude haben schon seine Großeltern gewohnt. Hier ist Lascu aufgewachsen und hat gemeinsam mit seiner Frau eine Tochter und einen Sohn großgezogen. Im Stall wird auch am Wochenende das Vieh vor den leeren Krippen warten. Doch jetzt, als die Gemeinde zum letzten "Herr, Erbarme Dich" ansetzt, als die Frauen sich auf den Steinboden werfen, als der Weihrauch bis in die Stirnhöhlen zieht, hält Lascu inne. Diese Momente gehören ihm. Einmal war er mit den Kindern im Süden: "Damit sie das Meer sehen." Doch das ist viele Jahre her. Seine Auszeit vom Alltag beginnt mit den goldenen Heiligenbildern und endet, wenn ihm der silberbestickte Priester die Kommunion reicht. Und nicht nur ihm geht es so.
Auswanderungswelle in den 90ern
Die Gemeinde Vurpa r in Siebenbürgen, Zentralrumänien, 30 Kilometer von Hermannstadt entfernt, hat offiziell 2500 Einwohner. Es sind wohl weniger, wenn man jene wegzählt, die regelmäßig für ein paar Monate nach Deutschland, Österreich und Frankreich gehen. Über drei Hügel führt die einspurige Straße nach Vurpăr, vorbei an Schafherden, vorbei an mageren Birken, bis zum zweisprachigen Dorfschild neben der Western-Union-Filiale: Vurpa r/Burgberg steht da. Vor der Revolution haben in Vurpa r Siebenbürger Sachsen gelebt, 900 Familien sollen es gewesen sein. Doch sie, deren Vorfahren im 13. Jahrhundert hierher kamen, um in der Pufferzone zwischen West und Ost die Christenheit zu verteidigen, sind auf der Suche nach einem besseren Leben in den 1990er Jahren in Scharen nach Deutschland ausgewandert. Nur ihre Wehrkirche haben sie dagelassen, deren Turm weiter auf dem höchsten Hügel thront. Seit fast tausend Jahren blickt er auf das Dorf, auf die in Streifen geschnittenen Felder, die beginnen, wo die Gemüsegärten enden, auf die Lebensweise, die die Sachsen, die Rumänen und die Minderheit der Roma im Dorf vereint: die Landwirtschaft. Auf wenigen Hektar ziehen die Menschen Gemüse, Kohl, Tomaten und Rote Rüben, in Handarbeit melken sie die Kühe. Das Geflügel, es rennt frei auf den Höfen herum. Geschätzt rund ein Drittel der im Land konsumierten Lebensmittel werden von Kleinbauern im Familienbetrieb mit wenig Gerätschaft und viel Muskeleinsatz erzeugt und am Handel vorbei vermarktet. Die Ernte des Landes landet nicht unter Plastikhüllen und Barcodes in den Supermarktregalen, sondern auf den Märkten, waghalsig zu Bergen aufgetürmt, und mit enthusiastischer Stimme beworben. Und stumm in den Armen der Frauen, die in den Ecken eine Handvoll Karotten anbieten, und einen Bund Petersilie dazu. Kein anderes Land der EU zählt mehr Landwirte als Rumänien, jeder dritte lebt hier, und nirgendwo sind die Höfe ähnlich klein. 95 Prozent der dreieinhalb Millionen rumänischen Bauern bewirtschaften weniger als zehn Hektar Fläche, der Großteil weniger als fünf. Ein österreichischer Landwirt käme mit zehn Hektar kaum über die Runden. In Vurpa r ist man damit Großbauer.
Vier Schweine, ein paar Hühner
Cornel Lascu ist das nicht. Der 46-jährige hat vier Schweine, eine Handvoll Hühner, eine Handvoll Hektar Felder für das Futtergetreide, seine Frau Daniela kümmert sich um das Gemüsefeld hinter der Scheune. Und neben der Scheune, hinter dem Holztor, da stehen Lascus Pretiosen, da stehen seine vier "Sensibelchen", da steht, was dem sonst zurückhaltenden Mann Stolz und Freude ins Gesicht spiegelt. "Pass nur auf. Sie sind schreckhaft", sagt er noch, bevor er die Holzklinke nach unten drückt und mit beruhigendem "Schhh Schhhh" über die Türschwelle ins Dunkle tritt. Wuchtige schwarze Köpfe, durch Stricke gebändigt, lassen vom Heu ab und drehen sich konsterniert nach dem unerwarteten Besuch um: Es sind Wasserbüffel mit dunklen Augen und langgezogenen Hörnern, wie Piratensäbel nach hinten gezwirbelt, mit gedrungenen Rümpfen und quadratischen Hufen, ein jedes Tier fast eine Tonne schwer.
Kaum ein Bauer tut sich so etwas heute noch an. Der Büffel tritt, wenn er sich bedroht fühlt und er setzt seine Hörner ein, wenn es sein muss. Doch weil er den Pflug stärker als das Pferd zieht, weil er Sachen frisst, die sogar die Schweine verschmähen, und weil seine Milch mit acht Prozent doppelt soviel Fett wie jene der Kuh enthält, hat man in der Gegend über die Jahrhunderte hinweg an ihm festgehalten. Lascu hat heute einen Traktor, so altersschwach wie funktionstüchtig, seine Büffel stehen ihrer Milch wegen im Stall. Zehn Liter Milch, soviel gibt eine Büffelkuh im Sommer, wenn das Futter saftig ist, fünf Liter sind es jetzt zu Frühjahrsbeginn.
Vom Großvater hat Lascu den Umgang mit ihnen gelernt. Auf Kühe umzusteigen, das käme ihm nicht in den Sinn. "Mit den Büffeln bin ich doch aufgewachsen", sagt er und schüttelt den Kopf, als er von den Nachbarn erzählt, die sogar den Garten aufgegeben haben. Sich einfach von den eigenen Wurzeln davonstehlen? Das geht doch nicht. Also takten die Tiere seinen Alltag. Vor sechs Uhr morgens hackt er die Maisstengel, schneidet Kartoffeln oder Rüben, füllt Mais in die Kübel. Er gibt den Büffelkühen zu fressen und melkt sie, da hat der Mann selbst noch nichts im Bauch. Dann füttert er die Ferkel, verarbeitet die Milch. Er fegt mit dem Reisigbesen den Hof von Strohresten frei. Er bestellt den Acker, repariert den rostigen Traktor. Er sät im Frühjahr und fährt nach und nach die Ernte ein. Er heut im Herbst und schlachtet die Sau vor Weihnachten im Schnee. Er ruht nie, wenn er will, und immer, wenn er kann. An diesem Frühlingsnachmittag muss noch das Holz für die Heizung eingebracht werden. Was macht all die Anstrengung mit einem Menschen? Liebevoll streicht Lascu einer der Büffelkühe über die knochige Kruppe. "Man muss mögen, was man tut." Ein banaler Kalenderspruch, Kitschkalender, hier in Vurpa r, im Haus 239, bedeutet er Anker und Antrieb zugleich. Die Büffelmilch sichert der Familie täglich Nahrung und Bargeld für Waschmittel und Schulsachen, für Kleidung und Medikamente. Ein paar Leute in Hermannstadt nehmen der Familie die Milch regelmäßig ab. Um über die Runden zu kommen, arbeitet Lascu als Aufseher an zwei Tagen der Woche in einem Museum in der Stadt. Und wenn das Geld gar nicht mehr reicht, verkauft die Familie ein Schwein. Lascus Bruder ist vor wenigen Jahren nach Österreich emigriert und handelt jetzt mit Autoteilen in Klosterneuburg. Doch Lascu ist geblieben. Warum tut sich das einer an?
Die in Hermannstadt verkaufte Büffelmilch sichert der Familie täglich Nahrung und Bargeld für Waschmittel und Schulsachen, für Kleidung und Medikamente.
Shuttle-Busse für die Arbeiter
In Vurpa r ist er nicht der einzige. Viorel Cocos' z um Beispiel, der Tomatenzüchter, dessen Samen Fleischtomaten auf ein Gewicht von einem Kilogramm wachsen lassen und die begehrt sind im Dorf wie Bier und Brezel auf dem Volksfest. Der einem Sachsen 1999 sein Haus abgekauft und jetzt im Sachsenhaus auf seine Frau wartet, die in Deutschland auf Saison arbeitet. Oder Johann Sonntag, der sich schon vor vielen Jahren für Rumänien entschieden hat, und dem jetzt nach dem Tod der Frau nur ein stattliches Ross geblieben ist und eine Muttersprache, die hier im Dorf kaum einer mehr versteht. Sie und all die anderen bestreiten den Alltag mit wenig Vieh, wenig Geld, kleiner Ernte und großer Müh. Und nicht nur hier: Fast jeder zweite rumänische Kleinbauer verarbeitet seine Produkte selbst. Doch vor allem die Jüngeren machen nicht mehr mit. Die Zahl der Bauern in Rumänien sinkt, ohne dass der Tod in allen Fällen dem Bauersein ein Ende macht. Oft ist es die Aussicht auf ein einfacheres Dasein, das die Leute die Höfe aufgeben lässt -vor allem, wenn man nicht wie Lascu in der Nische irgendwie ein Auskommen findet. Und zumindest hier in Siebenbürgen locken Alternativen, ohne dass man gleich das Land verlassen muss. Die Industriebetriebe rund um Hermannstadt, die ausländischen Investoren aus der Automobil-und Elektronikbranche, Bosch, Continental, die Marquardt-Gruppe, sie suchen händeringend nach Arbeitskräften. Sie schicken täglich Shuttle-Busse in die abgeschnittenen Dörfer, um Arbeiter zu holen. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis liegt bei unter 2,5 Prozent. An Menschen wie Lascu und Cocos fahren diese Busse vorbei. Wohl auch, weil der Bauch gegen den Kopf gewinnt.
Auch wenn es immer schwieriger wird. Die Höfe, so bescheiden sie auch sein mögen, können die Familien alleine nicht bewirtschaften. Sie brauchen billige Hände, auf dem Feld, im Stall und auf der Weide. Tagelöhner, die die fehlenden Maschinen ersetzen und die Viehherden über die Allmende treiben, sie brauchen Hirten für die Alm. Seit die Menschen hier denken können, haben das die Roma im Dorf übernommen. So wie Lascu das Bauernsein von seinen Großeltern gelernt hat, so lernten die Roma-Kinder das Knechtsein von ihren Älteren. Doch seit die Arbeitnehmer-Freizügigkeit die Menschen nach Deutschland, Frankreich und Österreich lockt, seit sich zwei-oder dreihundert Euro im Westen mit weniger Schweiß und Mühsal verdienen lassen, haben vor allem diejenigen Vurpa r verlassen, die am wenigsten zu verlieren haben. Seit die Roma gehen, nimmt die Arbeit deshalb gar kein Ende mehr.
Nur im Sonntagsanzug dürfen die Hände ruhen. In der Kirche des Heiligen Nikolaus auf dem Hügel hat der Priester sich vor die Gemeinde gestellt. Der Weg zu Gott erfolge freiwillig, predigt der Priester eindringlich. Und der zum Bauersein? Es wäre schön, meint Lascu, wenn er die Bindung an Tier und Boden an seine Kinder so weitergeben könnte, wie er es selbst erfahren hat. Wenn er ihnen zeigen könnte, was den Menschen mit seinem Land verwurzelt. Die Tochter zeigt Ambitionen, studiert Landwirtschaft in Hermannstadt, ein Glück! Der Sohn ist erst 15, interessiert sich für Religion. Wer weiß. Lascu hat gelernt, dass man den Lauf des Lebens wenig mitbestimmen kann. Es kommt wie es kommen muss. Wenn man Lascu fragt, wovon er träumt, weiß er keine rechte Antwort. Auf die Nachfrage, was er in seinem Leben ändern würde, sagt er: "Nichts". Er zuckt mit den Schultern. Eigentlich hat er sich darüber nie Gedanken gemacht.