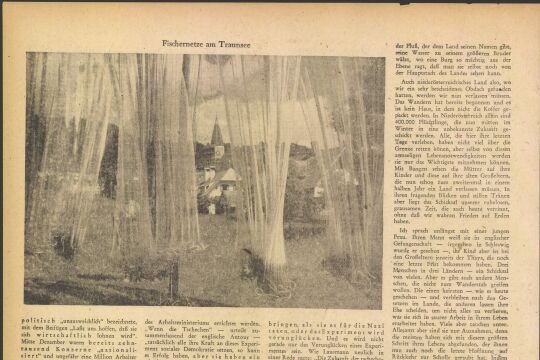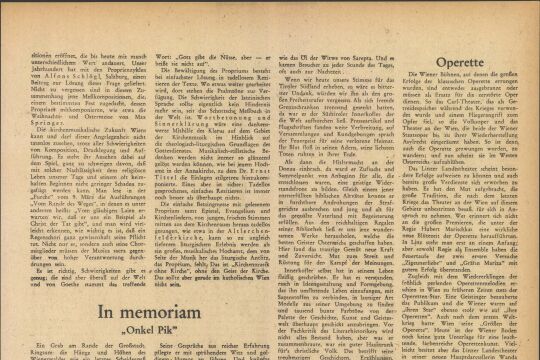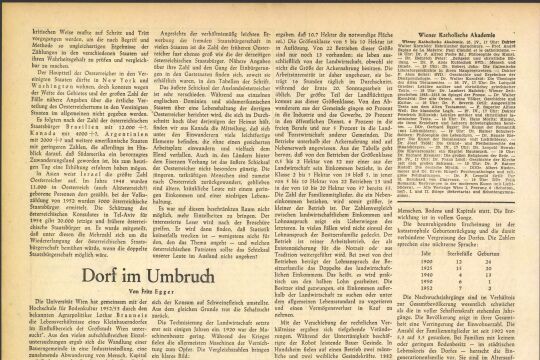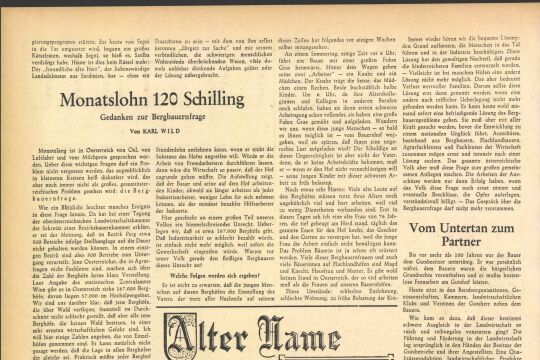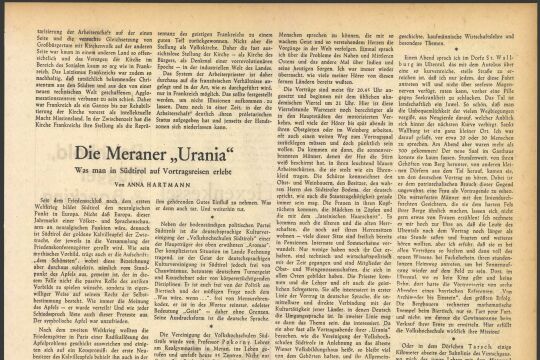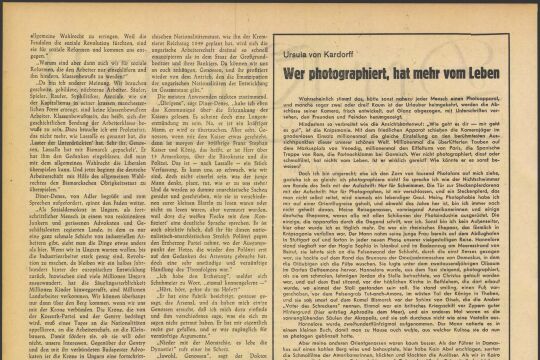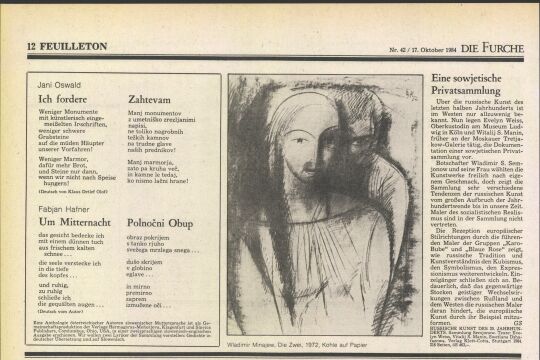Früher ist der Oberösterreicher Franz Hofer in den Osten Deutschlands gefahren, um seinen Bauern zu zeigen, wie es nicht geht. Heute sehen sie, wie es auch anders geht.
Ein früher Morgen in Oberschindmaas, irgendwo im Sächsischen zwischen Dresden und Leipzig. Ein ganzer Bus voll Altbauern und Altbäuerinnen aus dem Bezirk Schärding drängt durch ein Hoftor, ein wenig unterhalb der Straße, hinein in einen alten Fachwerk-Vierkanter, wo ein großer Misthaufen liegt: "Der Misthaufen macht den Hof", sagt der Bauer. "Viel Mist, viel Geld", antwortet ein österreichischer Kollege anerkennend. Auf der Metaebene der Fachsprache kommt man sich schnell nahe.
Die Oberösterreicher aus der Grenzregion zu Deutschland zwischen Inn und Donau, wo man "mir hand" statt "wir sind" sagt, besuchen den Hof einer Wiedereinrichterin, also einer Landwirtin, die nach der Wende, mit Auflösung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) ihr altes Eigentum wiedererworben hat. Sie hatte kein gutes Verhältnis zu ihrem damaligen Chef gehabt, erzählt die 41-Jährige Barbara Seidel. Auch heute noch steht Feindschaft zwischen David und Goliath, dem Privatbetrieb und der Genossenschaft. "Mut hat nur der Ahnungslose", sagt sie. "Wir wussten nicht, was auf uns zukommt."
1990 entschied sie sich für den eigenen Betrieb, wurde sofort aus der LPG entlassen, und musste mit ihren 26 Hektar Land ganz von vorne beginnen. Es gab kein Vieh, keine Maschinen. Man tat sich zusammen, eine Handvoll Menschen im Dorf, half sich gegenseitig. Dann wurde der erste Traktor angeschafft. Kein ZT 300 oder Belaruss, wie sie auf den LPGs standen, sondern ein Steyr, für sechs Jahre ihre einzige Maschine. Viele hatten damals gemeint: "Ne Frau alleene, des wird doch nischt." Und einige Bauern sagten dem 42-jährigen Volker Seidel, dem ausgebildeten Landmaschinenmechaniker:"Die wär' was für Dich!" Die beiden haben geheiratet. Seitdem sind sie ein Team, leben rund um die Uhr für ihre Landwirtschaft. Im Taktschlag der Fruchtfolge: Raps-Zuckerrüben-Futterrüben-Gerste-Weizen-Hafer-Erbsen.
Inzwischen ist die Gruppe hinübergegangen in die neue 1.000 Quadratmeter große Halle, wo die riesigen Dreschmaschinen stehen, die Traktoren und Ballenpressen. "Wie viel mäht der denn?", fragt einer aus dem Innviertel. "Neun Meter. Selbstfahrer." Es ist wieder die Metaebene, die im Nu aus Fremden Vertraute macht, mit gemeinsamem Wissen, ohne dieses je zuvor miteinander geteilt zu haben. 150 Hektar betreuen die Seidels, der Großteil davon ist Pachtgrund. Bei 3.500 Schilling liegt die Pacht für einen Hektar. Eine Schärdingerin stößt hörbar die Luft aus: "Das ist geschenkt."
Einziger Praktikant
Der Großteil der Seidelschen Landwirtschaft ist Pachtgrund. Die am Weitesten voneinander entfernten Enden liegen 50 Kilometer auseinander. "Aber das muss ja alles gepresst und gelagert werden, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles alleine machen", sagt der Rudelführer der oberösterreichischen Mann- und Frauschaft, der frühere ÖVP-Klubobmann im oberösterreichischen Landtag, Johann Breit. Urlaub? "Was ist das?" fragt Barbara Seidl. Das Räderwerk darf nicht stillstehen, es hat sich unermüdlich im Rhythmus der Natur mitzudrehen. Winterdienst gibt es für Volker Seidel auch, dann muss er um drei Uhr morgens hinaus. "Wenn am Abend eine Veranstaltung im Dorf ist, fehlt uns die Zeit. So schlimm ist das." Trotzdem würden sich die beiden wieder für diesen Weg entscheiden: "Ich weiß erstens, wofür ich es mache", sagt die Bäuerin, "zweitens werden immer Fehler gemacht, das sind aber meine eigenen und nicht die vorgeschriebenen."
Barbara Seidel hat das harte Arbeiten im Blut. Sie erzählt von ihrem Vater, der im Krieg einen Arm verloren hatte und sich daheim jeden Morgen die 20-Liter-Kanne über den Armstumpf hängte, die andere in die Hand nahm und den steilen Weg zur Straße trug. Schon früh hatte sie mithelfen müssen.
Die Gäste streifen durch die Halle, an den Heuballen vorbei und den Hängern wie auf einer Landwirtschaftsmesse, lassen die Hände schwer und kundig auf die grobstolligen Reifen fallen und fachsimpeln. Zum Schluss erhalten die Bauersleute noch zwei Flaschen Innviertler Schnaps. Sie lächeln verlegen: "Wir werden sehen, ob wir Zeit dazu haben."
Nächste Station ist die Agrargenossenschaft Oberwiera, einige Kilometer weiter. Hier hat der Reiseleiter, der heute 65jährige Agrarjournalist Franz Hofer, vor genau 40 Jahren ein landwirtschaftliches Praktikum gemacht. Als vermutlich erster und einziger bäuerlicher Praktikant aus dem Westen. 1960 hatte er, damals noch Schüler der landwirtschaftlichen Mittelschule in Wieselburg in Niederösterreich, auf der Welser Landwirtschaftsmesse am Stand der DDR einen Prospekt mit dem Titel "Wo die Bauern Millionäre sind" gefunden. Obwohl er dies nicht glaubt, interessierte ihn das fremde Land. Ein halbes Jahr dauerte es, bis sein Wunsch in Erfüllung ging: Sein Mathematikprofessor hatte eine Brieffreundin in der DDR, die wiederum kannte jemanden, der mit der Vergabe von Praktika zu tun hatte. Für die Ferien 1961, Juli und August, wurde Franz Hofer die LPG "Freundschaft" in Oberwiera zugewiesen. Nun sitzen sie alle in dem kleinen Gasthaus "Zur alten Post", wo es jeden Freitag eine 500-Gramm-Schweinshaxe mit Sauerkraut, Meerrettichsauce und grünen Klößen um nicht einmal 90 Schilling gibt.
Da prallen Kulturen aufeinander: Die oberösterreichischen Männer mit ihren sonnengegerbten Pranken und die Frauen mit den stämmigen Hüften, Menschen, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben Urlaub machen. Und Hofers Kollegen von früher: Herbert, der Traktorist, die Köchin aus der Betriebsküche und vier Generationen Verwalter der LPG beziehungsweise Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft. Für Barbara Seidel sind jene, die in den Genossenschaften geblieben sind, keine richtigen Bauern: "Das sind bestenfalls noch Landarbeiter", hatte sie gemeint.
Gedrückte Stimmung
Auch den oberösterreichischen Gästen, von denen jeder etwa 20 bis 25 Hektar Grund sein Eigen nennt, sind solche Betriebe wie in Oberwiera mit 1.200 Hektar nicht ganz geheuer: "I mog net gern an Chef über mir. Unser Hof ist mehr als 400 Jahre alt, und ich empfinde es als Glücksgefühl, am Abend über die eigenen Gründe zu gehen", entringt es sich einem von ihnen. Das stimme schon, kontert der junge Vorstandsvorsitzende Bringfried Berger: "Dafür haben wir andere Vorteile: Geregelte Arbeit, Urlaub und ähnliches". Und außerdem die besseren Chancen in einer künftigen europäischen Landwirtschaft als ein romantischer Kleinbetrieb. Aber das sagt er nicht, deswegen aber hat wohl Franz Hofer seine Kollegen auch hierher gebracht. Rund 60mal ist er seit seinem Praktikumsjahr mit oberösterreichischen Bauern in die DDR, beziehungsweise die späteren neuen Bundesländer, gekommen.
Während des Essens erzählt Franz Hofer von seinem Praktikum: Dass er sich zur Drescherbrigade gemeldet hatte, dass er just am 13. August, seinem freien Sonntag, in Leipzig war und dort aus den Lautsprechern auf den Straßen vom Mauerbau in Berlin gehört habe. Ab da war die Stimmung gedrückt: Einer seiner Kollegen, mit denen er im Lehrlingsheim untergebracht war, sagte zu ihm am Tag nach dem Baubeginn: "Mensch, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich noch gestern abgehauen." Durch die Schlafräume kamen nachts Aufseher mit Holzstöcken, überall wurden Saboteure vermutet. Die Fernsehantennen wurden abmontiert, da mit ihnen westliche Programme empfangen werden konnten.
Die Arbeit auf der LPG hat Franz Hofer aber gefallen. Eine gewisse Rückständigkeit ist ihm aufgefallen, der hohe Dieselverbrauch, der Personalaufwand, der Mangel an Spritzmitteln und das verordnete kollektive Denken. Erst ein Jahr zuvor waren die bis dahin freien Bauern kollektiviert worden. Statt der einst 200 Beschäftigten arbeitet heute noch ein Zehntel in der Agrargenossenschaft.
Beim anschließenden Rundgang liegt das riesige Gelände still unter herunterbrütender Sonne zwischen Ortsschild und Kirche. Ab und zu kurvt verwegen ein Traktor um die Ecke einer Baracke. Nicht mehr 1.000, sondern nur mehr 300 Kühe ("Schwarzbunte") stehen in den Ställen, die Schweinemast ist gänzlich aufgegeben worden. Fast die Hälfte der Landwirtschaft wird in Sachsen genossenschaftlich betrieben. "Es war eine schöne Zeit" resümiert der LPG-Vorsitzende von damals, als Franz Hofer zu Gast war. "Eine schwere Aufgabe, aber eine lehrreiche Zeit." Es sei ihm damals schon klar gewesen, dass es nicht so bleiben werde, sagt Hofer auf der Rückfahrt: "Das Getreide hat soviel gekostet wie das Brot. Für die Milch bekam die LPG soviel wie der Konsument bezahlt hat. Aber dass es so wird, hätte ich mir vor 40 Jahren nicht gedacht ..."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!